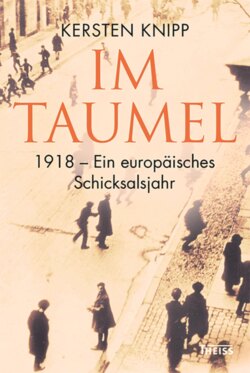Читать книгу Im Taumel - Kersten Knipp - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wer ist „Wir“? Das Habsburgerreich und seine Nationen
ОглавлениеExistirte der österreichische Kaiserstaat nicht schon längst, man müßte im Interesse Europa’s, im Interesse der Humanität selbst sich beeilen, ihn zu schaffen!
František Palacký (1798–1876),
Vordenker der tschechischen Nationalbewegung
Als der Kaiser gestorben war, machten sich, ein letztes Mal, die Zeremonienmeister ans Werk. Noch einmal galt es, die Größe des Reichs zu demonstrieren, noch einmal die Opulenz und Pracht des Staats und der ihm vorstehenden Familie zu inszenieren. Der Kaiser, Franz Joseph I., war tot und sein Reich auf das Schwerste angeschlagen. Der seit zwei Jahren tobende Krieg hatte tiefe Wunden gerissen. Millionen Bürger hatten ihr Leben verloren, insbesondere durch Teile der slawischen Länder war die Gewalt mit nie zuvor gekannter Wucht gefegt. Hier und heute aber, in Wien, der Hauptstadt, auf den Prachtstraßen des Imperiums, sollte die alte Kaiserherrlichkeit noch einmal aufblühen – zumindest ein paar Tage lang, ein Mal noch, bevor alle, die Dynastie und die in ihr zusammengeschlossenen Länder, miteinander untergingen, aus jenem berstenden imperialen Verbund kippten, der sie so lange Zeit, teils mehrere Jahrhunderte lang, zusammengehalten hatte.
Darum sollte der letzte Gang des Kaisers und Königs in gebührendem Glanz gewürdigt werden – und zwar mit einem Begräbnis erster Klasse, wie es den Oberhäuptern des Reiches zustand. Eben damit aber stellte sich Obersthofmeister Alfred von Montenuovo und seinen Mitarbeitern eine nicht leicht zu beantwortende Frage: Wie sähe ein solches Begräbnis aus? Die letzte Zeremonie solcher Art hatte 1835 stattgefunden, als Kaiser Franz I. zu Grabe getragen wurde. Dessen Nachfolger Ferdinand I. war in Prag gestorben und anschließend mit einer vergleichsweise bescheidenen Prozedur in die Kapuzinergruft überführt worden. Ein Begräbnis erster Klasse hatte es darum seit einem dreiviertel Jahrhundert nicht mehr gegeben. Die Einzelheiten des Ritus waren größtenteils mündlich weitergegeben worden, und diejenigen, die die Abläufe in allen Einzelheiten kannten, lebten nicht mehr. So ließ Montenuovo Akten des Jahres 1835 durchstöbern, in denen er, dank der peniblen buchhalterischen Tradition des Reiches, tatsächlich die entsprechenden Anweisungen und Erläuterungen fand.1
So entsprach die Totenfeier ganz der Tradition. Sechs Tage nach seinem Tod am 21. November 1916 wurde der Leichnam des Kaisers in die Hofburgkapelle gebracht und in der Uniform eines Feldmarschalls aufgebahrt. Drei Tage hatte die Bevölkerung nun Zeit, Abschied von dem toten Herrscher zu nehmen. Dann wurde der Leichnam in die Kapuzinergruft überführt. „An einem klaren und sonnigen 30. November, früh nachmittags wurde der Sarg geschlossen und dann auf den prächtigen, ganz schwarzen Galawagen gehoben, der von acht Rappen gezogen und von ungezählten Kranzwagen und Kutschen mit den höchsten Hofwürdenträgern vorgeleitet wurde“, notierte ein Augenzeuge.2 Schritt für Schritt entfaltete sich vor den Augen der Öffentlichkeit ein düsteres Schauspiel: Langsam bewegte sich der einem Kranzwagen folgende Galawagen mit dem Leichnam, gefolgt von den Kutschen der höchsten Würdenträger und denen der Familie, dann vom langen Zug der politischen, militärischen und geistlichen Würdenträger, der Leibgarden, Korporationen und Hofbediensteten durch die Stadt: zunächst über den äußeren Burghof zur Ringstraße, dann über den Franz-Josefs-Kai und schließlich die Rotenturmstraße entlang zum Stephansdom. Entlang der gesamten Wegstrecke standen Menschen auf der Straße, lehnten sich aus den Fenstern, reckten die Hälse, um dem Kaiser auf seinen letzten Metern hinterherzuschauen, noch einen flüchtigen Blick auf den Sarg zu erhaschen.
Den Weg zur Kapuzinergruft legten die Teilnehmer zu Fuß zurück, Kaiser Karl und Kaiserin Zita, in der Mitte der blond gelockte Thronfolger und spätere EU-Parlamentarier Otto von Habsburg, damals gerade vier Jahre alt. Dann, in der Gruft selbst, war es so weit: „Nach einer neuerlichen kurzen Einsegnung wurde der Sarg auf den vorbestimmten Platz in das Gruftgewölbe hinunter getragen, der Obersthofmeister lieferte dem Pater Guardian der Kapuziner den Sargschlüssel aus, Kaiser Franz Joseph war im Erbbegräbnis der Habsburger zur Ruhe gegangen.“3
Der Trauerzug mit dem Sarg von Kaiser Franz Joseph I. am 30. November 1916 vor dem Stephansdom.
Gegangen, so die allgemeine Empfindung, war aber nicht nur der Kaiser allein. Mit ihm, so schien es vielen Menschen, solchen aus der unmittelbaren Umgebung des Kaisers ebenso wie den Bürgern aus den Randgebieten des Reichs, hatte sich auch der Hüter der etablierten Ordnung verabschiedet, der Garant einer zwar in die Jahre gekommenen, aber weiterhin bestehenden Ordnung, die, je nach Ausgang des Krieges, vielleicht sogar noch eine Zukunft hatte. Zwar hatte man mit dem Tod des Königs rechnen müssen. Aber als er eintrat, schien das Reich dennoch auf einmal ein anderes. „Bei der Begräbnisfeier zu St. Stephan am 30. November 1916 hat ein alter General, der sein Schluchzen krampfhaft zurückhielt, auf des Kaisers Sarg hindeutend, gemurmelt: ‚Das ist die größte Niederlage, die wir im gegenwärtigen Kriege davontragen konnten!‘“4 Was auf dem Spiel stand, ahnte offenbar auch Franz Joseph selbst. Bis zum Schluss, bis wenige Stunden vor dem Tod habe er an seinem Schreibtisch gesessen, mit letzten Kräften und dem Fieber trotzend, berichtet sein Kammerdiener Eugen Ketterl. „Ein erschütternder Kampf“ sei das gewesen, notiert er in seinen Erinnerungen, das letzte Aufbäumen eines alten Mannes gegen den fortschreitenden Verfall, geführt „mit eisernem Willen den Tod zu bannen.“ Der Kampf war aussichtslos, gewiss. Ihn durchzustehen, so empfand es Ketterl, war für den Kaiser trotzdem die einzig denkbare Option. „Nicht der Wille zum Leben war es, der ihn aufrecht hielt, nicht die Furcht vor dem Tode, sondern die entsetzliche Angst, dass die Totenglocken, die ihm läuten würden, auch sein Reich zu Grabe geleiten könnten.“5 Und so lag es nahe, dass auch die Umstehenden am nächsten Morgen, als der Kaiser in einen provisorischen Holzsarg gelegt wurde, das unbestimmte Gefühl hatten, mit dem Tod des Regenten würde sich etwas Grundlegendes ändern im Staate Österreich. „Mutlosigkeit erfüllte uns, als wäre ein Felsen, der die Stürme der Jahrhunderte überdauert hatte und an den wir uns ruhig und zuversichtlich anklammern konnten, von den Wogen des Schicksals hinweggespült worden. Furcht und böse Vorahnung verschleierten unseren Blick.“6
Franz Joseph: der Fels im Sturm, so schien es zahllosen Bürgern des Reiches. Der Kaiser und König war ein Symbol der Macht, vor allem aber der Ordnung. Vielen Bürgern schien er schon darum unersetzlich, weil sie sich ein Österreich-Ungarn ohne ihn gar nicht mehr vorstellen konnten. Fast 68 Jahre hatte er an der Spitze des Reichs gestanden, es gelenkt, repräsentiert und zahllose Bürger ihrer Identität versichert. Seine Porträts prangten an Bahnhöfen, Verwaltungsgebäuden, an Kasernen und Brücken. Straßen, Plätze, Bahnlinien, Schiffe trugen seinen Namen, in jeder Schulklasse hing sein Bild. Sein Antlitz zierte Münzen und Briefmarken, es prangte auf in Privathäusern hängenden Ölgemälden, zierte die Teller und Tassen in zahllosen Haushalten.7
Über drei, fast vier Generationen hatte sich seine Regentschaft erstreckt, sodass das Imperium und sein Herrscher für die meisten Untertanen eins waren. Nicht zuletzt auf dieser gedanklichen Assoziation zwischen Kaiser und Reich, so schrieb in ihrem Nachruf die Arbeiter-Zeitung, das Blatt der österreichischen Sozialdemokraten, gründete das Ansehen des Verstorbenen. „Denn einem so langen Regieren wohnt eine verbindende Kraft inne, die selbst von Regententugend unabhängig ist und ihre Wirksamkeit schon aus ihrer Dauer empfängt. Durch die Dauer der Regierung Franz Josephs ist jenes Gefühl der Beständigkeit erzeugt worden, das gerade in diesem zerrissenen und schwankenden Staate wohltätig wirkte.“8 Trat man einen Schritt zurück, zeigte sich die Kontinuität des Herrscherhauses in ihrer eigentlichen Dimension: Die Habsburger gehen zurück auf das 12. Jahrhundert, als sie von ihrem Stammsitz, der Habsburg, heute im Schweizer Kanton Aargau gelegen, aufbrachen, ihr Reich zu gründen. So hatte eine weit zurückreichende Tradition dazu beigetragen, das Ansehen einer Dynastie zu wahren, die Schritt für Schritt ein immer weiter ausgreifendes Reich zusammengetragen und regiert hatte. Über Jahrhunderte hatte dieses Herrschergeschlecht es verstanden, die Einheit des Reiches zu wahren, und das trotz der erheblichen Fliehkräfte, die sich gerade in der letzten Phase seines Bestehens zeigten. Sie zusammenzuhalten, machte die Würde der für den Staatserhalt befassten Mitglieder der Dynastie aus, stellte sie in einen historischen Rahmen, der, wie in allen Fällen imperialer Staatskunst, weit über sie selbst hinausreicht.9
Das Habsburgerreich war ein hochkomplexes politisches Kunstprodukt von Völkern und Staaten, die aus eigenem Antrieb kaum zueinandergefunden hätten, die wenig miteinander verband als eben der Umstand, dass sie alle aus Wien regiert wurden. Die Parlamente der einzelnen Länder mochten in vielem autonom sein. Aber zuletzt waren sie durch den Kaiser und die kaiserlichen Institutionen doch aneinander gebunden. Im Jahr 1910 hatte das Kaiserreich 46 Millionen Einwohner, verteilt auf zwölf große Völker. Noch beeindruckender waren die Dimensionen des Imperiums knapp 150 Jahre zuvor gewesen. Um 1780 erstreckte sich das Reich von Innsbruck bis nach Lemberg, dem heutigen Lwew in der Ukraine, von Mailand und Florenz bis nach Antwerpen, von Prag bis nach Vukovar. Die Menschen, die damals in diesem Reich lebten, sprachen Deutsch, Flämisch, Französisch, Italienisch, Jiddisch, Kroatisch, Ladinisch, Polnisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch, Slowenisch, Ungarisch und Ukrainisch.10 Die Menschen, die sich dieser Sprachen bedienten, benutzten insgesamt fünf verschiedene Schriftsysteme und hingen mehreren Konfessionen an.11 Doch so verschieden die Kulturen, Konfessionen und Sprachen der unter den Habsburgern lebenden Menschen auch waren: Insgesamt unterschieden sie sich darin viel weniger als etwa jene, die unter der Herrschaft der Osmanen lebten. So gesehen, war das Reich recht einheitlich. „Mochten die Unterschiede zwischen den Sprachen, Gebräuchen und historischen Erinnerungen mit fortschreitender nationaler Bewusstwerdung immer deutlicher auffallen: Alle Untertanen des Kaisers in Wien besaßen eine weiße Hautfarbe, und die allermeisten waren Katholiken. Orthodoxe Serben, die größte religiöse Minderheit, machten 1910 gerade einmal 3,8 Prozent der Bevölkerung aus, Muslime gar nur 1,3 Prozent.“12
Über sie alle wachte seit seiner Inthronisierung 1848 Kaiser Franz Joseph. Schon darum, schreibt der ungarische Schriftsteller Sándor Márai, pflegten sie ein gesteigertes emotionales Verhältnis zu ihm. „Fünfzig Millionen Menschen fanden ihre Sicherheit in dem Gefühl, dass ihr Herrscher jede Nacht vor Mitternacht im Bett war und sich vor fünf Uhr morgens wieder erhob, bei Kerzenschein auf einem amerikanischen Binsenstuhl an seinem Schreibtisch saß, während alle anderen, die ihm ihre Loyalität erklärt hatten, den Sitten und Gesetzen entsprachen.“ Und eben das, so beschreibt es Márai, war das Erstaunliche: Der Kaiser band Menschen aneinander, wie sie verschiedener kaum sein könnten; Menschen, die unter den unterschiedlichsten Umständen und Bedingungen lebten, die einander sprachlich kaum verstanden, sich in ihren Sitten, Verhaltensweisen und Überzeugungen gründlich fremd waren. Wo immer sie wohnten, ob in Wien, Budapest, Prag, Krakau oder Triest: Alle blickten sie auf den Kaiser und sahen in seinem Schicksal ihr eigenes gespiegelt, spürten die Kraft des Bandes, mit dem der Monarch das Reich zusammenband. „Wien und die Monarchie bildeten aus Ungarn, Deutschen, Mährern und Tschechen, Serben, Kroaten und Italienern eine riesige Familie. Alle wussten insgeheim, dass die einzige Person, die inmitten dieser phantastischen Welt der Sehnsüchte, Impulse und Gefühle Ordnung halten konnte, der Kaiser war, und zwar in seiner Eigenschaft als Sergeant Major und imperiale Majestät, Regierungsangestellter, Grand Seigneur, plumper Körper und absoluter Herrscher.“13
Gewiss: Kritische Stimmen gab es auch. Einen „Dämon der Mittelmäßigkeit“ nennt ein Protagonist in Karl Kraus’ Drama Die letzten Tage der Menschheit den Herrscher. In den Augen des Protagonisten – „der Nörgler“ heißt er in dem Stück – ist der Kaiser eine Figur aus vergangenen Tagen, wundersam in die Gegenwart hinübergerettet, ohne dieser doch zu entsprechen und ihren Anforderungen gerecht zu werden. Für die Regierungszeit Franz Josephs findet sein Kritiker nur ungnädige Worte: „eine siebzigjährige Gehirn- und Charaktererweichung der nur um solchen Preis und selbst dann nicht zu verbindenden Völker ist der Inhalt der so regierten Tage, eine Verflachung, Verschlampung und Korrumpierung aller Edelwerte eines Volkstums, die in der Weltgeschichte ohne Beispiel ist“.14 Die Verflachung, die der Nörgler dem Kaiser und damit auch dem Imperium unterstellt, gründet interessanterweise aber gerade in dessen Komplexität. In dem Anspruch der Habsburger, ein Vielvölkerreich zu regieren und vor dem Untergang zu bewahren. „Nur er“, wirft der Nörgler dem Kaiser vor, „vertrat diesen Anspruch, die Welt mit unserer nationalen Mordshetz zu belästigen, begründet in der Gottgewolltheit des Pallawatsch (gemeint: Unordnung, Durcheinander, Anm. d. Verf.) unter Habsburgs Szepter, dessen Mission es schien, als Damoklesschwert über dem Weltfrieden zu schweben. Er ermöglichte dieses budgetprovisorische Gebilde, dessen ewiges Völkerproblem nur durch die innere Amtssprache des Rotwelsch (Gaunersprache) ‚tunlichst‘ zu lösen war und dessen Verständigung durch ein Kauderwelsch versucht werden mußte, wie es die hohnlachende Epoche noch nicht gehört hatte.“15 Scharfsichtig, aber keineswegs lauter greift sich „der Nörgler“ hier einen Aspekt heraus, der im Reich immer wieder und seit dem frühen 19. Jahrhundert in immer schärferer Form für Streit gesorgt hatte: die Sprachenfrage. Deutsch war die erste Amtssprache des Reichs. Aber wie stand es um die anderen, von dessen Bürgern Tag für Tag gesprochenen Idiome? Zur Zeit des „Ausgleichs“ mit Ungarn 1867 setzte sich die Sprache der Magyaren in der amtlichen Kommunikation als gleichberechtigte Sprache durch. Aber der Streit um den Gebrauch der anderen Sprachen war damit noch keineswegs gelöst. Er führte im Lauf der Jahre zu teils nationalistisch vergifteten Debatten, die, wie etwa die von dem österreichischen Ministerpräsidenten Kasimir Felix Graf Badeni erlassene Sprachenverordnung zum gleichberechtigten Status des Tschechischen in Böhmen 1897, den Zentrifugalkräften enormen Schub verliehen. In allen Staaten des Reichs hatte sich in den letzten Jahrzehnten ein teils aggressiver Nationalismus durchgesetzt, dessen Vertreter unentwegt nach Anlässen suchten, sich von Habsburg loszusagen. Dem allzu idealistischen und darum vielleicht schon ideologischen Begriff von der „Völkerfamilie“ setzten sie den nicht minder ideologischen vom „Völkerkerker“ entgegen. Dem Glauben an die Möglichkeiten eines transnationalen Verbundes antworteten sie mit dem unbedingten Bestehen auf dem Eigenen.
„Dieses Reich muss untergehn“, lässt der Schriftsteller Joseph Roth darum einen Protagonisten seines Romans Radetzkymarsch fürchten. „Ein Greis, dem Tode geweiht, von jedem Schnupfen gefährdet“, sitze auf dem Thron, und wenn er sterbe, sei es auch mit dem Reich vorbei. „Sobald unser Kaiser die Augen schließt, zerfallen wir in hundert Stücke. Der Balkan wird mächtiger sein als wir. Alle Völker werden ihre dreckigen, kleinen Staaten errichten, und sogar die Juden werden einen König in Palästina ausrufen. In Wien stinkt schon der Schweiß der Demokraten, ich kann’s auf der Ringstraße nicht mehr aushalten. Die Arbeiter haben rote Fahnen und wollen nicht mehr arbeiten. Der Bürgermeister von Wien ist ein frommer Hausmeister. Die Pfaffen gehn schon mit dem Volk, man predigt tschechisch in den Kirchen. Im Burgtheater spielt man jüdische Saustücke, und jede Woche wird ein ungarischer Klosettfabrikant Baron. Ich sag’ euch, meine Herren, wenn jetzt nicht geschossen wird, ist’s aus. Wir werden’s noch erleben!“16 Es ist offenbar: Die Mittelmäßigkeit, die Karl Kraus’ „Nörgler“ dem Reich attestiert, hat in Wojciech Chojnicki ihre Stimme gefunden. Es ist der antisemitisch grundierte Ton schneidender Arroganz, einer Selbstgewissheit, die sich nur darum so unbefangen artikuliert, weil sie die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat. Der imperiale Duktus, wie dieser Reichsrat-Abgeordnete ihn artikuliert, ist seinerseits von Nationalismus nicht frei, und noch weniger versteht er die sozialen Anliegen seiner Zeit. Es ist vor allem die Stimme eines Kriegstreibers. Nur Gewalt, ein gemeinsamer Feind kann das Reich noch einen. So düster und pessimistisch sieht es einer seiner – fiktionalen – Repräsentanten. Auch Roth selbst war ein Anhänger des Kaiserreichs. Nur äußerte er sich in ganz anderem Ton über dessen Vorzüge. „Ein grausamer Wille der Geschichte hat mein altes Vaterland, die österreichisch-ungarische Monarchie, zertrümmert“, schrieb er im Vorwort zu seinem Roman. Und weiter: „Ich habe es geliebt, dieses Vaterland, das mir erlaubte, ein Patriot und ein Weltbürger zugleich zu sein, ein Österreicher und ein Deutscher unter allen österreichischen Völkern.“
Mit seinem Bekenntnis umriss Roth wenn nicht das Ideal, so doch die politisch-juristische Praxis des Habsburgerreichs, die es zumindest sehr vielen Bürgern erlaubte, sich mit ihrem Staat zu identifizieren, ihn als jene Kraft zu erkennen, die sie über die Enge und vor allem die Zwänge ihrer unmittelbaren Umgebung heraushob. Nicht, dass die Habsburger sich dem heute so hoch gehandelten Ideal einer kosmopolitischen Existenz, eines Lebens jenseits nationaler oder gar lokaler Grenzen verschrieben hätten. Sie waren nüchterne Regenten, denen es um den Fortbestand, Stabilität und Sicherheit ihres Reiches ging. Aber die Instrumente, mit denen sie dies bewirkten, oder zumindest zu bewirken versuchten, funktionierten auf eine Art, die eben jenes Weltbürgertum schufen, oder zumindest schaffen konnten, das Joseph Roth so pries. Die Millionen Bürger, die bei Sándor Márai im Vertrauen auf das Wohlergehen des Kaisers ruhig schliefen, sie wussten – oder ahnten vielleicht auch nur –, wem und warum sie dieses Vertrauen schenkten. Es mochte weniger der Kaiser als Privatperson sein. Aber dafür war es der Herrscher als öffentliche Figur. Er stand für eine Macht, die ihnen seit langer Zeit – teils seit Jahrhunderten – ein ruhiges, geordnetes und planbares Leben beschert hatte, zumindest aber eines, das ohne die Macht in Wien durchaus schlechter hätte verlaufen können. So fühlten sehr viele sich dem Kaiser verbunden – und fanden dadurch zumindest im Kern zu jenem Weltbürgertum, das Joseph Roth nach dem Zusammenbruch des Reiches so sehr vermisste.