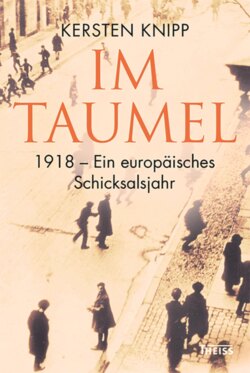Читать книгу Im Taumel - Kersten Knipp - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Letzte Kriegstage Der 11. November 1918 und die Folgen
ОглавлениеDas ist kein Frieden. Es ist ein Waffenstillstand auf zwanzig Jahre.
Marschall Ferdinand Foch über den Vertrag von Versailles (1919)
Was war da eigentlich passiert? Über Jahre hatten sich Europäer in feuchte Gräben geduckt, waren durch den Schlamm gekrochen, hatten meterweise Boden gewonnen und wieder verloren, sich vor und wieder zurück bewegt in nie endendem Prozess, ermüdend, mühsam, tödlich. Millionen junger Männer feuerten in Richtung des Feindes, wurden ihrerseits getroffen. Über Jahre ging das so, ein Leben unter Donner, Blitz, dem Druck der Artillerie. Der Krieg forderte einen Tribut, wie man ihn sich bislang nicht hatte vorstellen können. Fast 56 Millionen Rekruten waren zum Krieg eingezogen worden,1 zwischen 8,6 bis 11 Millionen kamen ums Leben – geht man von den vorsichtigen Schätzungen aus, kommt man auf rund 6000 gefallene Soldaten an jedem einzelnen der insgesamt 1569 Kriegstage,2 über 21 Millionen Soldaten wurden verletzt. Der Krieg schonte auch die Zivilbevölkerung nicht: Rund 6,5 Millionen Unbeteiligte – Frauen, Kinder, Alte – fanden in den vier Jahren ebenfalls den Tod. Hinzu kamen die Vermissten. Allein in den Reihen des Habsburgerreiches verlor sich die Spur von 2,2 Millionen Soldaten im Ungewissen, auf russischer Seite waren es 2,5 Millionen Wehrpflichtige. Kaum weniger furchtbar war das Schicksal jener, die verstümmelt und mit schwersten Verletzungen aus dem Krieg zurückkamen: Menschen, die ihre Gliedmaßen – Arme und Beine – ganz oder in Teilen verloren hatten, die gelähmt oder bettlägerig waren, die Amputationen hatten hinnehmen müssen, die erblindet oder taub geworden waren. Allein in Deutschland zählte man 4,2 Millionen (Schwerst-)Verwundete, in Österreich-Ungarn 3,6 Millionen. Die meisten, nämlich 4,9 Millionen Versehrte, registriert man jedoch in Russland. Dessen ehemalige Verbündete, Frankreich und Großbritannien, hatten sich um fast 5 Millionen Versehrte zu kümmern.
Was also war passiert? „Wie auf antiken Steinreliefs,/Die verbissene Schlachten zeigen/in grob gemeißeltem Körpergemenge,/mit verbogenen Rümpfen, Armen und Dolchen/Und bei verzweifeltem Schildergedränge/und voller Grimm auf verzerrten Gesichtern“: So seien die Menschen aufeinander losgegangen, beschreibt nach Kriegsende der polnische Autor Joseph Wittlin in seinem Gedicht An den Gegner die Kämpfe der letzten Jahre.3 Sie erschienen ihm als aus der Zeit gefallenes Morden, angetrieben durch die „Herolde auf den Zinken“, die zu Schlachten blasen, wie man sie vielleicht aus den Legenden der Antike kannte, für das eigene Jahrhundert aber für ausgeschlossen hielt.
Die Szenen dieses antik anmutenden Kampfes waren auf eine Weise dynamisiert worden, wie es nur eine hoch entwickelte Technik vermochte. Techniker und Ingenieure hatte ganze Arbeit geleistet: Ihre gesamte Kompetenz hatten sie auf diese Schlachten verwandt. In ihren Schmieden waren nie gesehene Waffen entstanden: unzerstörbar scheinende Panzer; unterhalb der Wasseroberfläche manövrierende Boote; dazu Geschosse, deren Größe und Reichweite jede bisherige Vorstellung übertraf. Das Standardgewehr des deutschen Heeres, die Mauser 98, garantierte noch auf eine Distanz von 1500 Metern einen präzisen Schuss, während das in der französischen Armee eingesetzte Gewehr, die Lebel 07/15, sogar auf eine Entfernung bis zu 2000 Meter ihr Ziel erreichte.4 Noch weiter reichten die Maschinengewehre. Das 1915 eingesetzte Modell Maxim 08 kam in immer neuen, immer besseren Varianten zum Einsatz. Bereits die Version von 1915 reichte bis zu 4000 Meter weit, wenn die Ingenieure seine Zielgenauigkeit auch nur bis zu einer Distanz von 2500 Metern garantieren konnten. Noch viel gefährlicher waren die Geschütze. Die kleineren, von einem Kaliber bis zu 8,4 Zentimeter, flogen bis zu acht Kilometer, die größeren, mit einem Rohrdurchmesser bis zu 15 Zentimeter, schleuderten ihre Geschosse bis zu 16,5 Kilometer weit. Die ab 1910 entwickelten Mörsergeschütze, mit einem Kaliber von bis zu 21,1 Zentimeter, flogen bis zu zehn Kilometer, waren aber auf eine andere Wirkung angelegt: Sie sollten keine definierten Objekte, sondern vor allem größere Flächen treffen. Wer sich im Umfeld ihres Aufschlags aufhielt, wurde auseinandergerissen. Ab 1916 setzten die Deutschen den „Langen Max“ ein, dessen 300 Kilogramm schwere Geschütze durch ein 35 Meter langes Kanonenrohr geschleudert wurden und dann bis zu 128 Kilometer flogen. Mit dieser Waffe hatten die Deutschen im letzten Kriegsjahr, am 23. März 1918, Paris beschossen. Einige Granaten trafen die Kirche Saint-Gervais, wo gerade ein Gottesdienst stattfand. 88 Menschen wurden getötet, rund 100 verletzt.5
Stellungskrieg an der Westfront: 1915 posierten deutsche Soldaten in einer gestürmten französischen Stellung.
Joseph Wittlin hatte recht, wenn er den Krieg in den Worten eines antiken Verhängnisses beschrieb. „Zwei Riesenarmeen prallen zusammen/Wie auf antiken Steinreliefs,/Wurfspieße klirren an Helme,/Vom Schwert Getroffene jammern,/Zerhackte Körper knäuln sich in Krämpfen“. Die Wurfspieße freilich waren die ihrer Zeit. Sie wurden nicht von Menschenhand geschleudert, sondern zuckten aus den Mündern moderner Kanonen. „Es ist furchtbar, wenn Granatsplitter mit dieser Gewalt in Weichteile hineingehen“, erinnert sich etwa der deutsche Soldat Karl Bainier, Jahrgang 1898. „Unsere zwei Befehlsläufer haben nachts auch einen Volltreffer gekriegt. Die ganze Brust, der andere der ganze Leib weg. Der mit dem Leib war sofort tot. Der andere hat noch geschrien.“6 Er und seine Truppe hätten Schutz in einem schräg in die Erde gegrabenen Stollen gesucht, berichtet Johannes Götzmann, Jahrgang 1894. „Wir saßen unten, als die Garage getroffen wurde. Es gab ziemlich viele Verwundete. Einer hatte keine Beine mehr. Beide Beine waren ab. Er ist dort verblutet. Neben mir saß ein Kamerad, der war an dem Tag gerade 20 Jahre alt geworden. Er hatte etwas gegen den Kopf bekommen, wahrscheinlich einen Splitter, und war blind. Er jammerte: ‚Ich kann nicht gucken, ich kann nicht gucken.‘ Er hat geweint, der Kerl. Ich musste ihn trösten.“
In diesem Krieg wurden nicht allein die Menschen vernichtet. Auch über die Natur rollte die Gewalt und verwandelte sie in eine gespenstische Nicht-Landschaft. „Von ganzen Wäldern waren nur noch mannshohe Stümpfe übrig geblieben, die zum Teil in Sperrbauten einbezogen wurden“,7 erinnert sich Hans Seidelmann, Jahrgang 1898, an die Kämpfe am Chemin-des-Dames in Nordfrankreich.
„Schon einige Kilometer hinter der Front hörte man ein dauerndes Rummeln der Artillerie, Tag und Nacht“, so erinnert der Rekrut Paul Grünig, Jahrgang 1897, die Reise in Richtung Front.8 Nach nächtlichem Marsch verschafft er sich bei Tagesanbruch einen ersten Eindruck von der Szenerie. „Am anderen Morgen habe ich beim Aufwachen das Trümmerfeld vor mir gesehen und erkannt, was der Somme-Krieg bedeutete. Was da alles vor einem lag! Verendete Pferde, eine kaputte Feldküche. Es muss vor unserem Eintreffen ein schweres Artillerie-Gefecht gegeben haben, denn wie wir kamen, war es ruhig. Es war alles zerstört.“ Wie groß die Schäden waren, ließ sich in vollem Umfang erst nach Ende des Krieges erfassen. Allein in Nordfrankreich und Belgien waren 25.000 Quadratkilometer land- und forstwirtschaftlicher Nutzfläche zerstört. 1,3 Millionen Kopf Vieh waren getötet worden oder verloren gegangen, über 250.000 Gebäude standen nicht mehr.9
Joseph Wittlin hatte Glück: Der Dichter, 1896 auf dem Landgut Dmytrów, nordöstlich von Lemberg, geboren, hatte den Krieg nicht direkt an der Front erleben müssen.10 Zwar hatte er, der Bürger des zum Habsburgerreich zählenden Königreichs Galizien und Lodomerien sich bei Kriegsbeginn freiwillig zum Dienst gemeldet. Doch die Legion Wschodni, zu der er gehörte, löste sich bald wieder auf: Ein Teil der Rekruten hatte sich geweigert, den Treueid auf den österreichischen Kaiser zu leisten. Nachdem das russische Heer bereits im August 1914 auf Galizien vorrückte und die Region besetzte, floh Wittlin nach Wien. Dort meldete er sich, da er nicht als Drückeberger gelten wollte, ein zweites Mal zum Kriegsdienst. Doch kurz bevor er eingezogen wurde, erkrankte er an Scharlach. Lange Zeit verbrachte er in Lazaretten und Erholungsheimen – so lange, dass er schließlich nicht mehr eingezogen wurde.
Trotzdem war der Krieg auch für Wittlin immer präsent. Vor allem eine Frage stellte er sich: Wofür das Ganze? Eine konkrete Antwort gibt er in seinem Gedicht nicht. Er deutet aber an, wie es möglich war, so viele Menschen über vier Jahre davon zu überzeugen, dass das Kämpfen auch einen Sinn hat. Die Soldaten, merkt er an, kämpften im Namen von etwas angeblich Höherem: „Verschiedenste Wappen auf unseren Schildern/Bedeuten verschiedene Idole“. Diese Idole liefern den Soldaten den psychologischen Grundstoff, um sich in die martialischen Gewitter zu stürzen und in ihnen auszuharren. Gewiss: Die wichtigsten Instrumente, die Soldaten an der Front zu halten, waren Zwang und Überwachung. Wer desertierte, musste mit der Todesstrafe rechnen. Aber auch die Propaganda spielte in diesem Krieg eine bedeutende Rolle. Allerdings verliert auch die entschiedenste ideologische Mobilisierung irgendwann an Überzeugungskraft. Am Abend, heißt es in dem Gedicht, gehen die Soldaten in ihre Zelte zum Schlafen. „Wir gehen nachdenklich, leise, in Trauer/Ob dieser grässlichen Fratze des Kampfes,/Den wir das ganze Leben wohl führen/Um irgendeine heilige Sache“.11
Nicht „die“ heilige Sache. Sondern „irgendeine“. Deutlicher und zugleich lakonischer konnte Wittlin seine Distanz zu den Gründen dieses Krieges kaum ausdrücken. Was war der Krieg, wenn nicht eine einzige ideologische Verwirrung?