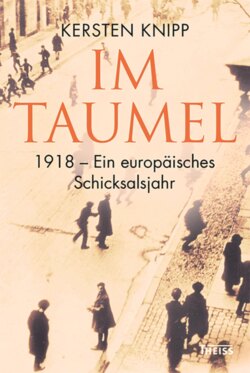Читать книгу Im Taumel - Kersten Knipp - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
„Die Sprache ihres Souveräns“
ОглавлениеWirtschaft erfordert Kommunikation. Ebenso ist eine funktionierende Staatsverwaltung auf reibungslose Verständigung angewiesen. Wie diese in einem so großen, so vielsprachigen Reich zu gewährleisten sei, hatte die Habsburger seit jeher beschäftigt. Eines guten Dutzends Sprachen bedienten sich ihre Bürger, dazu zahlreicher Dialekte und Unterdialekte. Verstanden sich die Bewohner der unterschiedlichen Reichsteile untereinander? Nein. Und nicht einmal die in den Reichstag entsandten Repräsentanten der einzelnen Länder wussten, wovon ihre jeweiligen Kollegen aus anderen Regionen sprachen. Das Parlament hatte keinen Übersetzungsdienst, und die Abgeordneten konnten sich jeder beliebigen Sprache bedienen. Dort herrschte ein linguistisches Durcheinander ohnegleichen. Im Vertrauen darauf, dass ihre Kollegen aus anderen Landesteilen sie ohnehin nicht verstehen würden, konnten Abgeordnete die abstrusesten Dinge äußern. Im Zweifel, so ein häufig zu hörender Scherz, könnten sie durchaus auch Lyrik vortragen – es würde ohnehin niemand bemerken. Das müsse sich ändern, erklärte darum Joseph II. im Jahr 1784 und erließ ein Gesetz, das das Deutsche auch in Ungarn und Siebenbürgen zur Amtssprache erklärte. Dem „allgemeinen Beßten“, erklärte er, wüchsen viele Vorteile zu, „wenn nur eine einzige Sprache in der ganzen Monarchie gebraucht wird, und wenn in dieser allein die Geschäfte besorgt werden, daß dadurch alle Theile der Monarchie fester untereinander verbunden, und die Einwohner durch ein stärkeres Band der Bruderliebe zusammengezogen werden.“27 Diese eine Sprache, so viel stand fest, könnte nur das Deutsche sein. Es war die Sprache des Hofes, der Regierung und der größten Teile der Verwaltung. In Zeiten, in denen die Bedeutung des Lateinischen als Lingua franca zurückging, konnte nur Deutsch an dessen Stelle treten. Und so erließ er im folgenden Jahr ein Gesetz, das Deutsch auch in Galizien zur Gerichtssprache erhob. Vom Jahr 1787 an galt das Gleiche auch für das östliche Trentino. Für Bewerber für den juristischen Dienst hatte das potenziell einschneidende Folgen: Sie mussten nachweisen, dass sie das Deutsche ausreichend beherrschten, um in der Gerichtsverwaltung arbeiten zu können. Um welchen Einsatz es ging, lässt etwa eine Äußerung des Vizekanzlers der böhmischen Hofkanzlei, Tobias Philipp Freiherr von Gebier, erkennen. Von Bewerbern für ein Studium an den Hochschulen Böhmens, erklärte er, sei zu verlangen, dass sie Deutsch lernten. Denn das, befand er, sei „die Sprache ihres Souveräns … und der Armee … Ein Subjectum, das nur böhmisch und lateinisch kann, wird ein schlechter Gelehrter und für den Staat ganz unbrauchbar werden, und es ist besser, dass solches bei dem Pflug oder einem gemeinen Handwerk bleibe.“28
Deutsch, die Leitsprache des Reiches. Nicht allerdings seine Kultursprache, zumindest nicht seine ausschließliche. Die Sprachpolitik im späten 18. Jahrhundert hatte nur ein Ziel: eine möglichst effektive, rasche und präzise Kommunikation. Die Beamten des Riesenreichs mussten sich verständigen können – nicht mehr und nicht weniger war der Anspruch, den Joseph II. an sich und seine Beamten stellte.
Langfristig hatte das einen erheblichen Mentalitätswandel der Beamtenschaft zur Folge: Die straffen, nicht nur sprachlich immer höheren Anforderungen an die angehenden Staatsdiener sorgten dafür, dass diese sich immer weniger mit ihrer Herkunftsprovinz, dem Sprengel oder Landstrich der frühen Jahre, identifizierten, sondern mit dem Staat, dem alle ethnischen, sprachlichen und ideologischen Differenzen transzendierenden Dienst für das Reich. Für den Vielvölkerstaat, den eine effektive und neutrale Verwaltung überhaupt erst zusammenhielt.
Entsprechend fremd war ihnen darum auch die Vorstellung, das Deutsche sei den anderen Sprachen in irgendeiner Form überlegen. Gewiss, das Deutsche war systematisch reguliert und normiert worden, über Jahrhunderte hatten Grammatiker an seiner Kodifizierung gearbeitet. So war eine leistungsfähige, den hohen Anforderungen der Reichsverwaltung entsprechende Sprache entstanden. Aber das bedeutete nicht, dass alle anderen Sprachen dem Deutschen gegenüber verächtlich seien. Allerdings machte das Deutsche den Bürgern aus den anderssprachigen Landesteilen ein Angebot: Es präsentierte sich als Brückensprache, über die sie, wenn sie wollten, an die politischen und wissenschaftlichen Standards der Zeit anschließen konnten. „Sie (die Nicht-Deutschen) können ihre Nationalität erhalten und ihre Sprache pflegen“, erklärte Ministerpräsident Karl Ritter von Stremayr noch 1876 im österreichischen Parlament. „Dennoch müssen sie anerkennen, dass diese Pflege sich gegen ihre eigene Nation richten würde, die die Tschechen um die Möglichkeit bringen würde, sich zu einer Position zu erheben, in der sie durch den Gebrauch der Deutschen Sprache an den großen Reichsangelegenheiten teilnehmen könnten.“29
Als Stremayr seine linguistische Verheißung äußerte, ahnten er und viele andere Politiker des Reiches bereits, wie heikel die Sprachenfrage einmal werden könnte. Sprache, war ihnen klar, ist mehr als nur ein Instrument der Kommunikation. Sie ist auch Identität, gibt ihren Nutzern das beruhigende Gefühl, zu Hause und bei sich selbst zu sein. Sprache schenkt Identität und steht darum zu ihren Sprechern in einem intimen Verhältnis. Sie ist Ausdruck des Innersten des Menschen, das seinerseits durch Geschichte und Gegenwart, die nahe und die ferne Umgebung geprägt ist. All dies wusste man im Königshaus und in den ihm verbundenen Institutionen. Darum begrüßte man in Wien die Veröffentlichung von Werken zur Förderung auch der anderen Reichssprachen. So erschienen bis zum Jahr 1790 Grammatiken des Kroatischen, Polnischen, Slowenischen, Serbischen, Rumänischen und Slowakischen. Bereits 1778 war Tschechisch Unterrichtsfach adeliger Stifte in Wien und Brünn. 1783 übersetzte man Schulbücher für den Unterricht in der Bukowina aus dem Deutschen ins Polnische und Rumänische, die dann in großer Zahl kostenlos an die dortigen Schüler verteilt wurden.30 Die generöse Sprachenpolitik trug Früchte: Lange Zeit lebten die Bürger des Reiches ganz selbstverständlich mit und in ihren Sprachen. Sie war Ausdruck einer unkomplizierten, weil nicht gebrochenen oder infrage gestellten Identität. Sprache, das war das Naheliegende, das Unzweifelhafte und täglich Gebrauchte. „Unterrichtssprache“, erinnerte sich der in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts auf dem Gebiet des heutigen Sloweniens aufgewachsene Josip Vosnaj, „war das Deutsche, aber mit den Bauernkindern, die nur Slowenisch redeten, sprach der Lehrer auch Slowenisch … In unserem Haus haben wir gewöhnlich untereinander Deutsch gesprochen, aber wir haben auch Slowenisch gekonnt. Gefühlt haben wir uns weder als Deutsche noch als Slowenen, wie sich überhaupt um die Nationalität bis zum Jahre 1848 niemand gekümmert hat, und uns die Sprache nur als Mittel zur Verständigung untereinander und mit anderen diente.“31
Vosnaj deutet es an: Irgendwann, spätestens im Revolutionsjahr 1848, wurde die Sprache problematisch. Schritt für Schritt wandelte sie sich von einem Symbol der kulturellen zu einem der politischen Identität. Angedeutet hatte sich diese Entwicklung bereits im ausgehenden 18. Jahrhundert. Nach dem Tod Josephs II. 1790 forderte etwa der ungarische Landtag, auch das Ungarische als Verwaltungssprache anzuerkennen. Damit schlug er einen Ton an, der sich in den folgenden Jahren und Jahrzehnten in sämtlichen nationalistischen Zirkeln immer deutlicher vernehmen ließ. Immer stärker wurde Sprache fortan herangezogen, um den Impulsen aus Wien die der nationalen Hauptstädte entgegenzusetzen. Mehr und mehr wurde Sprache zu einem Instrument und zugleich Symbol der politischen Autonomiebestrebungen.
Diese wurden ihrerseits durch die technischen Innovationen der Zeit angeregt: Ab 1818 durchpflügen Dampfschiffe die Adria, 13 Jahre später kreuzen sie auf der Donau. Diese wird bald mit der Moldau und anschließend der Elbe verbunden: Ein Verkehrsnetz entsteht, auf dem fortan die wachsende Menge der Wirtschaftsgüter verladen wird. Auch das Eisenbahnnetz wird zügig erweitert. Der ungarische Dichter Sándor Petőfi ist begeistert von dem neuen Verkehrsmittel, dessen globale Bedeutung er spontan erkennt: „Bedeckt die Welt mit Schienen/wie die Erde mit Adern durchzogen ist“, schrieb er anlässlich der Eröffnung des ersten, 40 Kilometer langen Schienenstranges in Ungarn in den 1840er-Jahren. „Sie sind die Adern der Erde/durch deren Taille die Zivilisation nach vorne drängt.“32 Petőfi ahnt es: Mit der Eisenbahn kommt mehr als nur der Warenverkehr ins Rollen. Die Zivilisation selbst dringt auf den Waggons ins Land, und das heißt: Die politischen Diskurse der Moderne sind aus ihm nun nicht mehr wegzudenken.
Zugleich bringt auch die Industrie selbst die gewohnten Rhythmen aus dem Takt. Ausländische Ingenieure und Investoren setzen die bisherigen Produktionsweisen unter Druck. 1769 hatte Kommerzienrat Karl Graf Zinzendorf von Manchester, dem Zentrum des englischen Frühkapitalismus, geschwärmt, ab 1820 helfen britische Maschinenbauer, wie Edward und John Thomas, Thomas Bracegirdle und David Evans, die ersten Industrieanlagen im Reich, vor allem in Böhmen, aufzubauen. Eisenwerke, Dampfschiffkompanien, die Textilindustrie, zudem auch erste Sparkassen: Die Briten setzen wesentliche finanzielle, vor allem aber technische Impulse, um den Zukunftsindustrien ihrer Zeit den entscheidenden Schubs zu geben. Die Länder der Kronen sollen dem Deutschen Zollverein beitreten, fordert die Regierung, doch die einzelnen Länder weigern sich: Auf protektionistischen Schutz wollen sie vorerst nicht verzichten, der Wind aus Richtung der Konkurrenten weht bereits allzu rau. Das hindert nicht, dass die Industrialisierung voranschreitet: Erste Hochöfen, Zuckerraffinerien, Papierfabriken entstehen, ganz allgemein wächst die Wirtschaft. Besonders die Textilindustrie boomt. Allein zwischen 1780 und 1798 verdoppelt sich die Zahl der dort Beschäftigten in Böhmen, Mähren und Tschechisch-Schlesien auf 700.000 Menschen.33 Eines der Zentren ist Brünn. Allein dort arbeiten um 1840 in den entsprechenden Betrieben bereits 15.000 Menschen. Aufmerksam beobachtete der Journalist Jan Ohéral den Wandel der Stadt. „Die Ansicht von Brünn hat sich in wenigen Jahren ganz verändert“, notiert er 1838. Die Stille früherer Zeiten ist dem Lärm der Moderne gewichen, die Beschaulichkeit von einst ist ersetzt durch entschlossene Geschäftigkeit. Der Charakter der gesamten Stadt verändere sich: „Eine neue Macht, eine neue Beschäftigungsweise hat in kurzer Zeit ihre Farbe diesem Gemälde geliehen und mit fester Hand einen Charakter ausgeprägt, der uns aus dem stillen, träumerischen Frieden in das Getöse der Werkstätte versetzt; sie hat sich die Vorstädte zum Kampfplatze ausersehen, und hier die hohen Paläste gebaut mit den monumentenähnlichen Schornsteinen, die vom Boden aufwärts wie erstarrte Riesenfinger in die Luft zeigen und mit ihren dunklen Rauchwolken die alte vielgethürmte Stadt verhüllen.“34 Die neuen Produktionsformen setzen den alten Gilden und Zünften zu, die sich gegen die Produktivität der modernen Anlagen immer weniger behaupten können – darin den Arbeitern gleich, deren Kraft in den Werkstätten und Manufakturen alten Stils immer weniger Verwendung findet. 1816 treten die Wiener Arbeiter erstmals in den Aufstand, 1831 machen sich ihre Kollegen in Brünn durch Streiks bemerkbar.