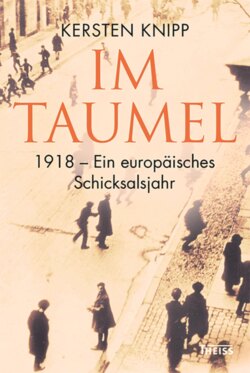Читать книгу Im Taumel - Kersten Knipp - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Strohdach des Bauern
ОглавлениеUm aber politische Zugkraft zu entwickeln, kommen die entstehenden Nationalbewegungen um eines nicht herum: Sie müssen nachweisen, dass sie tatsächlich historisch gewachsene Nationen vertreten, die auf eigene Traditionen und möglichst auch gewachsene kulturelle Bestände verweisen können. Eben dies, die zunächst kulturelle und in ihrer Folge dann auch politische Selbstvergewisserung, ist das große Thema der in jenen Zeiten entstehenden literarischen, künstlerischen und sprachwissenschaftlichen Bewegungen in allen Ländern des Reiches. Anfänglich noch klassisch romantisch gestimmt, befassen sie sich zunächst mit den naheliegenden Sujets des kulturellen Nationalismus: den Schönheiten der Landschaft und den Eigenheiten jener, die in ihnen leben. „Lasst uns Informationen über unser Volk in den Heimatgefilden unserer Vorfahren suchen“, fordert der polnische Ethnologe Zorian Dołęga Chodakowski die philologisch bewegten Köpfe seiner Zeit auf. Sie sollten zu entlegenen Orten gehen und unter das Strohdach des Bauern treten. „Wir müssen auf seinen Festen zugegen sein, seinen Vergnügungen und den Ereignissen seines Lebens.“40
Der Bauer: So schlecht er in der Realität leben mochte, so innig wurde er in der Fiktion umhegt. Der Ackersmann avancierte zu einem zentralen Protagonisten der romantischen Fantasie, wurde Inbegriff der authentischen, ganz in sich selbst ruhenden Existenz, noch unberührt von aller Entfremdung, der Nervosität des aus dem Takt geratenen Lebens. Auf geheimnisvolle Weise – wie genau, weiß niemand – hat der Bauer die Traditionen des Volkes bewahrt, seine Dichtung, seine Weltanschauung, wenn nicht sogar sein reines, unverfälschtes, dem romantischen Mythos so teure Sein. Darum muss man sich unter sein Dach begeben, ihm auf die Felder, in die Kirche, zum Dorffest folgen. Denn dort, auf dem Land, ist das Volk noch ganz es selbst, dort zeigt es sich in seiner ganzen unverformten Schönheit, seiner Würde und Authentizität. So jedenfalls wollte es die damalige kulturelle Programmatik.
Immer wieder beugen sich die Romantiker darum über die Tiefen der Zeit, versuchen die Schätze herauszufischen, die sie in den Furchen der Vergangenheit zu finden glauben, jene Weisen, Klänge und Reime aus längst vergangenen Jahren. Einer derer, die zurückschauen, war auch der tschechische Sprachwissenschaftler Václav Hanka. Er habe, berichtete er 1817, ein uraltes Manuskript entdeckt, die sogenannte Königinhofer Handschrift – eine mittelalterliche Liedersammlung mit insgesamt 14 Gedichten und Gedichtfragmenten in alttschechischer Sprache. Schon optisch war der Fund eindrucksvoll: sieben vergilbte Pergament-Doppelblätter, beidseitig mit kleiner, zierlicher Schrift beschrieben. Zwei der Blätter waren blank und auf etwa drei Viertel der normalen Seitenhöhe abgeschnitten – ein Werk, so legte der Augenschein es nahe, das nicht immer die ihm gebührende Behandlung erfahren, sich trotzdem aber durch den Lauf der Zeiten bis in die Gegenwart gerettet hatte. Das erste Gedicht, ließ Hanka sein Publikum wissen, schildere die Vertreibung der Polen aus Prag im Jahr 1004, das zweite die Niederlage sächsischer Truppen und das dritte den militärischen Triumph des böhmisch-mährischen Heers unter seinem Führer Jaroslaw über die Tataren in der Schlacht von Olmütz im Jahr 1241. Auch den Inhalt der anderen Gedichte enthielt Hanka seinen Lesern nicht vor. Im folgenden Jahr, 1818, stellte er ein weiteres mittelalterliches Dokument, die Grünberger Handschrift vor, gefunden, so Hanka, auf Schloss Grünberg nördlich des Örtchens Nepomuk und darum nach diesem benannt. Auch die beiden nur grob verarbeiteten Doppelseiten dieses Dokuments wiesen Schäden auf. Der Text mit seinen rot hervorgehobenen Initialen verwirrte zudem durch kleine rote Sonderzeichen, deren Sinn Rätsel aufgab. Dennoch waren die beiden Gedichte der Handschrift, Sněmy („Der Landtag“) und Libušin soud („Das Gericht der Libussa“), gut lesbar. Das war erfreulich, verwiesen die Gedichte doch auf die altehrwürdige Institutionengeschichte der Tschechen – und damit implizit, so nahmen Hanka und seine Leser an, auch auf ihre kulturelle Gleichwertigkeit, wenn nicht Überlegenheit gegenüber den deutschen Nachbarn. Es schienen bedeutsame philologische, kultur- und politgeschichtliche Funde, die Hanka der Öffentlichkeit präsentierte. Sie hatten nur einen einzigen Makel: Sie waren gefälscht, mutmaßlich von Hanka selbst. Vermutet hatte man es schon bald nach ihrer Veröffentlichung, auch wenn man es vorerst nicht beweisen konnte. Und so taten die Handschriften ihren patriotischen Dienst, verliehen der tschechischen Kultur und Geschichte jenen Nobilitätsnachweis, dessen die Patrioten des Landes so sehr bedurften. Denn darauf, auf Würde und Identität durch Rekurs auf die Geschichte, kam es an. Da durfte der Umstand, dass diese Geschichte in Teilen frisiert war, einfach keine Rolle spielen.
Ohnehin dauerte es, bis die Fälschung zweifelsfrei erwiesen war. Erst in den späten 1850er-Jahren verdichteten sich die Vorbehalte. 1859 legte der österreichische Historiker Max Büdinger stichhaltige Beweise vor, dass die Texte nicht echt seien, doch konnten diese sich gegen den Willen zur Geschichtsklitterung nicht durchsetzen. Ebenso wenig gelang der Nachweis dem Prager Historiker Jaroslav Goll und seinem Kollegen, dem Philosophen und späteren Präsidenten der Republik, Tomáš Garrigue Masaryk. Den endgültigen Nachweis lieferte schließlich eine Untersuchung aus dem Jahr 1967 – die allerdings erst in den 1990er-Jahren veröffentlicht wurde.
So konnten sich die tschechischen Nationalisten über Jahrzehnte auch auf diese beiden Handschriften berufen. Die waren freilich nicht die einzigen Dokumente, auf die sie sich stützten. Auch andere Autoren und Intellektuelle arbeiteten der böhmischen Sache zu. Der Linguist Josef Jungmann übersetzte Werke Goethes, Chateaubriands und Miltons ins Tschechische, um so den Nachweis von der Modernität des Tschechischen zu führen. Wo dieses dann doch keine eigenen Entsprechungen aufbieten konnte, half der sprachschöpferische Philologe mit Neologismen aus. Auch eine böhmische Literaturgeschichte und ein Lehrbuch der Stilistik legte Jungmann vor. „Es tritt“, versicherte er an anderer Stelle, „ein edleres böhmisches Geschlecht auf, wohlgeratene Söhne des Vaterlandes, welche die pflichtgemäße Liebe zu ihrer Mutter in ihrer Brust fühlen. Diese werden dort, wo ihr aufgehört habet, die böhmische Kunst wieder aufnehmen und ihr einst berühmtes Vaterland der sprichwörtlichen Verachtung der Nachbarvölker entreißen.“41