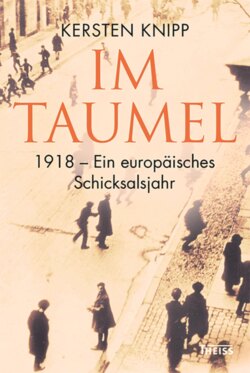Читать книгу Im Taumel - Kersten Knipp - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
„Dem Vaterland geweiht“
ОглавлениеSanft keimten hinter den Worten des Philologen erste Ansätze eines tschechischen Nationalismus auf. Sie übernahm Jungmanns Schüler František Palacký, Verfasser einer tschechischen Nationalgeschichte. Diese ließ er bereits im Jahr 1527 enden – jenem Zeitpunkt, zu dem die Habsburger gerade die Königswürde in Böhmen ergriffen hatten. „Mein Leben und mein Geist sei dem Vaterlande geweiht“, nahm Palacký sich in patriotischem Eifer selbst in die Pflicht. „Und wenn es mir auch verwehrt ist, für das Wohl von Volk und Vaterland das Schwert zu führen, so ist es doch nicht verwehrt, für unseren Ruhm und unsere Selbständigkeit zu eifern, es ist nicht verwehrt, Gut und Leben zur Erreichung dieser lobwürdigen Ziele zu wagen.“42
Tatsächlich, das Schwert hatte ausgedient. Umso entschiedener griffen die tschechischen Nationalisten zur Feder. Karel Hynek Mácha etwa. Der von Byron und Scott beeinflusste Dichter, 1810 geboren, besucht 129 alte tschechische Burgen und Schlösser, denen er die Geheimnisse der Vergangenheit abzulauschen versucht. Sein Landsmann, der Maler Julius Mařák, durchstreift derweil die Felder und Wälder der Heimat, die Ebenen und die Täler, immer der romantisch verdichteten Aura der Natur hinterher. Bilder und Zeilen sollen den Tschechen helfen, sich eine Vorstellung ihrer selbst zu schaffen.
Überall im Habsburgerreich waren in jenen Jahren die Philologen, Dichter, Künstler unterwegs. Der kroatische Dichter und Journalist Ljudevit Gaj entwirft eine auf dem süddalmatinischen Dialekt beruhende gemeinsame Schriftsprache der südserbischen Nationalitäten, darin dem Programm der „Illyrischen Bewegung“ folgend, die die Identität der Südslawen auf das antike Volk der Illyrer gründete und die Vereinigung der von den Habsburgern und Osmanen beherrschten Südslawen anstrebt. „Der allgemeine Wunsch unseres ganzen dalmatinischen Volkes geht nach dem Zusammenschluss in einem Bund brüderlicher Liebe und vollendeter Gleichberechtigung, und in voller Freiheit, mit unseren kroatischen und slawonischen Brüdern, die eins sind mit uns in Stamm und Blut“, umreißt Gaj die Sehnsüchte seiner Landsleute.43 Ähnlich sahen es auch die Serben. Diese benutzten zwar ein anderes Alphabet. Doch müssten sie auch die lateinische Schrift respektieren, forderte der spätere Innen- und Premierminister Ilija Garašanin seine Landsleute auf. Schon den Kindern solle man beibringen, „dass Serben und Kroaten ein und dasselbe Volk sind und dass sie dieselbe Sprache sprechen und lediglich mit zwei Schriften schreiben“.44
Auch in Ungarn regten sich patriotische Gefühle. Der Dichter Mihály Vörösmarty, geboren 1800, rief den legendären Árpád, den Führer der Magyaren und Gründer der nach ihm benannten Dynastie, an. Ohne Scheu vor lyrischem Pathos evozierte er „den edlen Kommandanten, gekleidet in ein Leopardenfell und stark genug, um die Nation zu führen.“ Wortreich schildert Vörösmarty die Heldentaten des Führers – um dann auf die Magyaren der Gegenwart zu kommen, ihre Schwäche und Machtlosigkeit, die von der Größe vergangener Zeiten kaum mehr etwas ahnen lasse: „Wo bist du, alter Ruhm? Verloren tief in der Nacht der Schatten? Wo bist du Árpád, in dieser ohnmächtigen Zeit?“ So kann es nicht weitergehen, gibt sich Vörösmarty überzeugt und träumt in seinem Gedicht Szosát – „Appell“ – von einer neuen, einer „in Blut gewaschenen“ Nation. „Rund um die Gräber, an denen wir sterben werden/wird eine schluchzende Welt sich einfinden“.45
So dramatisch sie sich in der Fiktion äußerten, so planvoll gehen die Nationalisten in der Wirklichkeit vor. Seit Längerem schon dachten sie daran, den vaterländischen Versen auch eigene Bühnen zu bieten. Den Ungarn war klar, dass es ohne ein Theater im Grunde nicht gehe. „Jede kultivierte europäische Nation“ habe ein solches Theater, erklärt der Schriftsteller Ferenc Kölcsey. Wenn Ungarn nicht wünsche, aus den Reihen der angesehenen Nationen ausgeschlossen zu werden, dann müsse man ebenfalls ein Theater bauen – „und zwar unter Beteiligung der Nation“.46 So griffen die Ungarn in ihre Taschen, und schon 1840 konnten sie die Eröffnung des Baus feiern – mit einem der Bedeutung des Ereignisses angemessenen Stück: Aufgeführt wurde nämlich Árpáds Erwachen, Vörösmartys Drama über den magyiarischen Nationalheld.
Begeistert sprachen auch die Tschechen von der Idee eines „vlastenské divadlo“, einem „patriotischen Theater“. Die Idee reifte heran, und zu Beginn der 1850er-Jahre baten Initiatoren um den Dichter Karel Havlíček Borovský zur Kollekte: Der Bau setzte gewaltige Summen voraus, und die bekam nur die Nation als Ganze zusammen. 1856 war genug Geld vorhanden, um ein Grundstück am Ufer der Moldau zu erwerben, acht Jahre später begannen die Bauarbeiten. „Wir alle“, schrieb der Autor Jan Neruda, „haben dieselbe Arbeit und verfolgen denselben Zweck, dem Volk ein nationales sowie allgemein menschliches Bewusstsein, eine feste ethische Grundlage sowie tiefe und inhaltsreiche Bildung zu geben … In der geistigen Bildung des Volkes besteht seine Zukunft, die ihm die Kraft gibt und es zur Berühmtheit führen wird!“47 Im Mai 1886 wurde der Grundstein des künftigen Theaters gelegt. 200.000 Menschen wohnten dem Festakt bei. „Das Fundament dieses unseres Heiligtums, das bis an die tiefsten Grundfesten der Menschengemeinschaft reicht, war unter dem Schutt tödlicher Unterdrückung durch Fremde begraben, aber es hat bis zum heutigen Tag nicht den geringsten Schaden genommen“, hieß es in der Zeitung Narodny listy.48 1881 wurde der Bau eröffnet – nur um kurz danach in Teilen niederzubrennen. Erneut kam es zu einer Spendensammlung, und im November 1883 war es dann so weit: Der Bau wurde endgültig eröffnet – wie schon beim ersten Mal auch nun wieder unter den Klängen der von Bedřich Smetana eigens komponierten Oper Libusa, einem Stück ganz nach dem patriotischen Geschmack der Zeit. „Meine geliebte tschechische Nation wird nicht untergehen, sie wird die Schreckenshöllen ruhmhaft überstehen!“, versichert am Ende die zentrale Protagonistin des Singspiels.
Auch andernorts errichtete man in jenen Jahren Bauten, die den nationalen Geist verkörpern sollen: Die Serben eröffneten 1841 das Belgrader Theater, 1852 zeigte sich in Bukarest das „Große Theater“ der Öffentlichkeit. Es brauchte dann noch ein Vierteljahrhundert, um in den Rang eines „Nationaltheaters“ zu kommen. Parallel zu den Theatern wurden Museen und Bibliotheken errichtet, in denen sich die Bürger nicht nur bilden, sondern durch die sie sich auch architektonisch angemessen repräsentiert fühlen sollten.