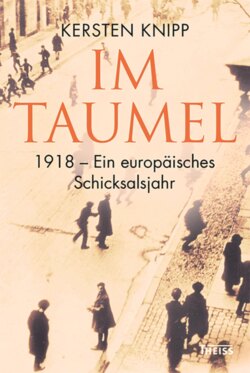Читать книгу Im Taumel - Kersten Knipp - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der „Ausgleich“: Die Reiche und ihre Minderheiten
ОглавлениеLangfristig behielten die Teilnehmer des Slawenkongresses und die anderen, durchaus wohlgesonnenen Kritiker des Reiches recht: Der Kaiser konnte auf Dauer keine Dekrete erlassen, denen sich die Staaten wie selbstverständlich fügen mussten. Das Reichsganze war auf die Summe seiner Teile, die Staaten, angewiesen. Langfristig kam es ohne deren Loyalität nicht aus. Deutlich zeigte sich das in den folgenden Kriegen, aus denen Österreich schwer beschädigt herausgegangen war. 1859 hatten französische und piemontesische Truppen das aus Wien entsandte Heer geschlagen und damit die Weichen für ein vereintes Italien gelegt. Und 1866 hatte die preußische Armee in der Schlacht von Königgrätz den Österreichern eine herbe Niederlage beigebracht, in deren Folge sie aus dem sich formierenden deutschen Nationalstaat ausschieden.
Ein Reich, das seine Interessen nach außen nicht zu verteidigen vermag, hat Schwierigkeiten, sich nach innen zu legitimieren. Forderte der Kaiser weitere – auch finanzielle – Unterstützung aus den Habsburger Ländern, musste er im Gegenzug seinerseits Zugeständnisse machen. Die forderte man vor allem aus Ungarn, das seit dem Krieg von 1849 ein weiterhin gespanntes Verhältnis zu Österreich hatte. In Pest war der Preis für weitere Unterstützung klar: Ungarn müsste ein gleichberechtigter und Österreich ebenbürtiger Staat werden. Nach einigen Verhandlungen fanden beide Parteien ein Arrangement, wie die Macht zwischen ihnen aufzuteilen sei. Durch diesen „Ausgleich“ war das Reich nun ein zweigeteilter Staat, mit Ungarn – den „Ländern der heiligen ungarischen Stephanskrone“, wie es sich nicht ohne Pomp nannte – auf der einen Seite und Österreich auf der anderen. Eigentlich hätte es bei der schlichten Bezeichnung für das Habsburger Kernland bleiben können. Doch damit erklärten sich die „historischen“ Reichsteile nicht einverstanden, und so wählte man für den offiziellen Gebrauch eine andere Bezeichnung: „die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder“. Um den dann doch wieder abzukürzen, bot sich ein weiterer Name an: „Cisleithanien“ – die Länder diesseits der Leitha, des Grenzflusses zwischen den beiden Staaten. Beide Reichsteile waren eigenständig, zwar ohne gemeinsames Parlament, aber durch eine gemeinsame Außen-, Militär- und Finanzpolitik verbunden. Symbolisch und zugleich politisch vereint waren die beiden Länder zudem durch die Personalunion, die Franz Joseph als Kaiser von Österreich und König von Ungarn innehatte. In dieser Doppelfunktion gab er dem neu formierten Staat jenen Namen, unter dem er fortan bekannt wurde: die K.-u.-k.-Monarchie, die „Kaiser und König Monarchie“. Als Kaiser und König genoss Joseph auch in dem neuen Staat beträchtliche Machtfülle. Er kontrollierte die Armee und die Außenpolitik und hatte erheblichen Einfluss auf die Regierungsbildung. Zusätzliche Regierungsgewalt erhielt er durch einen Notverordnungsparagrafen: den berühmten Paragrafen 14, der es ihm erlaubte, notfalls am Parlament vorbeizuregieren – ein Sonderrecht, von dem er in den folgenden Jahren und Jahrzehnten reichlich Gebrauch machte.
Mit der Vorherrschaft der beiden Staaten war die Grundlage für die Nationalitätenkonflikte der kommenden Jahrzehnte gelegt, die bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs trotz zahlreicher Reformversuche anhalten sollten. Zwar war die Gleichheit aller gesprochenen Sprachen in den von Österreich und Ungarn regierten Ländern ab 1867 im Grundgesetz anerkannt. Das verhinderte aber nicht, dass Spannungen an immer neuen Stellen aufbrachen. Besonders heftig rieben sich die Nationalisten am Wahlrecht. Zwar konnten in Cisleithanien die männlichen Staatsbürger bereits seit dem Jahr 1867 wählen, doch war das Wahlrecht stark eingeschränkt: Das Recht zur Stimmabgabe war an die Voraussetzung von Besitz geknüpft – eine hohe Hürde, die zunächst nur knapp sechs Prozent der Bevölkerung zur Wahl zuließ. Erst von 1897 an durften alle Männer ab dem 24. Lebensjahr wählen, unabhängig von ihrer Steuerleistung. Allerdings waren die einzelnen Bevölkerungsanteile höchst unterschiedlich repräsentiert: Die Großgrundbesitzer, die rund 5500 Wahlberechtigte stellten, waren im Parlament durch 85 Mandate vertreten, während die einfachen Bürger – rund fünf Millionen Menschen – sich nur durch 72 Abgeordnete repräsentiert sahen.64 In anderer Hinsicht bewirkten die Reformen eine bedeutende Verschiebung: Erstmals stellten die deutschen Abgeordneten weniger als die Hälfte der Delegierten.
Anders sah es in Ungarn aus. Dort gründete das Wahlrecht auf bestimmten Besitzverhältnissen. So durften noch kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs gerade einmal 13 Prozent der Bevölkerung wählen. Die meisten dieser Stimmberechtigten waren ethnische Ungarn – mit der Folge, dass sie, die etwas mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung stellten, über 405 Sitze im Parlament verfügten. Die Angehörigen der übrigen Nationen hingegen mussten sich mit acht Sitzen begnügen. Deutlich zeigte sich ihnen auf diese Weise, wie stark sich Recht und Macht an ethnischen Kriterien orientierten. Auch mit Blick auf die Sprachensituation konnten die nicht-ungarischen Volksgruppen nicht zufrieden sein: Die einzig zugelassene Staats- und Unterrichtssprache war das Ungarische. So wurden alle Gremien, der Reichsrat ebenso wie die Landesparlamente, zu Bühnen energisch gefochtener Nationalitätenkonflikte. In Ungarn forderten Kroaten, Serben, Slowaken und Rumänen vehement weitergehende Rechte, die die Ungarn ihnen nicht minder vehement verweigerten. „Ihr kümmert euch um eure Slawen, wir uns um unsere.“65 So hatte Gyula Andrassy, der erste ungarische Premier nach dem Ausgleich, gegenüber seinen österreichischen Partnern seine Vorstellung künftiger Minderheitenpolitik umrissen. Prägnanter und zynischer hätte er die ihm vorschwebenden nationalen Hierarchien kaum auf den Punkt bringen können.
Doch auch in Cisleithanien gärten die Nationalitätenkonflikte. Sie zeigten sich teils in konkreten Forderungen, die die Vertreter der einzelnen Nationalitäten aufstellten, teils aber auch in eher symbolischen Handlungen. Zu ihnen zählten die Auftritte besonders der hart nationalistischen Abgeordneten. Immer noch konnten die Abgeordneten im Parlament in einer der zehn zugelassenen Sprachen sprechen. Weil es zugleich immer noch keinen Übersetzerdienst gab, nutzten nicht wenige der Volksvertreter ihre Auftritte, um die Arbeit des Plenums durch lange, jeweils nur wenigen Abgeordneten verständliche Redebeiträge hinauszuzögern oder gar, wenn sich nur genügend zusammenfanden, zu sabotieren. „Das cisleithanische Parlament entwickelte sich zu einer Touristenattraktion. Vor allem im Winter drängten sich die Wiener Vergnügungssüchtigen auf der beheizten Besuchergalerie. Im Gegensatz zu den Theatern und Opernhäusern der Stadt war der Zutritt zu den Parlamentssitzungen kostenlos“, wie ein Berliner Journalist einmal sarkastisch kommentierte.66 Besonders engagiert traten die Tschechen auf. Sie wollten es nicht hinnehmen, dass allein die Ungarn eine privilegierte Stellung genossen, und forderten diese auch für sich. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, blieben sie mehr und mehr dem Reichstag fern. Um sie zurückzuholen, erließ Premierminister Eduard Graf Taaffe 1880 eine Sprachverordnung, der zufolge das Tschechische auch in den deutschsprachigen Teilen Böhmens als Amtssprache galt. Fortan fiel es den tschechisch-sprachigen Bürgern Böhmens zwar leichter, in den Staatsdienst einzutreten – die Konflikte zwischen Deutsch- und Tschechischsprechern aber verschärften sich.