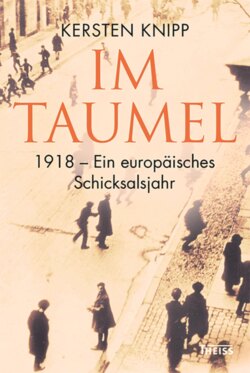Читать книгу Im Taumel - Kersten Knipp - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Deutsch-tschechischer Sprachenstreit
ОглавлениеDie ungelösten Spannungen bewogen 1897 den damaligen Ministerpräsidenten Kasimir Felix Badeni, eine neue Sprachverordnung zu erlassen. Die hatte ursprünglich einen rein strategischen Sinn: Nachdem aufgrund der Wahlrechtsreformen die nicht-deutschen Abgeordneten im cisleithanischen Parlament die Mehrheit stellten, war Badeni vor allem auf die Zustimmung der besonders stark vertretenen tschechischen Abgeordneten angewiesen. Zu ihnen zählten auch die sogenannten jungtschechischen Abgeordneten, die für einen autonomen tschechischen Staat eintraten. Um sie zu gewinnen, kam Badeni ihnen im Frühjahr mit einer neuen Verordnung weit entgegen: Wendeten sich Bürger in Böhmen auf Tschechisch an die dortigen Gerichte und Verwaltungsbehörden, dann müssten die Beamten diese Anträge auch auf Tschechisch bearbeiten und beantworten. Für die nur des Tschechischen mächtigen Bürger war das eine gewaltige Erleichterung – für diejenigen Beamten aber, die ausschließlich Deutsch sprachen, eine Provokation. Sie mussten, jedenfalls theoretisch, fortan beide Sprachen, Deutsch und Tschechisch, beherrschen. So wurden sie aufgefordert, sich innerhalb von vier Jahren für die Zweisprachigkeit zu qualifizieren. Für besonderen Unmut sorgte der Umstand, dass vom Juli 1901 an nur diejenigen Bewerber in den Beamtendienst aufgenommen wurden, die beider Sprachen mächtig waren. Da die Tschechen nahezu ausnahmslos zweisprachig waren, traf das vor allem die deutschen Beamtenanwärter.
Die Entscheidung löste unter den deutschnationalen Abgeordneten und ihren Anhängern Empörung aus. Eine „undeutsche Schwäche“ habe diese Niederlage ermöglicht, ereiferten sich die Wiener Nationalisten, nun hätten die slawischen Abgeordneten „die Möglichkeit einer totalen Eroberung“.67 Von einem „Kampfe um die berechtigte Stellung der Deutschen in Österreich“ sprach die Partei der Großgrundbesitzer. Marianne von Riedl etwa, die Schwester des liberalen, für die Gruppe „Verfassungstreuer Großgrundbesitz“ im Parlament sitzenden Abgeordneten Joseph Maria Baernreithers, zeigte sich entsetzt: „Langsam wurde den Deutschen der Boden unter den Füßen weggezogen … und jetzt kam der Moment des Purzelns. Jetzt liegen wir da und finden, dass kein Boden mehr unter uns ist.“ Damit müsse nun Schluss sein, war sie überzeugt. „Wir, die wir der größten, kultiviertesten Nation angehören, wir werden mit Spucke und Fußtritten hinausgeworfen aus dem Lande, das wir kultiviert, dem wir zu Reichtum und Stellung verholfen haben.“68
Von Riedls Erregungen teilten viele. Die Proteste verschärften sich, Anhänger und Gegner gingen in den Straßen Wiens aufeinander los. Die Ordnungskräfte, so legt die Dokumentation der Wiener Polizeiwache nahe, hatte alle Mühe, der Auseinandersetzungen Herr zu werden. „Im alten nationalen Kampfe zwischen Deutschen und Slawen lösten … die Versuche Badenis, den Slawen Vorrechte einzuräumen, gewaltige, den Staat bis ans Mark erschütternde Vulkanausbrüche aus. (Die) Wache musste in aufreibendem und opfervollem Kampfe die Ruhe herstellen.“69 Auch in Prag flammten nationalistische Gefühle auf. Dort waren die Proteste so heftig, dass die Behörden sich veranlasst sahen, den Ausnahmezustand über die Stadt zu verhängen.
Selbst die Parlamentarier vergaßen eine Zeit lang ihre übliche Contenance. Im Wiener Abgeordnetenhaus griffen sie einander derart harsch an, dass die Regierung sich im Herbst gezwungen sah, die dortige Rednerbühne zu schließen. Schließlich verweigerten die Deutschnationalen Badeni die Unterstützung, woraufhin dieser im November zurücktrat. Seine Anordnung wurde in mehreren Schritten wieder zurückgenommen und 1899 ganz kassiert. Das brachte wiederum die Tschechen auf. Tatsächlich verfügten sie zwar zusammen mit den Abgeordneten der anderen Länder über die parlamentarische Mehrheit. Trotzdem konnten die Nationalisten diese nicht in ihrem Sinne nutzen. Denn längst waren moderne Massenparteien entstanden, deren Abgeordnete, wie etwa die Sozialdemokraten, ganz andere als rein nationale Präferenzen hatten. Das entschärfte zwar den Sprachenstreit und andere ethnisch motivierte Konflikte, löste sie aber nicht. Diese blieben weiter virulent – auch darum, weil die Deutschen zwar nicht mehr die Mehrheit, aber weiterhin die größte Gruppe im Parlament bildeten. So war für den späteren Außenminister Alois Lexa von Aehrenthal bereits 1898 eines absehbar: dass nämlich „ein Unterschätzen des deutschen Elements, ein Regieren gegen dessen Interessen, einfach ausgeschlossen ist.“ Prägnanter formulierte er den Gedanken gegenüber dem späteren Ministerpräsidenten Franz von Thun und Hohenstein: „Ich halte den Satz für richtig, dass Österreich die Unzufriedenheit der Tschechen leichter erträgt als die der Deutschen.“70
Allerdings kamen diesem Kalkül Demografie und Arbeitsmarkt dazwischen. In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts drängten in Böhmen immer mehr Tschechen auf den Arbeitsmarkt auch der deutschsprachigen Gebiete, zur Jahrhundertwende waren es eine halbe Million. Die Sprache der Wahl lag auf der Hand: die eigene, also das Tschechische. Unmerklich nahm der Druck, Deutsch zu lernen, ab. Die Tendenz hielt an – und das Deutsche begann seinen Glanz zu verlieren. Gelöst waren die Probleme dadurch allerdings nicht, im Gegenteil: Groll und Ranküne der Deutschnationalen wuchsen weiter. Die missgelaunte, auf Erlösung per Gewalt drängende Stimmung bestätigte die Befürchtungen des weitsichtigen Adolf Fischhof. Er warnte schon 1885 vor den Folgen eines aus den Fugen geratenden sprachlichen Nationalismus: „Die von den Aposteln der nationalen Unduldsamkeit zum Dogma hinaufgeschraubte Irrlehre, dass die Anerkennung des thatsächlichen Uebergewichtes einer grossen Cultursprache im Staatsganzen eine Demuthigung und Unterdrückung der minder entwickelten Nationalitäten bedeute, hat an die Stelle von Nationalbewusstsein Nationaldünkel gesetzt …, und so ist kaum zu ermessen, welche Opfer die Völker Oesterreichs dem Sprachen-Moloch noch bringen werden.“71