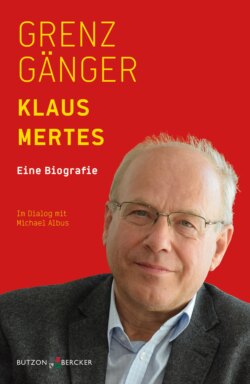Читать книгу Grenzgänger - Klaus Mertes - Страница 18
ОглавлениеDie Eliten des Evangeliums sind gefährlich
Das Evangelium verschließt sich nicht dem Elitedenken: „Wer der Erste sein will, der soll der Letzte von allen und der Diener aller sein.“ (Markus 9,35)
Der Wunsch, Erster sein zu wollen, wird im Evangelium erfüllt, allerdings durch Zuweisung des letzten Platzes. Da, wo es keine Positionen, keine öffentliche Anerkennung und keine Macht gibt, da hält sich die Elite des Evangeliums auf. Der letzte Platz ist wirklich ein erster Platz. Das Paradox lässt sich nicht dadurch auflösen, dass man Letzter werden will, um Erster zu sein. Es geht ums Dienen. Wer dienen will, um zu herrschen, dient nicht. Andersherum formuliert: Wer aus eigenem Willen zur Elite des Evangeliums gehören will, gehört nicht dazu. Der letzte Platz wird zugewiesen – der Platz bei den Armen, bei den Kranken, bei den Ausgeschlossenen, der Platz am Kreuz.
Wer sich auf den letzten Platz einlässt, ist gefährlich – ohne es zu wollen. Von dieser Erfahrung spricht das Evangelium an vielen Stellen …
Die Elitekritik des Außenseiters Jesus bringt die Hohenpriester in Rage: Sie beschließen, Jesus tu töten. Petrus und Paulus machen ähnliche Erfahrungen. Sie gehen zu den Römern und Griechen und machen sich dadurch Feinde bei den eigenen Leuten (Apostelgeschichte 10,1ff/Galater 2,12). Friedrich Spee* wird zur letzten Station der gequälten Frauen geschickt, bevor sie als Hexen verbrannt werden; was er dort erkennt, macht ihn gefährlich. Oscar Romero* wird den Mächtigen in El Salvador gefährlich, weil er – durch seinen Freund Rutilio Grande geführt – nicht mehr in der Welt der Bücher Theologie liest, sondern in der Welt der Armen.
Man kann sagen: Wer im Sinne des Evangeliums einen letzten Platz besetzt, erfährt eine besondere Form von Prominenz: Er oder sie wird „gefährlich“, erregt Angst und Schrecken, wird zum Tagesthema. Solche Gefährlichkeit gefährdet zugleich. Jon Sobrino* hat das in seinem Bericht über die Ermordung der sechs Mitbrüder und der beiden Frauen durch die Mordkommandos der salvadorianischen „Eliten“ einmal so benannt: „Sterben muss, wer an Götzen rührt.“ Wer den letzten Platz besetzt, rührt an Götzen: an die festen Selbstbilder, die Besserwisserei der Klugen, die Binnensolidarität der Stände und Seilschaften, die Lebenslügen der Gerechten, die Fassadenwelt der Schönen und Reichen, die Herzensunreinheit der rituell Reinen.
Dass dies so ist, hängt mit dem Perspektivwechsel zusammen: Solange einer auf dem ersten Platz ist und in diesem Sinne zu den Reichen gehört, sieht er die Armen nicht, die auf dem letzten Platz sind; und sieht vor allem die Ungerechtigkeit nicht, dass nämlich ihre Armut mit dem eigenen Reichtum zu tun hat. Doch der Wechsel der Perspektive verändert das Selbstbild. Und dies wiederum provoziert diejenigen, die am Selbstbild festhalten und nicht umdenken wollen. Wer die Armen, die Ausgestoßenen, die Außenseiter sichtbar macht, muss sterben.
…
Bleibt nur noch, die Geister richtig zu unterscheiden: Ich kann aus der Tatsache, dass ich Gegner habe, die sich über mich ärgern und mich für gefährlich halten, noch nicht schließen, dass ich im Sinne des Evangeliums auf dem richtigen Weg bin. Es gibt tatsächlich gefährliche Menschen, denen man das Handwerk legen muss; es gibt immer Anlass zur Selbstkritik und damit Anlass zur Offenheit für Kritik durch andere. Eliten im Sinne des Evangeliums erkennt man daran, dass sie der Selbstgerechtigkeit anderer nicht mit der eigenen Selbstgerechtigkeit begegnen. Aber es ist andererseits recht unwahrscheinlich, dass der schmerzliche Weg Jesu und vieler, die ihm auf dem letzten oder vorletzten Platz – rechts und links neben Jesus – nachgefolgt sind, denen erspart bleibt, die das Evangelium ernst nehmen.
Ich habe Altes hinter mir gelassen
Zu meinem eigenen Weg will ich noch etwas sagen. Ich war immer in Bewegung, manchmal mehr als mir lieb war. Die Bewegung hatte und hat immer etwas zu tun mit sehr schmerzlichen Erfahrungen. Es waren Schmerzen, die mich nach vorne gebracht haben. Ich sage das nicht, um zu jammern, im Gegenteil: Ich bin reich beschenkt mit Freude. Aber beim Vorangehen spielten die schmerzlichen Erfahrungen eben auch eine wichtige Rolle.
Und wo stehe ich heute? – Heute bin ich – stärker als früher – ein normaler Christ. Ich bin nicht mehr so sehr „Priester“ im Sinne von Inhaber einer Position. Alles, was mit Hierarchie zusammenhängt, ist mir nicht mehr so wichtig. Ich fühle zu vielen Menschen in der Kirche eine größere Nähe, denen das Evangelium wichtig, aber manches in der Kirche schal geworden ist.
Ein Journalist legte mir vor einiger Zeit folgenden Satz eines Kardinals in Rom vor, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, der meinen Vater noch persönlich kannte: Der Kardinal hatte gesagt: „Wenn der Vater von Pater Mertes wüsste, was der heute treibt, er würde sich im Grabe herumdrehen.“ Das ist natürlich Quatsch; mein Vater war beweglich genug, sich auf Neues einzulassen. Aber für mich war das doch ein interessanter Satz, weil er – mal abgesehen davon, dass dem Kardinal so ein Satz nicht zusteht, schon gar nicht vor Journalisten – tatsächlich etwas widerspiegelt: Die Zeiten haben sich gewandelt. Treue zur eigenen Herkunft und Antworten auf neue Herausforderungen, die das Leben stellt, sind keine Gegensätze. „Neuer Wein gehört in neue Schläuche.“ (Markus 2,22) Ich habe Altes hinter mir gelassen. Es wäre eher traurig, wenn es anders wäre. Das wäre ja Erstarrung.