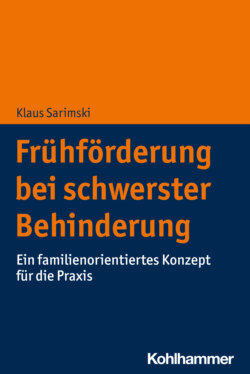Читать книгу Frühförderung bei schwerster Behinderung - Klaus Sarimski - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ursachen und Häufigkeit von schwerster Behinderung
ОглавлениеSchwerste Behinderungen können im Rahmen eines genetischen Syndroms eintreten, d.h. anlagebedingt sein, oder durch eine schwere pränatale Infektion entstehen. Zu den genetischen Syndromen, die mit einer sehr schweren Behinderung einhergehen, gehören z.B. das Cornelia-de-Lange-Syndrom, das Cri-du-Chat-Syndrom, das Angelman-Syndrom und das Rett-Syndrom (Sarimski, 2014). Weitere Ursachen sind cerebrale Schädigungen, wie sie infolge einer schweren Hirnblutung oder eines Sauerstoffmangels in der Neugeborenenperiode auftreten können; ihr Risiko ist bei sehr unreif geborenen Kindern besonders hoch. Schwerste Behinderungen können schließlich auch postnatal durch eine Hirnschädigung (z.B. als Schädel-Hirn-Trauma nach Verkehrsunfällen oder im Rahmen eines Ertrinkungsunfalls) eintreten.
Eine repräsentative Untersuchung von 461 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit einer schweren oder schwersten intellektuellen Behinderung (IQ < 35, bzw. IQ < 20) zeigt, dass mehr als 35 % auf genetische Syndrome, etwa 14 % auf perinatale Infektionen und 8 % auf angeborene Stoffwechselerkrankungen zurückzuführen waren (Arvio & Sillanpää, 2003). Bei etwa einem Drittel der Stichprobe ließ sich die Ursache der Behinderung nicht eindeutig klären.
Ergebnisse zur Häufigkeit von Behinderungen liegen aus flächendeckenden epidemiologischen Untersuchungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aus Skandinavien vor. Sie erlauben eine quantitative Angabe zum Anteil der Kinder mit schwerer und schwerster Intelligenzminderung (IQ < 35 bzw. IQ < 20, wie sie nach der ICD-10 unterschieden werden). So fanden Arvio & Sillanpää (2003) in einem Distrikt Finnlands unter mehr als 340.000 Einwohnern 461 Bewohner (0.13 %) mit einer solchen Diagnose. Eine norwegische Studie (Stromme & Valvatne, 1998) ermittelte eine Häufigkeit von 0.12 %. Wenn man diese Zahlen auf Deutschland überträgt, kann davon ausgegangen werden, dass pro Geburtsjahrgang mindestens 800–1000 Kinder zu den Kindern mit schwerer und schwerster intellektueller Behinderung gehören.
Repräsentative Daten zur Häufigkeit von schweren und schwersten Behinderungen im Kindesalter liegen im deutschen Sprachraum nicht vor. Eine Orientierung, wie häufig diese Behinderungen sind, lässt sich aber aus Erhebungen gewinnen, die in Förderzentren (Kindergärten und Schulen) durchgeführt wurden. Eine solche Erhebung wurde z.B. in Schulkindergärten, die an Förderzentren für Kinder mit Förderbedarf im Bereich der geistigen oder körperlichen Entwicklung bzw. für Kinder mit Hör- oder Sehbehinderungen angeschlossen sind,durchgeführt (Sarimski, 2016). Sie bezieht sich auf Baden-Württemberg – ein Bundesland, in dem die Institution der Schulkindergärten, die an Sonderschulen angegliedert sind, aus historischen Gründen bis heute sehr breit etabliert ist. An der Erhebung beteiligten sich 258 Gruppenleiterinnen (50.7 % aller Gruppenleiterinnen in den betreffenden Förderschwerpunkten), davon konnten 238 Fragebögen in die Auswertung einbezogen werden. Die Angaben der Gruppenleiterinnen aus diesen 238 Gruppen beziehen sich auf insgesamt 1811 Kinder. Die Ergebnisse lassen sich in folgende Aussagen zusammenfassen:
• Mehr als ein Drittel der Kinder, die in Schulkindergärten für geistigbehinderte, körperbehinderte, blinde und sehbehinderte oder hörgeschädigte Kinder betreut werden, waren als mehrfach behindert anzusehen. 25 % wiesen einen ausgeprägten Hilfebedarf in allen drei abgefragten Bereichen (Umwelterkundung, Verständigung, Mobilität) auf. Es handelte sich um 446 Kinder.
• 37 % der Kinder hatten einen ausgeprägten Hilfebedarf bei der Nahrungsaufnahme. 2 % (n = 38) waren auf die Versorgung mit einer Ernährungssonde, 0.5 % (n = 9) auf eine Trachealkanüle angewiesen. 9.2 % (n = 168) benötigten nach Einschätzung der Fachkräfte elektronische Kommunikationshilfen zur Unterstützung der Verständigung.
Eine Studie zur Bildungsrealität von Schülern mit schwerer und mehrfacher Behinderung, die im gleichen Bundesland durchgeführt wurde, macht ebenfalls deutlich, dass bei vielen Kindern in Förderzentren ein umfassender Unterstützungsbedarf vorliegt. Bei 165 Schülern, die an Schulen für Körperbehinderte und an Schulen für Geistigbehinderte (von den Lehrkräften) als schwerstbehindert eingeschätzt werden, gaben die Eltern bei über 90 % eine Beeinträchtigung der Sprache, bei 77 % eine schwere körperliche Behinderung, bei etwa 50 % eine Seh- oder Hörbehinderung an (Klauß, 2006). Etwa 10 % teilten mit, dass ihr Kind Probleme mit der Nahrungsaufnahme hat.
Die Zahl der Kinder mit schwerster Behinderung, die in Kindertagesstätten mit inklusivem Konzept oder allgemeinen Schulen gefördert werden, ist niedrig; verlässliche Zahlen liegen dazu allerdings nicht vor. Pädagogische Fachkräfte in allgemeinen Kindergärten und Schule stehen einer Aufnahme von Kindern mit schwerster Behinderung überwiegend skeptisch gegenüber. Hindernisse für eine inklusive Förderung werden in fehlender Barrierefreiheit der Einrichtungen, mangelnder räumlicher Ausstattung und – vor allem – fehlender Qualifikation des Personals gesehen (Sarimski, 2021a).