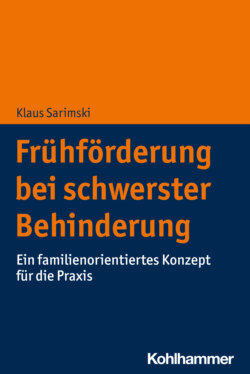Читать книгу Frühförderung bei schwerster Behinderung - Klaus Sarimski - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеStatt eines Vorwortes: Michael, Andreas und Christine
Michael
Michaels Eltern wenden sich bereits während der stationären Erstversorgung an das Kinderzentrum in München, als eine Fachärztin für Humangenetik die Diagnose eines Cornelia-de-Lange-Syndroms stellt. Der Junge wird im Alter von neun Wochen erstmals vorgestellt.
In den ersten Wochen zu Hause bereiten eine vegetative Instabilität und ausgeprägte Probleme bei der Ernährung die größten Sorgen. Für mehrere Monate wird er überwiegend per Sonde ernährt und kann erst allmählich – mit Unterstützung einer erfahrenen Physiotherapeutin – an die orale Ernährung herangeführt werden. Zunächst zeigt er kaum Interesse an der Umwelt und am Kontakt mit seinen Eltern. Schnell wird klar, dass auch sein Hörvermögen eingeschränkt ist; er wird mit einem Hörgerät versorgt. Mit acht Monaten beginnt er den Kopf zu heben, wenn er angesprochen wird, und einen Arm in die Richtung auszustrecken, wenn ein Mobile über ihm baumelt oder ihm eine kleine Rassel angeboten wird. Allmählich nimmt er Blickkontakt auf, wenn die Eltern sich über ihn beugen. In der Beratung geht es von Beginn an darum, die Wahrnehmung der Eltern für Signale von Umweltinteresse und Kommunikationsbereitschaft Michaels zu stärken und ihnen zu helfen, positive Entwicklungsperspektiven aufzubauen. Beide Eltern setzen sich intensiv mit der Realität der Behinderung von Michael und den Auswirkungen der Behinderung auf die Entwicklung ihrer Familie auseinander.
Andreas
Andreas wird erstmals mit zwei Jahren im Kinderzentrum München vorgestellt. Es handelt sich um einen Jungen mit COFS-Syndrom, ein genetisch bedingtes Fehlbildungssyndrom, das mit einer schwersten Behinderung einhergeht. Andreas ist hochgradig hörbehindert. Er nimmt noch keinen Blickkontakt auf, kann sich noch nicht drehen oder fortbewegen.
In einer ersten Interaktionsbeobachtung versucht die Mutter, ihm in Rückenlage kleine Spielsachen anzubieten. Sie berührt ihn mit einer Rassel, drückt sie ihm in die Hand, schüttelt sie mit ihm gemeinsam. Er zeigt keine Aufmerksamkeitsreaktion. Daraufhin lässt sie das Spielzeug über seinen Körper wandern, tippt mit der Rassel mehrfach seinen Brustkorb an, legt sie ihm dann in die andere Hand. Er hält sie nicht fest. Sie legt sie resigniert beiseite mit dem Kommentar: »Na, dann halt nicht.«
Schnell wird deutlich, dass die Mutter bislang keinen Weg gefunden hat, ihn für die Umgebung zu interessieren oder einen Kontakt zu ihm aufzubauen. Sie hat sich ganz auf die Grundpflege zurückgezogen, versorgt ihn, so sagt sie, »wie eine Puppe«. Die Familiensituation ist sehr angespannt. Der Vater zeigt kein Interesse an seinem Sohn, der große Bruder versucht zwar immer mal wieder, Kontakt mit ihm zu finden, kann aber »mit ihm nichts anfangen«, wie er sagt. Die Mutter fühlt sich sehr allein gelassen, bleibt fast immer zu Hause. Eine Unterstützung durch die Großeltern hat sie nicht, weil diese weit entfernt wohnen.
In der Beratung geht es hier zunächst darum, der Mutter zu helfen, wie sie Kontakt zu Andreas finden kann. Es gilt, den Blick der Mutter für kleine Veränderungen in seiner Körperspannung oder Haltung zu schärfen, an denen sich erkennen lässt, dass er etwas in seiner Umgebung wahrnimmt. Mindestens ebenso wichtig ist es aber, ihre tiefe depressive Reaktion über die Behinderung ihres Kindes anzusprechen, den Vater für eine Beteiligung an der Pflege von Andreas zu gewinnen und soziale Unterstützung für die Familie zu mobilisieren.
Christine
Christine wird mit zwölf Monaten erstmals im Kinderzentrum vorgestellt. Auch sie ist in ihrer motorischen und kognitiven Entwicklung sehr stark beeinträchtigt, ohne dass die medizinischen Untersuchungen die Ursache eindeutig klären können. Christine macht noch keine Ansätze zum Drehen oder Aufrichten. Sie hat zwar gerade zu lächeln begonnen, aber es kommt immer wieder zu ausgedehnten Schreiphasen, ohne dass ein Anlass erkennbar ist oder die Mutter sie trösten kann. Das Verhalten beim Essen ist sehr wechselhaft. Teilweise akzeptiert sie die Flasche oder fein pürrierte Kost aus dem Gläschen, teilweise verweigert sie das Essen ganz.
Die Mutter ist allein erziehend. Der Vater hat sie einige Monate nach der Geburt von Christine verlassen, weil er sich von der Auseinandersetzung mit der Behinderung und den täglichen Belastungen, die das Essengeben, die Pflege und die intensive Physiotherapie mit sich bringen, überfordert fühlte. Die Mutter hat sich ganz auf die Versorgung von Christine konzentriert und versucht mit größtem Engagement, den Alltag zu bewältigen und ihr Anregungen für ihre Entwicklung zu geben. In der Beratung geht es darum, sie dabei zu unterstützen – aber auch darum, Entlastungen zu finden, wie sie ihre Bewältigungskräfte aufs Neue mobilisieren kann, und über Zukunftsperspektiven zu sprechen, was zu einer befriedigenden Lebensqualität für sie und für Christine beitragen könnte.
Michael, Andreas und Christine sind drei Kinder, die mir aus meiner Tätigkeit als Psychologe im Kinderzentrum München gut im Gedächtnis geblieben sind und die ich einige Zeit lang auf ihrem Weg begleiten konnte. Die kleinen Skizzen beschreiben die Ausgangssituation, auf die sich die Frühförderung dieser drei Kinder einzustellen hatte.
In diesem Buch soll es um ein familienorientiertes Konzept der Frühförderung bei schwerster Behinderung gehen. Sie werden als Leser erfahren, was eine schwerste Behinderung ausmacht, wie der Alltag in Familien aussieht, in denen Kinder mit schwerster Behinderung aufwachsen, welche Möglichkeiten es gibt, ihre soziale Teilhabe zu unterstützen, und wie eine Beratung dieser Familien angelegt sein kann – bis hin zu der Frage, was Frühförderung beitragen kann, damit sich Kinder mit schwerster Behinderung nicht nur in ihrer Familie, sondern auch später in einer Kindertagesstätte zugehörig und wohlfühlen.
Wenn man in die Literatur schaut, findet man eine Reihe von Berichten von Eltern – meistens Müttern –, die ihre Erfahrungen im Alltag mit ihrem Kind mit schwerster Behinderung schildern, ihre Sorgen und ihre Hoffnungen. Als Beispiel sei auf das Buch von Sandra Roth verwiesen, einer Journalistin, die ihre Auseinandersetzung mit der Behinderung ihrer Tochter in eindrucksvoller Weise unter dem Titel »Lotta Wundertüte. Unser Leben mit Bobbycar und Rollstuhl« beschreibt (Roth, 2013).
Andreas Fröhlich, ein von mir hochgeschätzter Kollege, hat in seinen Publikationen unter dem Titel »Basale Stimulation« über viele Jahre ein sonderpädagogisches Konzept für die Arbeit mit Menschen mit schwerster Behinderung entwickelt, das von einer wertschätzenden Haltung und einem großen Einfühlungsvermögen in ihr Erleben der Welt und ihre besonderen Bedürfnisse geprägt ist (z.B. Fröhlich, 2012, 2015; Mohr et al., 2019).
Erfahrungsberichte von Eltern und ein Verständnis für den umfassenden Unterstützungsbedarf von Menschen mit schwerster Behinderung, das sich aus solchen Quellen gewinnen lässt, sind für Fachkräfte, die mit der Frühförderung von Kindern mit schwerster Behinderung betraut sind, sehr wertvoll. Dieses Buch soll diese Grundlagen für ihre Arbeit um ein familienorientiertes Konzept ergänzen, mit dem die Lebensqualität von Kindern mit schwerster Behinderung und ihrer gesamten Familie unterstützt werden kann. Es wird somit nicht um eine Übungssammlung zur Frühförderung oder die Schilderung von Therapiekonzepten gehen, sondern um einen Leitfaden, an dem sich Fachkräfte in Frühförderstellen, Sozialpädiatrischen Zentren oder Therapiepraxen orientieren können, um den besonderen Bedürfnissen dieser Kinder, ihrer Eltern und Geschwister gerecht zu werden. Ich hoffe, dass der Band einen Beitrag leisten kann, der diesen Fachkräften in ihrer praktischen Arbeit nützlich ist.
München, im Sommer 2021
Prof. Dr. Klaus Sarimski