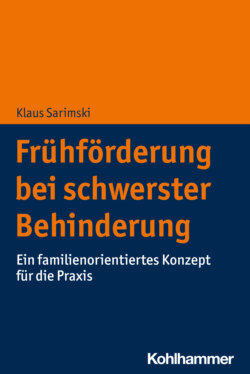Читать книгу Frühförderung bei schwerster Behinderung - Klaus Sarimski - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Lebensqualität bei schwerster Behinderung
ОглавлениеWas Lebensqualität für Menschen mit schwerster Behinderung bedeutet, ist nicht einfach zu bestimmen. Grundsätzlich unterscheiden sich nach Ansicht von Eltern und Betreuern von Menschen mit schwerster Behinderung die Komponenten, die Lebensqualität ausmachen, nicht in Abhängigkeit vom Grad der Behinderung (Petry et al., 2005). Einige Indikatoren, die bei Menschen, die nicht behindert sind, relevant sind – Einkommen, sozialer Status, berufliche Verwirklichung, Autonomie – sind jedoch auf ihre Lebenssituation nicht anwendbar. Andere Aspekte, die für Menschen ohne schwere Behinderungen keine wesentliche Bedeutung haben, haben dagegen einen starken Einfluss auf die Lebensqualität dieser Zielgruppe – z.B. die gesundheitliche Versorgung oder die Verfügbarkeit von Hilfsmitteln und Unterstützungsmaßnahmen (Brown et al., 2013).
Petry et al. (2007) organisierten eine Expertendiskussion von Fachleuten aus den Niederlanden, aus Belgien, Deutschland, England und Irland zu der Frage, welche Dimensionen die Lebensqualität dieser Zielgruppe ausmachen und wie diese sinnvoll strukturiert werden können. In einem Konsensus-Prozess identifizierten die Autoren insgesamt 176 Indikatoren (Aktivitäten und Unterstützungsmaßnahmen), um das körperliche Wohlbefinden (Mobilität, Gesundheit, Hygiene, Ernährung, Ruhephasen), das materielle Wohlbefinden (Wohnumwelt, technische Hilfsmittel), das sozial-emotionale Wohlbefinden (Kommunikation, Behandlungsmaßnahmen, Schutz vor Gefahren, familiäre Bindungen, soziale Beziehungen und Teilhabe) sowie Verwirklichung des Entwicklungspotentials (Anregungen zur Entwicklung von Kompetenzen) und die Beteiligung an Aktivitäten im Alltag (Selbstbestimmung und Wahlmöglichkeiten) zu beschreiben.
Eine fachliche Herausforderung besteht in der Art und Weise, wie diese Lebensqualität zuverlässig beurteilt werden kann. Kinder, Jugendliche und Erwachsene ohne schwere intellektuelle Behinderung können nach ihrer subjektiven Lebensqualität gefragt werden. Dies ist bei Menschen mit schwerster Behinderung nicht in der gleichen Weise möglich. Hier bleibt nur der Weg, ihre Bezugspersonen nach ihrer Einschätzung zu fragen. Wenn dabei Eltern befragt werden, ist diese Einschätzung jedoch nicht unbeeinflusst von ihrem eigenen psychischen Wohlbefinden und der Belastung, die sie selbst erleben.
Petry et al. (2009) entwickelten einen Fragebogen mit 55 Items, gegliedert in sechs Skalen, um über die Befragung von Bezugspersonen die Lebensqualität bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit schwerster Behinderung in Betreuungsinstitutionen einzuschätzen. Dabei zeigte sich, dass die Lebensqualität in hohem Maße von der gesundheitlichen Situation abhing; gesundheitliche Komplikationen, Ernährungsschwierigkeiten und die Abhängigkeit von Medikamenten waren in der Regel mit einer niedrigeren Lebensqualität assoziiert. Darüber hinaus war der Ausprägungsgrad von Verhaltensauffälligkeiten mit der wahrgenommenen Lebensqualität assoziiert. Außerdem ließen sich Zusammenhänge zur Art und zu Qualitätsmerkmalen der Betreuungseinrichtung identifizieren.
Maes et al. (2007) sahen nach einer Literaturübersicht zur Effektivität von Interventionen zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit schwersten und komplexen Behinderungen Interventionen zur Optimierung der gesundheitlichen Versorgung, zur Förderung sozialer Beziehungen durch eine Anleitung der Betreuungspersonen in der Gestaltung responsiver Interaktionen sowie zur Förderung der Beteiligung an Aktivitäten in einer anregenden Umgebung als vordringlich an.