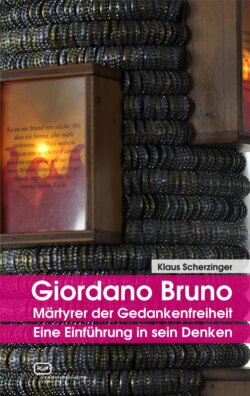Читать книгу Giordano Bruno - Märtyrer der Gedankenfreiheit - Klaus Scherzinger - Страница 10
1.3. Beginnende Naturwissenschaft
ОглавлениеEs ist kein Zufall, dass die Wiedergeburt der Philosophie mit den Anfängen der modernen Naturwissenschaft zusammenfällt. Die moderne Naturwissenschaft hat sich aus der wiedergeborenen Philosophie heraus entwickelt. Es darf geradezu als Beleg für die wiedergewonnene Freiheit der Philosophie gelten, dass sich der Wissenschaftszweig der modernen Naturwissenschaft von ihr abspalten und im weiteren Verlauf der Wissenschaftsgeschichte zum Inbegriff von Wissenschaftlichkeit überhaupt werden konnte.
Diese Entwicklung nahm ihren Lauf, als sich Forscher, wie Galileo Galilei, Nikolaus Kopernikus, dessen Werk und „Hochsinn“ Bruno lobte,23 oder Andreas Vesalius – um nur einige zu nennen – mit ihrer Wahrheitssuche auf die Empirie, aufs Beobachten und aufs Messen verlegten. Mit nie gekanntem Zutrauen gingen sie daran, den Phänomenen und Phänomenbereichen der sichtbaren und sinnlich erfahrbaren Natur – dem sichtbaren Kosmos oder dem menschlichen Körper – auf die Schliche zu kommen, d.h. ihnen ihre Gesetzmäßigkeiten und Funktionsweisen zu entlocken. Das konnte gelingen, weil man anfing genauer und systematischer zu beobachten und weil man umzusetzen begann, was Galilei so programmatisch seinem Zeitalter zugerufen haben soll: „Alles messen, was messbar ist – und messbar machen, was noch nicht messbar ist!“24 Wer diesem Aufruf folgen wollte, musste Messinstrumente zwischen sich und die unmittelbare Naturerfahrung schieben, musste eine unmittelbare zu einer mittelbaren, durch Messdaten vermittelten Naturerfahrung machen. Diese neue Art der metrisierenden und quantifizierenden Naturerfahrung bedeutete eine thematische Reduzierung der Natur. Nur wenn sie sich durch das Nadelöhr der Messinstrumente zwängen ließ, konnte sie zum Thema werden. Natur wurde gleichbedeutend mit messbarer Natur und mit den Messdaten und mit Hilfe der Mathematik wurden abstrakte, von der ursprünglichen, von Messinstrumenten nicht verstellten Naturerfahrung abgelöste Naturmodelle ersonnen. Ließen sich solche Modelle und das, was man mit Ihnen vorhersagen konnte, an der Erfahrung bestätigen, so durften sie für wissenschaftlich wahr gelten. Erfahrung wurde zum Prüfstein der Theorie und deshalb die Überprüfbarkeit zum entscheidenden Wahrheitskriterium. Die dadurch notwendig gewordene Überprüfungspflicht hat einen folgenreichen Doppeleffekt: Eine gelungenes Überprüfungsverfahren lässt das, was zuvor nur eine auf der Basis von empirischen Daten erstellte Hypothese war, zu einer belegten Theorie mutieren und ist zugleich auch schon der erste Schritt zur technischen Verwertbarkeit dieser Theorie. Der „äußere Aspekt“, d.h. der praktisch-physikalische Aspekt der Überprüfungshandlung – so drückt es der Wissenschaftsphilosoph Paul Hoyningen-Huene aus – kann eben meistens auch „mit anderem Handlungsziel“ als dem der Hypothesenprüfung durchgeführt werden.25
Bruno kannte und diskutierte die Einsichten jener seiner Wissenschaftskollegen, die wir heute als Begründer der modernen Naturwissenschaft verehren. Wie erfolgreich dieser neue Weg der Wissenschaft war, sollte sich alsbald zeigen. Naturerscheinungen ließen sich besser prognostizieren und manipulieren, viele Erscheinungen entdeckte man allererst, weil man neue Instrumente zur präziseren Beobachtung zum Einsatz brachte. Ein schönes Beispiel dafür ist Galileis Entdeckung der Jupitermonde mit Hilfe eines Teleskops. Sie gelang ihm im Jahre 1609, da war Bruno schon neun Jahre tot und sie leistete einen wichtigen Beitrag zur allgemeinen Anerkennung der Lehre des Kopernikus, die seinerzeit noch sehr umstritten war.
Die Erfolgsgeschichte der damals noch in den Kinderschuhen steckenden Naturwissenschaft lässt sich als eine Art von Beschränkung begreifen. Moderne Naturwissenschaft beschränkt sich mit ihren Fragen auf Teilbereiche der Erfahrungswirklichkeit, sie klammert Fragen nach dem Ganzen der Erfahrungswirklichkeit aus, sie erklärt „Empirisches durch Empirisches“26 und kümmert sich nicht um die Suche nach letztgültigen und letztbegründenden Antworten. Carl Friedrich von Weizsäcker hat es einmal so ausgedrückt: „Philosophie stellt diejenigen Fragen, die nicht gestellt zu haben die Erfolgsbedingungen des wissenschaftlichen Verfahrens war. Damit ist also behauptet, dass die Wissenschaft ihren Erfolg unter anderem dem Verzicht auf das Stellen bestimmter gewisser Fragen verdankt.“27