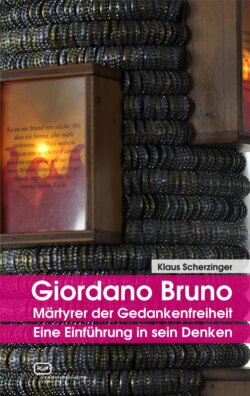Читать книгу Giordano Bruno - Märtyrer der Gedankenfreiheit - Klaus Scherzinger - Страница 8
1.1. Die Schlacht um die Gedankenfreiheit auf dem „Kampfplatz“ der Metaphysik
ОглавлениеMit und als Philosophie hat abendländische Wissenschaft begonnen. Wissenschaft meint hier nicht schon moderne Naturwissenschaft, Wissenschaft ist viel älter und umfassender. Wissenschaft lässt nur eine bestimmte Art von Aussagen als wissenschaftliches Wissen, als wissenschaftlich wahre Aussagen über die Wirklichkeit und ihre Teilbereiche gelten, nämlich solche, die nicht mehr in esoterischen Zirkeln und mit Hilfe des „mystisch-magischen“4 Erkenntnisweges gewonnen wurden, sondern öffentlich und unter Einsatz der Vernunft. Wissenschaftliches Wissen liegt nicht mehr bildhaft erzählerisch vor, sondern streng begrifflich, es liegt auch nicht mehr zusammenhangslos nebeneinander, sondern Wissenschaft versucht die Aussagen, die sie für wahr hält, aufeinander zu beziehen und zu einem Systemganzen zu verknüpfen.
Das Menschheitsprojekt Wissenschaft konnte starten, als Philosophie begann, als der Zweifel an den mythischen Welt- bzw. Wirklichkeitserklärungen wuchs, als mit dem Zweifel zugleich das Ideal der Wahrheit, bzw. der Wahrheitssuche erwachte und als man sich einig wurde, dass die menschliche Vernunft, das also, was die Griechen den „logos“ nannten, zum Einsatz kommen müsse, um mit der Wahrheitssuche ans Ziel kommen zu können. Erkenntnis, wenn sie Wahrheit beanspruchen wollte, durfte nicht länger naiv den Göttergeschichten der Priester, Magier und Wahrsager entnommen werden, sondern musste begründet werden, mithilfe von Argumenten und Schlussfolgerungen und idealerweise auch in der Auseinandersetzung mit den Aussagen und Argumenten anderer Wahrheitssucher. Philosophie bzw. die philosophische Wissenschaft ist Vernunftwissenschaft, sie hat „den Anspruch, dass alle ihre Aussagen vernünftig sind, dass also jedes Vernunftvermögen (jeder Mensch) einsehen müsste, dass und warum diese Aussagen Stringenz beanspruchen“.5
Nun gibt es eine Besonderheit mit der menschlichen Vernunft, eine Problematik, so könnte man auch sagen, auf die Kant hingewiesen hat: Sie hat nämlich „das besondere Schicksal in einer Gattung ihrer Erkenntnisse: dass sie durch Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen kann; denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten kann, denn sie übersteigen alles Vermögen der menschlichen Vernunft“6. Wir können diesen plagenden Fragen nicht ausweichen, doch eine Chance, sie objektiv gültig zu beantworten, gibt es auch nicht. Dennoch wäre es falsch und zudem unmenschlich, sie nicht zu stellen. Die Fragen, von denen Kant spricht und die – wie er sagt – zu „endlosen Streitigkeiten“ unter den Menschen führen, sind metaphysische Fragen.
Metaphysik ist Philosophie der „letzte Fragen“, sie ist, wie es in einem philosophischen Wörterbuch heißt, „die philosophische Grundwissenschaft, in der alle philosophischen Disziplinen wurzeln.“7 Wenn hier vom „Grund“ und vom „Wurzeln“ die Rede ist, dann ist das nicht nur historisch gemeint, weil schon die platonische und die aristotelische Philosophie in weiten Teilen Metaphysik war, sondern es meint auch, dass Metaphysik mit ihren Fragen in Bereiche vorzudringen versucht, von woher sich alles Erfahrbare letztgültig und letztbegründend verstehen lässt. Metaphysik – so hat es Martin Heidegger einmal formuliert – stellt die Grundfrage: „Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts?“8 Sie ist Philosophie, die nach „den letzten, den nicht-empirischen Gründen“9, Wurzeln und Voraussetzungen alles Empirischen fragt. So gesehen ist sie philosophische Universal- und Fundamentalwissenschaft.
Der Metaphysikbegriff ist nicht so alt, wie die Sache, die er bezeichnet. Einer oft vertretenen Auffassung nach haben Peripatetiker des ersten vorchristlichen Jahrhunderts den Titel „Metaphysik“ (von griech. meta ta physika, „nach, bzw. hinter dem Physischen“) ausgewählt, um damit jene aristotelischen Schriften zu bezeichnen, mit denen Aristoteles die philosophische Grundwissenschaft erstmals systematisch und für die nachfolgende Philosophiegeschichte Beispiel gebend ausgearbeitet hatte und die man seinen Schriften zur Philosophie der Naturdinge (im Regal) nachfolgen ließ, weil Aristoteles darin „das für uns erst nach den konkreten Naturdingen Erkennbare, diesen Zugrundeliegende und somit an sich erste behandelte.“10 Weil sie das „Zugrundeliegende“ und das „an sich erste“ thematisiert, hat man die Metaphysik auch „Erste Philosophie“ genannt. Ab der Spätantike und im Mittelalter ist dann der Schriftentitel „Metaphysik“ zum Titel der entsprechenden Disziplin überhaupt geworden.
Die Auseinandersetzung mit Brunos Philosophie wird zeigen: Ihre Befreiung aus der Indienstnahme durch die Theologie musste sich die Philosophie erkämpfen, genauer gesagt, zurückerkämpfen auf ihrem ureigensten Feld der Metaphysik, auf dem sie selbst einst zu Größe und Ruhm gekommen war. Hier herrschte seit Jahrhunderten das christlich-theologische Denken und Philosophie war an die Kette theologischer Vorgaben gelegt.
Kant sagt über die Metaphysik, sie sei ein „unhintertreibliches“11 Anhängsel der menschlichen Vernunft, denn diese „geht unaufhaltsam, ohne dass bloße Eitelkeit des Vielwissens sie dazu bewegt, durch eigenes Bedürfnis getrieben bis zu solchen Fragen fort, die durch keinen Erfahrungsgebrauch der Vernunft und daher entlehnte Prinzipien beantwortet werden können, und so ist wirklich in allen Menschen, sobald Vernunft sich in ihnen zur Spekulation erweitert, irgendeine Metaphysik zu aller Zeit gewesen, und wird auch immer darin bleiben“12.
Wenn das geschieht, wenn die Vernunft Metaphysik treibt und über letzte Fragen spekuliert, dann sind ihre Einsichten wohl eher „vernünftelnde“ Schlüsse als „Vernunftschlüsse“, wie Kant es ausdrückt, „wiewohl sie, ihrer Veranlassung wegen, wohl den letzteren Namen führen können, weil sie doch nicht erdichtet, oder zufällig entstanden, sondern aus der Natur der Vernunft entsprungen sind. Es sind Sophistikationen, nicht der Menschen, sondern der reinen Vernunft selbst, von denen selbst der Weiseste unter allen Menschen sich nicht losmachen … kann“13.
Kant forderte kein Ende der Metaphysik und das wird es, solange es Menschen gibt, auch nicht geben, das war ihm bewusst. Kant wollte, dass uns bewusst ist, was wir tun, wenn wir Metaphysik treiben. Es ging ihm um Selbstdurchsichtigkeit hinsichtlich unseres Erkenntnisvermögens, um eine Selbstkritik der Vernunft mit Blick auf die Grenzen ihres sinnvollen, weil echte Erkenntnis gewinnenden Gebrauchs und auch um eine davon sich ableitende Entspanntheit im Umgang mit metaphysischen Dingen, bei denen sich objektive Wahrheit nicht erlangen lässt.
Von Metaphysik-, bzw. Vernunftkritik und von einer Entspanntheit im Umgang mit metaphysischen Dingen war man zu Zeiten Brunos noch weit entfernt, letzteres wird er leidvoll zu spüren bekommen, durch die Lebensumstände, die man ihm aufzwingt und den Tod, den man ihm bereitet. Die Zumutungen, die seine Antworten auf zentrale metaphysische Fragen den theologischen Dogmenhütern bereiteten, waren erheblich. Bruno entwickelt diese Antworten im Rahmen und im Zuge seines Nachdenkens über Natur und Gott. Seine Schrift „Über die Ursache, das Prinzip und das Eine“ (im Folgenden mit „UPE-Schrift“ abgekürzt), die die Ergebnisse seiner Natur- und Gottesphilosophie in konzentrierter Form zusammengefasst enthält, ist Metaphysik, wie überhaupt die ganze theoretische Philosophie vor Kant Metaphysik war. Die UPE-Schrift ist also – um es mit Kant zu sagen – ein Beispiel frühneuzeitlicher Spekulation und vernünftelnder Sophistikation, aber – und das wird Bruno zum Problem werden – sie ist keine Philosophie mehr im Dienste der Theologie.