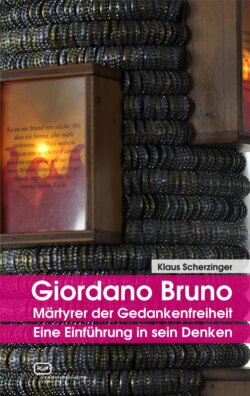Читать книгу Giordano Bruno - Märtyrer der Gedankenfreiheit - Klaus Scherzinger - Страница 13
1.6. Die beiden Hauptschriften
ОглавлениеVor dem Aufkommen des Massenmediums Buch wären freie und frei sich Gehör verschaffende Gelehrte vom Schlage Brunos gar nicht möglich gewesen. In der literalen Manuskriptkultur des Mittelalters war die Wissensproduktion, -sammlung, -speicherung, -verbreitung und -rezeption an die Skriptorien und an die Klöster, also insgesamt an einen von der Theologie beherrschten Wissenschaftsbetrieb gebunden, der nur wenige Eingeübte umfasste. Die mediale, von Gutenbergs Erfindung eingeleitete Revolution brach den engen Kreis mittelalterlicher Wissensproduktion und -zirkulation auf. Der Eintritt in die „Gutenberg-Galaxis“ (ein Begriff des Medientheoretikers Marshall McLuhan) in eine vom Leitmedium Buch geprägte Gesellschaft erschuf dem Denken bzw. der Wissensvermittlung ein neues, bürgerlich-städtisches Publikum, eine Öffentlichkeit, die es vorher gar nicht gab, auch deshalb nicht gab, weil niemand lesen konnte. Diese Öffentlichkeit wollte mitdenken, mitgestalten, wollte frei und auf der Grundlage von volkssprachlichen und nicht mehr nur lateinischen Texten diskutieren, was zuvor ausschließlich in esoterischen Zirkeln scholastischer Theologie besprochen werden durfte, und diese Öffentlichkeit hatte ihre ganz eigenen, neuen, weltlichen, humanistischen Themen und suchte nach Formen des Kulturschaffens, um sich diese Themen vor Augen stellen und bearbeiten zu können. Die Kirche fürchtete zurecht, dass der Prozess der Entstehung einer neuen städtischen Bürgerschicht und ihrer Öffnung und Hinwendung zur Kultur und zur Wissenschaft die Fundamente ihrer eigenen Macht und die mittelalterliche Gesellschaftsordnung insgesamt zersetzen würde.
Zeichen dieser Öffnung und Hinwendung ist nicht nur die enorme Zunahme der Literaturproduktion, z.B. der volksprachlichen religiösen Literatur, sondern auch das Erblühen von Literaturgattungen, die das christliche Mittelalter nicht kannte oder marginalisierte. Verfasst wurden jetzt nicht mehr nur wie vordem vor allem wissenschaftliche Texte, sondern auch Texte, die ihre Botschaften für den ästhetischen Genuss aufbereiteten, d.h. poetische Texte auch Satiren sowie Texte für die Bühne, Dichtung und Theater hatten Konjunktur.
Bruno hat diesen Prozess der Ausdehnung der Kultur-, Kreativ- und Wissensproduktion auf eine neu entstehende Gesellschaftssicht, eine Ausdehnung, die auch die Inhalte und Ausdrucksformen dieser Produktion verwandelten, aktiv und notgedrungen mitgetragen. Er wollte gehört werden, konnte die Kanäle kirchlicher Wissensdistribution aber nicht mehr für sich nutzen und ist zum Verräter am Kultur- und Wissensmonopol der Kirche geworden. Die Kirche, das wurde ihr alsbald bewusst, hatte eine Schlange am Busen ihrer Ausbildungs- und Lehrinstitute genährt. Weil Bruno dem mächtigsten Sprachrohr der Zeit, der Kirche, den Rücken gekehrt hatte, war er auf Mäzenatentum und auch darauf angewiesen, die Möglichkeiten neuer literarischer Ausdrucksformen für die Publikation seiner Ideen zu nutzen. Zu Hilfe kam ihm sein sprachliches und literarisches Talent. Die Wurzeln der großen Bandbreite seiner Ausdrucksfähigkeit – er konnte wissenschaftliche ebenso wie lyrische oder komödiantische Texte verfassen – reichen zurück in die Zeit des Beginns seiner Ausbildung. Sie machte ihn mit Methode und Gestalt des auch im 16. Jahrhundert noch immer mittelalterlich geprägten Wissenschaftsbetriebs vertraut. Bruno übte sich ein, wissenschaftliche, d.h. der innerwissenschaftlichen Wissensvermittlung- und Wissensgenerierung dienende Textarten zu lesen, zu diskutieren und selbst zu verfertigen. Doch auch das, was sich hinter dem Tellerrand des scholastischen Wissenschaftsbetriebes verbarg, das vielseitige kulturelle Leben und die tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen seiner Zeit, sind ihm nicht fremd geblieben. Das hat viel mit seiner eigenen Neugierde und seiner intellektuellen Verwegenheit zu tun. Mehr als andere hat er die Nähe zur Welt des aufstrebenden und nach eigenen kulturellen Ausdrucksformen strebenden Bürgertums gesucht. Schon während der Studienzeit reichte seine Wissbegierde und das damit verbundene Leseinteresse weit über den für Kirchenkarrieren vorgesehen Bildungskanon hinaus.
Paul Richard Blum schreibt: „In jenen frühen Studienjahren dürfte Bruno sich auch seinen enormen Fundus an philosophischen und literarischen Quellenkenntnissen angelesen haben. Er kennt und zitiert die atomistische Naturphilosophie des Lukrez, die Schriften Platons und der Platoniker in der Übersetzung des Marsilio Ficino. Er kennt dessen Schriften und die anderen Renaissancephilosophen, vor allem Nikolaus Cusanus, ferner klassische lateinische Autoren wie Ovid, Horaz und Vergil, aber auch italienische Dichter wie Lodovico Ariosto oder seinen Landsmann Luigi Tansillo, dessen Dichtungen er häufig in seinen italienischen Dialogen zitiert. Wenn der junge Student sich damals in Neapel frei bewegen konnte, hatte er auch vielleicht Gelegenheit zu Kontakten mit Valdesianern, die sich auf den Humanisten Erasmus von Rotterdam beriefen und antitrinitarischen Lehren zugeneigt waren.“33 Man fühlt sich, wenn man Blums Schilderung liest, unweigerlich an Berichte über Schellings Zeit im Tübinger Stift erinnert. Umstürzlerische, verbotene Ideen konnten einsickern in die Welt der württembergischen Kaderschmiede protestantischer Theologie und unter dem Einfluss heimlicher Rousseau- und Kantlektüre nahm Schellings intellektuelle Entwicklung eine Richtung, die die vorgesehen Karriere zum protestantischen Geistlichen verunmöglichte. Bei Bruno könnte es ähnlich gewesen sein. Die Entfremdung von der Kirche, zu deren Diener er ausgebildet werden sollte, muss schon früh begonnen haben. Sein neugieriger Geist konnte die Augen nicht verschließen vor einer Welt im Umbruch, eine Welt, die sich mit dem Theater seine eigenen Tempel schuf und die Dichter und Denker hervorbrachte, die sich weltlichen und menschlichen Themen öffneten. Das alles muss er aufgesogen haben, mit dem jugendlichen Hunger für das Verbotene und soweit es die kirchliche Institution, der er angehörte, nicht zu verhindern wusste.
Zum Weltinteresse gesellte sich seine Lust am Fabulieren und an der Poesie. Es sind Schriften wie die HL-Schrift, die davon künden. Es gefiel ihm, philosophische Einsichten auch auf ungewöhnliche, nicht-wissenschaftliche, weil vom Wissenschaftsbetrieb nicht dafür vorgesehene Weise zu vermitteln. „Als Dichter und Philosoph gleichermaßen begabt, tritt Bruno daher nicht nur als Verfasser von Komödien in Erscheinung, sondern fasst auch seine naturphilosophische Thematik als Material poetischer Gestaltung auf. In der Folge hiervon werden die Leserinnen und Leser mit der erstaunlichen Tatsache konfrontiert, dass so ‚prosaische‘ Gegenstände wie Kosmologie, Physik oder Mathematik in der ungewohnten Einkleidung polemisch burlesker Dialoge oder pathetisch aufgeladener Lehrgedichte begegnen können. Der damit erzielte ästhetische Effekt der brunianischen Philosophie stellt freilich – um einem nahe liegenden Missverständnis vorzubeugen – die logische Stringenz der Gedankenführung keineswegs in Frage.“34
Doch nicht immer ist sie leicht zu entdecken, die strenge Beweiskraft seiner Gedankenführung. Immer wieder, fast schon zwanghaft und mit offensichtlicher Freude am Polemisieren schweift er ab, um überkommene Institutionen und Traditionen mit Kritik und Spott zu überschütten. Gleichwohl verliert er den roten Faden seiner Gedankenführung nie aus dem Blick. Wer ihn aufzugreifen vermag, dem entspinnt sich das faszinierende, philosophische Denkgebäude eines Mannes, der frei denken wollte und sich deshalb selbst entbunden hatte von der Pflicht, Einsichten nur deshalb zu verschweigen, weil eine mächtige, das Leben der Menschen durch und durch bestimmende Institution sie für Irrlehren hielt und weil alles andere als Anpassung und Mitwirkung beim Bau und Erhalt der Heiligen Mutter Kirche und des von ihr gehüteten Wahrheitsschatzes eine Karriere sowohl außerhalb und erst recht innerhalb dieser Institution verhindern würde.
Die UPE- und die HL-Schrift sind Brunos vielleicht bedeutendste Werke. Sie werden im Fokus der vorliegenden Einführung stehen. Der äußeren Form nach sind beide Texte platonischen Dialogen nachgebildete Streit- bzw. Lehrgespräche zwischen fiktiven Personen, die typische Dialogrollen einnehmen. Den Sprechern „Teofilo“ in der UPE-Schrift und „Tansillo“ in der HL-Schrift fällt jeweils die sokratische Rolle zu. Durch Fragen und Nachfragen ihrer Gesprächspartner angeregt, ist es ihre Rede, mit der sich Brunos Gedankenwelt entfaltet.
Auf diese Weise entsteht in der UPE-Schrift ein Gespräch, in dem Teofilo seinen Gesprächspartnern die aristotelische Metaphysik auseinandersetzt, sie an entscheidender Stelle aber anders fasst als der Stagirit und ein Natur- und zugleich Gottesverständnis entwirft, das über das aristotelische und über das der aristotelisch geprägten Scholastik weit hinausgeht.
Anders im Falle der HL-Schrift: Hier wird der Leser Zeuge eines Gesprächs, das Sonette interpretiert. Sie stammen „teils von Bruno selbst, teils von seinem Landsmann, dem Nolaner Luigi Tansillo (1516-1568), der auch als Dialogpartner auftritt“35. Die Sonette beschreiben Seelenzustände des in Liebe entflammten Menschen. Mit ihrer Interpretation eröffnet sich ein neuer Blick auf das menschliche Bewusstsein, ein Blick dafür, „dass Bewusstsein wesenhaft zuständlich ist“, wie Ferdinand Fellmann es ausdrückt.36
Der Begriff „Zuständlichkeit“ zielt ab auf einen „strukturellen Sachverhalt“ innerhalb unseres liebenden Bezugs auf das geliebte Objekt und damit auf einen strukturellen Sachverhalt in der Art und Weise, wie wir uns selbst begegnen, wie wir uns selbst, aus diesem Liebesbezug heraus, verstehen. Brunos „Beschreibungen der Zustände des Verliebten“ gelten diesem strukturellen Sachverhalt, legen ihn frei, wie er offenbar wird, im Vollzug unseres Liebesbezugs. Was sich zeigen wird: Mit und in diesem Bezug, durch seinen Vollzug, wird eine Spannung aufgebaut, die „konstitutiv“ ist für all unsere strebenden Bezüge und damit für die Weise, wie wir uns selbst gegeben sind in diesen Bezügen, eine Spannung, die sich grundsätzlich nicht entspannen, nicht abbauen lässt, weil sich das Objekt der Begierde nie ganz erreichen lässt und weil es sich, je mehr man es will, um so mehr entzieht. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass sich kleine Ziele bzw. Zwischenziele nicht erreichen lassen, doch aufs Ganze des menschlichen Lebens gesehen und für das große Ziel der Gottesliebe bzw. der Wahrheitserkenntnis gilt: Weil das menschliche Selbst nie einholt, was es liebt, nie ganz da sein kann, wo es hin will, ist es in eine Dynamik gezwungen, die der Herzschlag, das Schwungrad seines vergeblichen, aber dennoch immer wieder aufs Neue Anlauf nehmenden Strebens ist.
Mit der HL-Schrift bekommt Bruno in den Blick, was man mit einer aus dem Interpretationsumfeld Heideggerscher Existenzialontologie entlehnten Begrifflichkeit die selbsthaft-existenziale Erstreckung unseres Selbst bzw. seiner Bezüge nennen könnte, eine existentielle, mit dem Vollzug der Existenz sich ereignende Erstrecktheit zwischen jederzeit zugleich gegeben Handlungsmöglichkeiten und Wahlfreiheiten und den damit verbundenen Motiviertheiten, Hoffnungen und Erwartungen auf der einen und unhintergehbaren Gegebenheiten, zu übernehmenden Gebundenheiten, gesetzten Limitierungen unserer Möglichkeiten und die damit verbundenen Enttäuschungen und Verzagtheiten auf der anderen Seite.
Bezogen auf die HL-Schrift bedeutet das: Das Selbst ist und erfährt sich hingestreckt aufgespannt auf das Rad der Wiederholungen seiner letztlich immer vergeblichen Strebungen, sich mit dem geliebten Objekt zu vereinen. Mit Blick auf das Ganze des Kosmos und seiner unendlich vielen Teile kommt der Lauf dieses Wiederholungsrades nie zum Ende, das wird Brunos Metaphysik in der UPE-Schrift lehren. Mit Blick auf den individuellen Menschen steht das Rad still mit dem Tod, doch solange es sich dreht, versucht der Mensch das geliebte Objekt einzuholen und ist doch selbst immer schon eingeholt von der Unmöglichkeit seine Jagd erfolgreich abschließen zu können. An diese Unmöglichkeit, an diese Vergeblichkeit ist er gebunden, wie Sisyphos an seinen Stein und doch macht er sich immer wieder sehnsuchtsvoll und hoffnungsfroh auf den letztlich vergeblichen, weil unabschließbaren Weg, um die Vereinigung mit seinem Sehnsuchtsziel zu erreichen.
Eine Begegnung mit unserem dergestalt verfassten Selbst ist ernüchternd und meist versuchen wir, ihr auszuweichen. Doch wenn wir Gott suchen, wenn wir die Wahrheit suchen, dann riskieren wir diese Begegnung, wir riskieren sie auch dann, wenn wir mit offenen Augen lieben und leben.
Weil Strukturähnlichkeit herrscht zwischen all unseren Bestrebungen, also auch zwischen unseren strebenden Bezügen zu einem geliebten Menschen und denen zu Gott, ermöglicht die Beschreibung und das Durchdenken der Seelenzustände der gewöhnlichen Liebe einen verstehenden Zugang zu den Seelenzuständen, die den Gottsucher erwarten.
Fellmann schreibt dazu: „Das ist die ursprüngliche Einsicht, die Bruno aus der Pragmatik der höfischen Liebe für die Bewusstseinstheorie gewonnen hat: Die Leistungen des Bewusstseins beruhen auf seiner inneren Antinomik, durch die die Selbstreflexion zum Dauerzustand wird.“37 Die grundsätzliche Vergeblichkeit unserer Bemühungen um Vereinigung mit dem geliebten Gegenstand konfrontiert uns immer wieder mit uns selbst und wir erkennen – wenn wir dieser Einsicht nicht ausweichen – diese Vergeblichkeit als die grundsätzliche und unaufhebbare Verfasstheit unseres eigenen Seins, ja des Seins überhaupt.
Und noch etwas wird die HL-Schrift aufweisen. Nicht nur dass unser Streben letztlich nie anzukommen vermag, sondern auch, dass die vielen kleinen Strebensziele, die wir uns erwählen auf unserem Lebensweg und das Verhalten und die Affekte, die mit diesem Verhalten verbunden sind, oft sehr unterschiedlich und sogar widersprüchlich sind. Die HL-Schrift handelt also von der Vergeblichkeit und Widersprüchlichkeit unserer strebenden Verhaltungen und der damit verbundenen Gefühlslagen.
Brunos Metaphysik (UPE-Schrift) werden wir entnehmen können: All unser Streben ist eigentlich und letztlich ein Streben nach der göttlichen Einheit, die alle Möglichkeiten, die sein können, auch solche, die sich widersprechen, aktuell realisiert hat und umfasst. Was mit dieser Aussage genau gemeint ist, werden wir zeigen. Ebenfalls wird zu zeigen sein, dass auch wir Menschen – wenn auch meist unbewusst – dieses Ziel im Visier haben und dass die jederzeit vergeblichen Wege, die wir nehmen, um es zu erreichen, widersprüchliches Verhalten und widersprüchliche Affekte umfassen. Diese Widersprüchlichkeiten aber treten mit naturgesetzlicher Notwendigkeit auf, sie sind konstitutiv für unser individuelles Leben, d.h. sie sollen und sie müssen innerhalb der Zeitspanne unserer Existenz ihre Zeit haben.
Zum Verhältnis der UPE-Schrift und der HL-Schrift darf vorweg gesagt werden: Sie bestätigen sich gegenseitig, die Metaphysik die Anthropologie und die Anthropologie die Metaphysik. Die UPE-Schrift liefert die metaphysische Erklärung für die Vergeblichkeit unseres Strebens und die Widersprüchlichkeit unseres Verhaltens und die HL-Schrift, die diese Vergeblichkeit und Widersprüchlichkeit am Beispiel menschlichen Liebesstrebens aufweist, bestätigt mit diesem Aufweis die Metaphysik.
Will man die tugendethischen Überlegungen verstehen, die Bruno in der HL-Schrift anstellen wird, muss man sich bewusst halten: Beides, sowohl die mit der strukturellen Verfasstheit unseres Selbst verbundene Vergeblichkeit unseres Strebens als auch die Widersprüchlichkeit der daraus sich ergebenden Verhaltungen sind bedingt durch allumfassende kosmische Gesetzmäßigkeiten und somit unumgänglich und nicht zu ändern. Wer den Zusammenhang zwischen der Dynamik des kosmischen Geschehens und der Dynamik des eigenen Strebens nach Lust, Liebe und Glück erkennt, dessen Emotionalität bleibt davon nicht unberührt. Das Erkannte macht unsere Leidenschaft tiefer, beständiger, aber auch stiller, ergebener und melancholischer.
Im Folgenden soll auf die UPE- und die HL-Schrift näher eingegangen werden. Sie liegen beide in gut kommentierten deutschen Übersetzungen vor und gehören zu den sechs Dialogen, die Bruno während seines Aufenthaltes in London zwischen 1583 bis Mitte 1585 in kurzer Zeit und in italienischer Sprache verfasst hat. Die Titel dieser sechs Dialoge lauten, in chronologischer Abfolge: „Das Aschermittwochsmahl“ (La cena de le ceneri), „Über die Ursache, das Prinzip und das Eine“ (De la causa, principio et uno), „Über das Unendliche, das Universum und die Welten“ (De l’infinito, universo et mondi), „Austreibung der triumphierenden Bestie“ (Spaccio della bestia trionfante), „Die Kabbala des Pegasus“ (Cabala del cavallo pegaseo), „Von den heroischen Leidenschaften“ (De gli heroici furori).