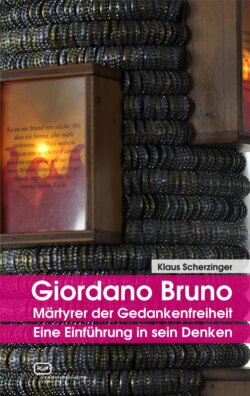Читать книгу Giordano Bruno - Märtyrer der Gedankenfreiheit - Klaus Scherzinger - Страница 15
1.8. Aristotelisch geprägte Wissenschaftlichkeit: Bruno betreibt Metaphysik als Ontologie
ОглавлениеNeben aller Polemik zeigen diese Textstellen, dass eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit metaphysischen Fragen in der Spätrenaissance aufs Engste mit der Philosophie des Aristoteles verbunden war. Wer nicht aus der Quelle des Aristoteles getrunken hatte, konnte nicht eintreten in den Kreis der Wissenschaftler der letzten Dinge.
Aristoteles hatte im vierten vorchristlichen Jahrhundert ein Werk vorgelegt, das nicht nur die schon erwähnten Schriften zur Metaphysik, sondern viele andere Wissensgebieten, darunter Ethik, Poetik, Politik, Physik, Biologie und Seelenlehre umfasste und mit dem er eine von Mythos und Religion unabhängige, eigenständige Wissenschaft erschaffen hatte, „die auf alle Fragen selbst Antwort zu geben und eine Weltdeutung zu bieten imstande war“43. Die Art wie Aristoteles die Erfahrungswirklichkeit denkend erforschte, beherrschte, seit sie wiederentdeckt und durch Albert den Großen und Thomas von Aquin für die christliche Theologie vereinnahmt wurde, das abendländische Wissenschaftstreiben. Weil Aristoteles erstmals vorführte, was es bedeuten kann, Wissen systematisch zu generieren und zu erfassen, ist er im Spätmittelalter und auch noch in der frühen Neuzeit zum „Philosophus“ schlechthin und der Aristotelismus, die Weise also, wie Aristoteles Wissenschaft betrieben hat, zum Vorbild und Inbegriff von Wissenschaftlichkeit überhaupt geworden.
Nehmen wir einmal an, Sie wüssten besser als alle anderen, wie es beim Urknall zugegangen ist. Es würde ihnen niemand zuhören, man würde Sie für verrückt oder zum Esoteriker erklären, sollte es Ihnen nicht gelingen, ihre Ideen auf eine Weise zu begründen und vorzutragen, die als wissenschaftlich gelten kann, weil sie die Kriterien von Wissenschaftlichkeit erfüllt. Diese Kriterien können sich wandeln und haben sich im Verlaufe der Wissenschaftsgeschichte auch gewandelt. Weil Wissenschaft zu Brunos Zeiten begrifflich und methodisch am aristotelischen Vorbild ausgerichtet war, musste sich auch Bruno als Kenner des scholastischen Aristotelismus profilieren, um als Wissenschaftler gelten und mit seinen Theorien Gehör finden zu können. Man merkt der UPE-Schrift diese Absicht an, sie belegt und sollte wohl auch belegen, dass Bruno den von der damaligen Wissenschaft eröffneten Wissensraum überblickte und das begriffliche und methodische, von Aristoteles stammende Rüstzeug so gut zu handhaben wusste, dass er diesen Wissensraum nicht nur virtuos zu durchschreiten vermochte, sondern auch glaubte, es wagen zu dürfen, Ideen zu entwickeln, die ihn sprengten. Letzteres wurde ihm zum Verhängnis, da die Ergebnisse dieser Ideenentwicklung den unantastbaren, christlich-dogmatischen Rahmen, innerhalb dem sich aristotelisch geprägte Wissenschaftlichkeit bewegen durfte und den sie begründen, rechtfertigen und damit festigen sollte, zu zerstören drohte. Nicht gedankliche Nachvollziehbarkeit und Plausibilität, sondern theologische Verwertbarkeit entschied letztlich über die Wahrheit wissenschaftlicher Aussagen und da die Theorie, die Bruno mit der UPE-Schrift vorlegte, um Antwort zu geben auf die Frage nach dem Ursprung und den Prinzipien der Welt, diesen von der Kirche festgesetzten Wahrheiten widersprach, konnte man ihn zu einem schlechten Wissenschaftler, respektive zu einem heterodoxen Aristoteliker stempeln.
Auf aristotelische Art Metaphysik zu treiben, sei es in der Antike oder in der Zeit der Renaissance, sei es heterodox oder orthodox, bedeutet, Seinsphilosophie (Ontologie) zu treiben. Seinsphilosophie ist eine von drei Perspektiven, die das philosophische Fragen einnehmen kann, wenn es nach den Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrungswirklichkeit als ganzer, also auch z.B. nach ihrem Ursprung und Grund fahndet.
Die beiden anderen Blickwinkel bzw. Hauptrichtungen des philosophischen Fragens, wie Arno Anzenbacher sie auch nennt, sind Geist- und Ichphilosophie. Raffael, Schöpfer der „Sixtinischen Madonna“ und vieler anderer Meisterwerke der Hochrenaissance, brachte die ersten zwei der genannten Hauptrichtungen des Philosophierens, Geist- und Seinsphilosophie, in und mit den Handgesten der beiden Zentralpersonen seiner „Schule von Athen“ zur Darstellung. Platons Hand zeigt nach oben und steht für die geistphilosophische Perspektive auf die Wirklichkeit. Sie transzendiert, übersteigt das Ganze der Erfahrungswirklichkeit und sucht nach einem Ideenhimmel oder einem Schöpfergott, um erklären zu können, wie die Erfahrungswirklichkeit möglich werden konnte. Aristoteles steht für einen grundsätzlich anderen Frageansatz. Raffael zeigt den Lehrer Alexanders mit einer Handbewegung, als wolle er Platon, seinem Lehrmeister bedeuten, er möge doch bitte auf dem Boden der Tatsachen bleiben und nicht in die Ferne schweifen. Das Geheimnis der Welt lässt sich auch in der Nähe ergründen, indem das Nachdenken sich mit dem befasst, was uns in der Erfahrung gegeben ist, bei den Dingen also verweilt, ihnen nachdenkt und sie nicht übersteigt. Damit ist nicht schon naturwissenschaftliche Forschung im neuzeitlichen Sinne gemeint, aber Aristoteles hat ihr mit der Seinsphilosophie die Blickrichtung gewiesen und sie auf diese Weise vorbereitet. Das seinsphilosophische Denken „setzt damit an“, sagt Arno Anzenbacher, „dass es von den Erscheinungen aus nach dem Sein fragt, das den Erscheinungen zugrunde liegt. Es fragt also nach den Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung im Nicht-Ich. Das Philosophieren ist hier also primär ontologisch orientiert (Ontologie = Lehre vom Seienden). Es fragt nach dem wahren Sein des Seienden und sucht das Seiende aus seinen letzten Seinsgründen zu verstehen“.44
Die dritte Hauptrichtung des Philosophierens konnte Raffael noch nicht kennen. Die Ich-, bzw. Subjektphilosophie trat erst mit Descartes und dann vor allem mit Kant ihren Siegeszug an. Ich-Philosophie ist Philosophie, die sich mit ihren Fragen nach den Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrungswirklichkeit an das „Ich“ wendet. Mit Blick auf die Frage nach der Subjektabhängigkeit bzw. den im Subjekt liegenden Bedingungen unserer Welterkenntnis hat Kant die zentrale Einsicht subjektivistischer Erkenntnistheorie wie folgt formuliert: Unser „Verstand aber ist ein gänzlich aktives Vermögen des Menschen; alle seine Vorstellungen und Begriffe sind bloß seine Geschöpfe, der Mensch denkt mit seinem Verstande ursprünglich, und schafft sich also seine Welt“45 Anders gesagt: Die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrungswirklichkeit liegen in uns selbst. Wir selbst erschaffen, was wir erleben. Was sich hinter dieser etwas anmaßend klingenden (Erkenntnis-)Theorie verbirgt, was sie meint und wie sie sich begründen lässt, kann an dieser Stelle nicht besprochen werden, vielleicht nur so viel: Raffael ins Heute versetzt, würde Kant sicherlich mit abbilden, müsste er ein Gemälde malen, das die berühmtesten Philosophen zeigt und vermutlich würde er ihn in die Bildmitte rücken, zu Platon und Aristoteles. Auch Kant, so könnte man sich denken, würde eine charakteristische Handbewegung ausführen: Als Dritter im Bunde derer, die maßgeblich für die Hauptrichtungen des Philosophierens stehen, würde er sich selbst mit der Hand an die Stirn tippen.
Dass der Blick nach innen, aufs Ich, der Subjektivismus also, viel älter ist als seine berühmte, kantische Variante, das wird die HL-Schrift belegen, mit ihr allerdings befassen wir uns erst im dritten Kapitel, zunächst wenden wir uns der UPE-Schrift zu, sie ist, weil sie eine wissenschaftlich metaphysische Schrift des zu Ende gehenden 16. Jahrhunderts ist und als solche auch gelten will, in ontologischer Perspektive und mit vielen Bezügen auf Aristoteles verfasst.