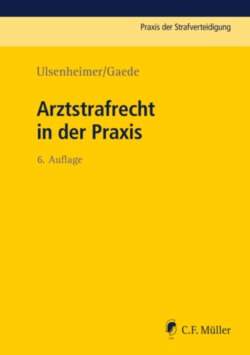Читать книгу Arztstrafrecht in der Praxis - Klaus Ulsenheimer - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
aa) Maßgeblichkeit des Standards
Оглавление72
Deutlich und zutreffend kommt in diesen Urteilen die mögliche inhaltliche Verschiedenheit von Leitlinien, Richtlinien oder Empfehlungen einerseits und dem fachspezifischen Standard andererseits zum Ausdruck, was vielfach von Juristen und Ärzten nicht beachtet wird. Der medizinische Standard – und nicht eine Richtlinie, Leitlinie oder Empfehlung – ist und bleibt im Haftungsprozess der entscheidende Maßstab. Ein besonders instruktives Beispiel für diese Tatsache ist folgende Entscheidung des OLG Düsseldorf.
Beispiel:
Konkret ging es um die Behandlung einer Patientin, die sich gegen Röteln impfen lassen wollte. Der daraufhin durchgeführte Röteln-Test ergab einen Wert, der nach den damals (1978) geltenden Mutterschaftsrichtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen in der Fassung vom 16.12.1974 eine Impfung nicht erforderlich machte. Da die 1980 geborene Tochter der Patientin jedoch die typischen Zeichen einer schweren Rötelnembryopathie aufwies, klagte sie gegen den Frauenarzt mit der Begründung, er hätte im Rahmen der Schwangerenbetreuung weitere Maßnahmen ergreifen, insbesondere den Testwert weiter abklären müssen.
Landgericht und Oberlandesgericht gaben der Klage statt und auch die Revision des beklagten Arztes zum Bundesgerichtshof hatte keinen Erfolg. Übereinstimmend erklärten die Gerichte, der Gynäkologe hätte sich bei der Betreuung der Patientin nicht auf die schon mehrere Jahre alten Mutterschaftsrichtlinien verlassen dürfen. Denn
„aufgrund der Darlegungen des Sachverständigen ist davon auszugehen, dass es auch nach dem damaligen wissenschaftlichen Erkenntnisstand eines Facharztes für Frauenheilkunde und Geburtshilfe geboten war, bei dem erhobenen Wert eine Klärung der Immunitätslage herbeizuführen. Für den Fall eines Rötelnverdachts ergab sich daraus die Notwendigkeit, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um eine Gefährdung des Embryos hinreichend sicher auszuschließen“. [58]
73
Obwohl also unter Zugrundelegung der gültigen Mutterschaftsrichtlinien der betroffene Arzt von einer ausreichenden Immunitätslage der Patientin ausgehen durfte, wurde er rechtskräftig zu Schadensersatz verurteilt, weil es auf den zum Zeitpunkt der Behandlung geltenden „Stand der Wissenschaft“ (Facharztstandard), d.h. das in Wissenschaft und Praxis Anerkannte ankommt. Deshalb sind die Anforderungen an die Fortbildungspflicht des Arztes (näher zu ihr Rn. 132 f.) außerordentlich hoch, er muss die wissenschaftliche Diskussion verfolgen und den jeweiligen „state of the art“ kennen. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen der Wissenschaft muss er kurzfristig umsetzen.[59] Denn der ständige wissenschaftliche und technische Fortschritt führt zwangsläufig dazu, dass die fachlichen Standards nicht etwas Gegebenes, Erreichtes, Abgeschlossenes sind, sondern einem fortschreitenden Prozess, einem ständigen Wandel und Wechsel unterliegen. Eine dauerhafte Übereinstimmung mit dem medizinischen Standard zu erreichen, setzt stetes Lernen und die Bereitschaft voraus, Neues in die Praxis umzusetzen.[60] „Richtlinien, Leitlinien und Empfehlungen geben im Idealfall“ den Standard lediglich „für einen gewissen Zeitraum wieder“.[61] Hinzu kommt, dass bisweilen selbst sog. evidenzbasierte Leitlinien fragwürdig sind, weil sie auf Studienergebnissen beruhen, die – von pharmazeutischen Unternehmen finanziert – nicht streng objektiv sind.[62] Deshalb muss der haftungsrechtliche Behandlungsstandard auch stets – und nicht nur „notfalls“, wie Ziegler meint[63] – von einem medizinischen Sachverständigen ermittelt und dem Gericht bzw. Staatsanwalt erläutert werden (siehe dazu Rn. 134).
74
Bei alledem wird nicht verkannt, dass die strukturierende Wirkung der verschiedenen Regelwerke die Qualität der Krankenbehandlung nicht selten fördern wird. Sie hilft, Über-, Unter- und Fehlversorgung zu vermindern. Indem sie Transparenz schafft, macht sie das Handeln des Arztes medizinisch messbarer und berechenbarer. Zu achten ist jedoch in jedem Fall darauf, dass sich nicht gesundheitsökonomische Ziele mit der lex artis vermischen.[64] Auch wenn nach wie vor die sog. best practice nicht sogleich der Standard sein kann, darf ein medizinisch längst als wissenschaftlich unstreitig überlegen und allgemein praktizierbar erkanntes Vorgehen nicht verdeckt zurückgesetzt werden; vielmehr wäre die Abschwächung aus rein wirtschaftlichen Gründen offen zu legen, damit ggf. eine Debatte um die notwendigen Mittel stattfinden kann. Ferner sollten alle Empfehlungen, Richtlinien und Leitlinien auf die haftungsrechtlichen Konsequenzen mangelnder finanzieller Mittel hinweisen, was derzeit aber leider nicht oder kaum geschieht.