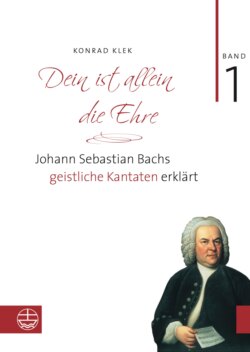Читать книгу Dein ist allein die Ehre - Konrad Klek - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеBWV 135
Ach Herr, mich armen Sünder
3. Sonntag nach Trinitatis, 25. Juni 1724, Thomaskirche
Liedautor: Cyriakus Schneegaß 1597 zu Psalm 6
1. Oboe I/II, Streicher, Posaune mit Bass
Ach Herr, mich armen Sünder
Straf nicht in deinem Zorn,
Dein‘ ernsten Grimm doch linder,
Sonst ist‘s mit mir verlorn.
Ach Herr, wollst mir vergeben
Mein Sünd und gnädig sein,
Dass ich mag ewig leben,
Entfliehn der Höllenpein.
2. Rezitativ Tenor
Ach heile mich, du Arzt der Seelen,
Ich bin sehr krank und schwach;
Man möchte die Gebeine zählen,
So jämmerlich hat mich
mein Ungemach,
Mein Kreuz und Leiden zugericht;
Das Angesicht ist ganz
von Tränen aufgeschwollen,
Die, schnellen Fluten gleich,
von Wangen abwärts rollen.
Der Seele ist von Schrecken
angst und bange;
Ach, du Herr, wie so lange?
3. Arie Tenor Oboe I/II
Tröste mir, Jesu, mein Gemüte,
Sonst versink ich in den Tod,
Hilf mir, hilf mir durch deine Güte
Aus der großen Seelennot!
Denn im Tod ist alles stille,
Da gedenkt man deiner nicht.
Liebster Jesu, ist‘s dein Wille,
So erfreu mein Angesicht!
4. Rezitativ Alt
Ich bin von Seufzen müde,
Mein Geist hat weder Kraft
noch Macht,
Weil ich die ganze Nacht
Oft ohne Seelenruh und Friede
In großem Schweiß
und Tränen liege.
Ich gräme mich fast tot
und bin vor Trauern alt,
Denn meine Angst
ist mannigfalt.
5. Arie Bass Streicher
Weicht, all ihr Übeltäter,
Mein Jesus tröstet mich!
Er lässt nach Tränen und nach Weinen
Die Freudensonne wieder scheinen;
Das Trübsalswetter ändert sich,
Die Feinde müssen plötzlich fallen
Und ihre Pfeile rückwärts prallen.
6. Choral
Ehr sei ins Himmels Throne
Mit hohem Ruhm und Preis
Dem Vater und dem Sohne
Und auch zu gleicher Weis
Dem Heilgen Geist mit Ehren
In alle Ewigkeit,
Der woll uns all‘n bescheren
Die ewge Seligkeit.
Nur einen halben Tag nach der Aufführung der Johanniskantate im Vespergottesdienst erklang am Sonntagmorgen in der Thomaskirche die nächste neue Kantate. Vorlage ist ein Lied zum 6. Psalm, dem ersten der sieben Bußpsalmen. Im Sonntagsevangelium Lukas 15,1 – 10 werden die beiden Gleichnisse vom verlorenen Schaf und verlorenen Groschen mit der Sentenz resümiert: »Also … wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut.« Daran knüpft dieses Bußlied an, das sonst anderen Sonntagen zugeordnet war. In sächsischer Überlieferung galt fälschlich der Thomaskantor Johann Hermann Schein (1586 – 1630) als Autor, so dass das Lied auch für Leipziger Lokaltradition stand. Als Melodie dient die damals viel für Lieder ernsten Charakters benutzte Weise, die heute Dank der Matthäus-Passion Bachs speziell mit O Haupt voll Blut und Wunden in Verbindung gebracht wird.
Der Lieddichter hatte den kurzen Psalm in fünf Strophen gefasst, die sechste ist eine Gloria-Patri-Strophe in Analogie zum Psalmgebetabschluss mit Ehr sei dem Vater. Der Librettist übertrug die Strophen wieder eins zu eins in Kantatensätze und verstärkte weiter die affektiv bereits ziemlich aufgeladene Sprachwelt von Psalm wie Lied.
Der Eingangssatz zeigt wieder eine neue Konzeption. Diesmal hört man von Anfang an die Liedmelodie und zwar in doppelter Weise: von den Streichern unisono als »cantus firmus«, von den Oboen als Bicinium mit den Anfangstönen in Achtelbewegung. Dieser Melodie-Kopf durchzieht als Hauptmotiv den gesamten Satz, ist fast in jedem Takt präsent. Auch die Streicher übernehmen es in vielen Sequenzierungen alternativ zu den Oboen. Durch ihr Unisonospiel wirkt das besonders eindringlich. Die Imitation der Vokalstimmen übernimmt es ebenso, der »cantus firmus« erscheint im Bass, unterstützt vom Continuo, der sonst nichts anderes spielt, zusätzlich hervorgehoben durch mitspielende Posaune wie bei einem Pedal-Cantus firmus der Orgel. Zeile für Zeile wird der Choral vorgestellt, bei den Zwischenspielen zitieren die Streicher die jeweilige Melodiezeile vorab, bisweilen in anderen Tonlagen. Für große Einheitlichkeit sorgt die gleichbleibende Achtelbewegung Ach, Herr, mich armen Sünder. Zwei Liedzeilen fallen aus dem Schmema: Ach, Herr, wollt mir vergeben mit Vorimitation dieser Melodiezeile, ehe der Bass-Cantus firmus einsetzt (der sonst immer das erste Wort hat) und dass ich mag ewig leben mit sinnreich ganztaktig gedehnten Melodietönen im Bass, während sonst Halbe und Viertel im Dreiertakt wechseln und die betonten Silben so zusätzlich beschweren. Inhaltlich ergibt das drei Akzente: Mit dem durchgängigen Hauptmotiv ist der ganze Satz Bußakt eines Sünders; die Bitte um Vergebung ist dabei das Entscheidende und den für rechte Buße gewissen Zielhorizont markiert das ewige Leben. Dass der Cantus firmus besonders markant im Bass liegt, folgt einerseits Bachs Konzeption, bei den Eingangssätzen der ersten vier Choralkantaten die Melodie vom Sopran abwärts durch alle Stimmen zu führen. Symbolisch kann man aber auch die demütig am Boden liegende, um die Zuwendung Gottes flehende Gemeinde der Sünder darin sehen.
Das erste Rezitativ bringt in einer extremen Tenorpartie mit sehr signifikanten Figuren (z. B. schnelle Fluten) die Ausrufung der psychischen Leiden des Beters, was der Librettist mit dem Bild von strömenden Tränen angereichert hat. Die als Ringform gesetzten Ach-Rufe am Beginn und Ende hat Bach jeweils als exponierten Ausruf mit Tritonus-Intervall gesetzt. Die 13 Rezitativtakte verweisen auch auf Psalm 13, der die wie lange?-Klage schlechthin verkörpert.
Die Tenor-Arie im menuettartigen Dreiertakt scheint diese Klagesphäre zu negieren in schönstem C-Dur, mit Terz- und Sextparallen in den Oboen und ungehemmtem Fluss. Der Anfangsvers zitiert kühn das Weihnachtslied In dulci jubilo. Die Präsenz des Liebsten Jesus darf eben alle Tage in Anspruch genommen werden. So lässt die wunderschöne Musik der Arie den Trost bereits als Realität erfahren, um welchen die gesungenen Worte erst bitten. Und sie lässt spüren, was Luther meint, wenn er von der Buße als einer »fröhlichen«, weil heilsgewissen Buße spricht. Der Sänger belegt am Ende die Sechzehntel in den Oboen eindeutig mit Sinn, wenn er Koloraturen zu erfreu singt. In ihrem dissonanzarmen Dreier-Takt ist diese Arie das Gegenbild zum reibungsgeladenen Eingangschor. Beklemmende Momente gibt es aber auch hier, etwa in den krass abfallenden Sprüngen des Tenors zu sonst versink ich in den Tod oder in den zwei Generalpausen zur Todesstille.
Das zweite Rezitativ/Arie-Satzpaar weist ähnliche Gegensätzlichkeit auf. Im Rezitativ klagt der Alt als Stimme des angefochtenen Glaubens mit den Worten von Lied und Psalm sehr expressiv, durch »adagio«-Angabe profiliert: Ich bin von Seufzen müde. Am Ende ist die Rede von mannigfaltiger Angst, Gegenbegriff zum heilsgewissen Glauben, für Christen weiter bedrohliche Realität. Wieder wischt die folgende Arie das einfach beiseite, diesmal im furiosen Kampfgestus der Battaglia-artig agierenden ersten Violinen. Die Vokalpartie übernimmt der Bassist in heldischem Habitus. Das Stichwort Übeltäter bringt die in den Psalmen zentrale Feindthematik ein. Sie können dem Gläubigen aber nichts anhaben, denn – wie in der ersten Arie erbeten – mein Jesus tröstet mich. Bach wechselt bei diesen Worten von a-Moll nach C-Dur und lässt den Bass-Polterer plötzlich lyrisch singen. Bei der Freudensonne geht es eine Dur-Stufe höher nach G-Dur. Das letzte mein Jesus tröstet mich zitiert feierlich vergewissernd die Liedmelodie (zweite Zeile), obgleich der Text kein Liedzitat ist.
Beim mit Achteldurchgängen wieder ziemlich bewegten Schlusschoral hat Bachs Posaunist nun mit dem Cornetto (Zink) die im Sopran liegende Melodie hervorgehoben. Dieser »cantus firmus« bedeutete Bach offensichtlich viel.