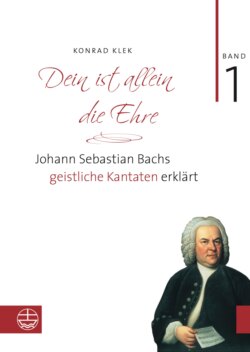Читать книгу Dein ist allein die Ehre - Konrad Klek - Страница 32
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеBWV 178
Wo Gott der Herr nicht bei uns hält
8. Sonntag nach Trinitatis, 30. Juli 1724, Nikolaikirche
Liedautor: Justus Jonas 1524 zu Psalm 124
1. Oboe I/II, Streicher, Horn mit Sopran
Wo Gott der Herr nicht bei uns hält,
Wenn unsre Feinde toben,
Und er unser Sach nicht zufällt
Im Himmel hoch dort oben,
Wo er Israel Schutz nicht ist
Und selber bricht der Feinde List,
So ist’s mit uns verloren.
2. Rezitativ Alt
Was Menschenkraft und -witz anfäht,
Soll uns billig nicht schrecken;
Denn Gott der Höchste steht uns bei
Und machet uns von ihren Stricken frei.
Er sitzet an der höchsten Stätt,
Er wird ihrn Rat aufdecken.
Die Gott im Glauben fest umfassen,
Will er niemals versäumen noch verlassen;
Er stürzet der Verkehrten Rat
Und hindert ihre böse Tat.
Wenn sie’s aufs klügste greifen an,
Auf Schlangenlist und falsche Ränke sinnen,
Der Bosheit Endzweck zu gewinnen;
So geht doch Gott ein ander Bahn:
Er führt die Seinigen mit starker Hand,
Durchs Kreuzesmeer in das gelobte Land,
Da wird er alles Unglück wenden.
Es steht in seinen Händen.
3. Arie Bass Violine I/II
Gleichwie die wilden Meereswellen
Mit Ungestüm ein Schiff zerschellen,
So raset auch der Feinde Wut
Und raubt das beste Seelengut.
Sie wollen Satans Reich erweitern,
Und Christi Schifflein soll zerscheitern.
4. Choral Tenor Oboe d’amore I/II
Sie stellen uns wie Ketzern nach,
Nach unserm Blut sie trachten;
Noch rühmen sie sich Christen auch,
Die Gott allein groß achten.
Ach Gott, der teure Name dein
Muss ihrer Schalkheit Deckel sein,
Du wirst einmal aufwachen.
5. Rezitativ alle Vokalstimmen
Auf sperren sie den Rachen weit,
Bass Nach Löwenart mit brüllendem Getöne;
Sie fletschen ihre Mörderzähne
Und wollen uns verschlingen.
Tenor Jedoch,
Lob und Dank sei Gott allezeit;
Tenor Der Held aus Juda schützt uns noch,
Es wird ihn’ nicht gelingen.
Alt Sie werden wie die Spreu vergehn,
Wenn seine Gläubigen wie grüne Bäume stehn.
Er wird ihrn Strick zerreißen gar
Und stürzen ihre falsche Lahr.
Bass Gott wird die törichten Propheten
Mit Feuer seines Zornes töten
Und ihre Ketzerei verstören.
Sie werden’s Gott nicht wehren.
6. Arie Tenor Streicher
Schweig, schweig nur, taumelnde Vernunft!
Sprich nicht: Die Frommen sind verlorn,
Das Kreuz hat sie nur neu geborn.
Denn denen, die auf Jesum hoffen,
Steht stets die Tür der Gnaden offen;
Und wenn sie Kreuz und Trübsal drückt,
So werden sie mit Trost erquickt.
7. Choral
Die Feind sind all in deiner Hand,
Darzu all ihr Gedanken;
Ihr Anschläg sind dir, Herr, bekannt,
Hilf nur, dass wir nicht wanken.
Vernunft wider den Glauben ficht,
Aufs Künftge will sie trauen nicht,
Da du wirst selber trösten.
Den Himmel und auch die Erden
Hast du, Herr Gott, gegründet;
Dein Licht lass uns helle werden,
Das Herz uns werd entzündet
In rechter Lieb des Glaubens dein,
Bis an das End beständig sein.
Die Welt lass immer murren.
Diese Kantate folgt dem drei Wochen zuvor erstmals umgesetzten Konzept. In den Rezitativen sind Liedzeilen kommentiert, in der Mitte steht eine originale Liedstrophe, als Cantus firmus-Bearbeitung vertont. Da dem Schlusschoral zwei Strophen unterlegt sind, kommen von acht Liedstrophen in wieder sieben Kantatensätzen nicht weniger als sechs wörtlich vor. Das Lied von Luthers Wittenberger Mitstreiter J. Jonas setzt Psalm 124 um. Als einer der ersten reformatorischen Gesänge aus dem Lieder- Geburtsjahr 1524 diente es damals als Schutz- und Trutzlied in den Auseinandersetzungen mit Altgläubigen wie Schwärmern. Jetzt wird es bezogen auf die im Evangelium Matthäus 7,13 – 21 thematisierte Bedrohung durch falsche Propheten.
Dem intimen, konzentrierten Charakter der vorausgehenden Kantate steht hier ein geradezu theatralischer, ausladend extrovertierter Gestus gegenüber. Im Eingangssatz geben die Kampfbilder (Feinde, toben) Anlass, mit den Instrumenten ein Schlachtengetümmel zu malen. Oboen und Streicher agieren zumeist konfrontativ mit Sechzehnteln gegen Punktierungen usw. Der erste Liedeinsatz hält choralartig in großen Notenwerten das Gottvertrauen dagegen, schon in der nächsten Zeile beteiligen sich die Unterstimmen aber mit toben am Kampfgeschehen. Auch im Folgenden sind die Unterstimmen nicht an der Melodie, sondern an den Instrumentalstimmen orientiert. Die gekürzten Noten plus Pause wirken dann wie das Skandieren bei einer Demonstration. Der Sopran, verstärkt von einem Horn, hält unerschütterlich den Cantus firmus dagegen.
Gewissheit im Medium des Cantus firmus erschließt auch das Rezitativ, wo der Alt als heldenmäßig hohe Stimme die Melodiezeilen in Halbenoten bringt. Unterlegt ist dies im Continuo mit presto zu spielenden Achteln, deren Motivik der Melodie entstammt und so den Schrecken verliert, wovon der Text spricht. Die Kommentierungen bekräftigen die Zuverlässigkeit von Gottes Hilfe für alle, die Gott im Glauben fest umfassen. So ist der Alt wieder als Stimme des Glaubens profiliert.
Bei der ersten Arie beschwört der umgedichtete Text im Bild von Meereswellen, die ein Schiff bedrohen, drastisch die Gefahr für Christi Schifflein, also für die Gemeinde und die Gläubigen (Raub ihres Seelenheils). Bach komponiert dazu ein eindrückliches Szenario bedrohtes Schiff auf hoher See, wo alles wankt und drunter und drüber geht. Der Bassist muss sich durch lange Koloraturen kämpfen, um den Kopf über Wasser zu halten. In G-Dur lässt Bach die unisono spielenden Violinen bevorzugt vom Abgrund der tiefen G-Saite aus agieren.
Im Mittelsatz 4 symbolisiert der Choral den Rettungsanker, vorgetragen vom Tenor in hoher h-Moll-Lage. Die Instrumente, zwei Oboen und Continuo im Triosatz, verkörpern dagegen die Anfeindungen. Zum Bild des Nachstellens lässt Bach ein rüttelndes Grundmotiv geradezu penetrant durch die Stimmen wandern. In keinem Taktschlag bleibt man davon unbehelligt, der Sänger erscheint von Feinden umzingelt.
Ebenso penetrant wiederholt im nächsten Rezitativ der Continuo 52-mal (Äquivalent für SATAN) eine Sechzehntel-Figur im gebrochenen Dreiklang aufwärts, bisweilen über die Oktave hinaus gespreizt: Aufsperren sie den Rachen weit. Für das Gegenüber von Liedzeilen und Tropierung wählt Bach eine neue Variante. Das Lied erklingt affirmativ im vierstimmigen Choralgesang, die Zwischentexte, wo auch auf die törichten Propheten aus dem Evangelium verwiesen wird, sind verschiedenen Stimmlagen zugewiesen, jedoch nicht dem Sopran als Cantus firmus-Stimme. (Dies setzt solistische Vokalbesetzung voraus.)
Solchermaßen choralbestärkt kann nun mit einer grandiosen Tenor-Arie die Vernunft als moderner Feind des Glaubens in die Schranken verwiesen werden. Für die taumelnde Vernunft präsentiert Bach eine weitere musikalische Version des Schwankens. Die signifikante Achtel-Wechselnote im ersten Takt ist Grundelement der Gestaltung, die Taktakzente zwischen Streichern und Continuo sind stets verschoben und die Stimmführung lässt auch den Sänger in exponierter Lage taumeln. Harmonische Unklarheit in den e-Moll-Satz trägt ein mehrfach in den Part der Violine 1 eingeschleuster, abfallender Passus duriusculus ein. Der Text benennt dies als Symbol für das Kreuz, Kennzeichen der Christen. Ihr Taumeln ist aber nur scheinbar, denn das Kreuz hat sie nur neu geborn. Das schöne Bild von der offenen Tür der Gnaden bekräftigt Bach mit Kadenz und Zwischenspiel in C-Dur, und der Zuspruch von Trost – bei diesem Wort darf der Sänger über einer Fermate frei kadenzieren – wird nicht mehr durch taumelnde Instrumente gestört. In der Liedstrophe war von Gottes Trost am Anfang die Rede, hier ist er als Pointe platziert. Bachs offensichtliche Lust, bei dieser Kantate in allen Sätzen die Kampfes- und Katastrophenbilder drastisch zu inszenieren, erhält in dieser Arie via Passus duriusculus christologische Tiefenschärfe. Musikalisch malt Bach vor Augen, dass zum Christenleben die Konfrontation mit Gottfeindlichem, die Furcht vor dem Untergang und das Taumeln dazu gehören. Qualifiziert als Kreuzeserfahrung, öffnet sich aber gerade darin die Gnadentür.
Mit den zwei Strophen des Schlusschorals erklingt das Lied insgesamt dreimal im Choralsatz. Über das Cantus firmus-Symbol hinaus erschließt so auch die Bergung in der Choralharmonie den Halt des Glaubens.