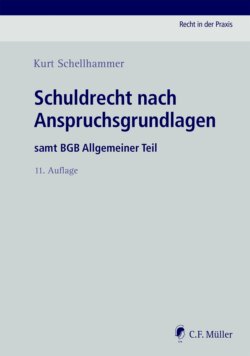Читать книгу Schuldrecht nach Anspruchsgrundlagen - Kurt Schellhammer - Страница 122
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2 Die Herabsetzung des Kaufpreises
Оглавление67
Nach § 441 III „ist der Kaufpreis in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Vertragsschlusses der Wert der Sache in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde“. Soweit erforderlich, ist die Minderung zu schätzen.
Die Minderungsformel respektiert den vereinbarten Kaufpreis und orientiert sich am Wert der Sache in mangelfreiem und in mangelhaftem Zustand[148]. Der Käufer darf nicht einfach den Minderwert der Kaufsache, etwa in Höhe der Nachbesserungskosten, vom Kaufpreis abziehen, sondern muss an der Preisvereinbarung anknüpfen, es sei denn, die mangelfreie Sache ist exakt den Kaufpreis wert[149].
Gemindert wird der vereinbarte Kaufpreis nach der Formel[150]:
| geminderter Kaufpreis = | vereinbarter Kaufpreis × Wert der mangelhaften Sache |
| Wert der Sache ohne Mangel |
Beispiel
Kauft der Käufer für 1 000,– € Ware, die mangelfrei 800,– €, mangelhaft aber nur 600,– € wert ist, muss er nur noch bezahlen:
| 1 000,– × 600,– | = 750,– €. | |
| 800,– |
Stets kürzt die Minderung, anders als die Aufrechnung, den letztrangigen Teil der Kaufpreisforderung[151]. Vollständig erlischt die Kaufpreisforderung nur, wenn der Mangel die Kaufsache völlig unbrauchbar macht[152].
Wer aber setzt den Kaufpreis herab: der Käufer oder das Gericht? Nach § 441 III ist es wohl das Gericht, denn der „Kaufpreis wird nicht schon durch die Minderungserklärung des Käufers herabgesetzt, sondern „ist herabzusetzen“, und auch die Schätzung obliegt dem Gericht.