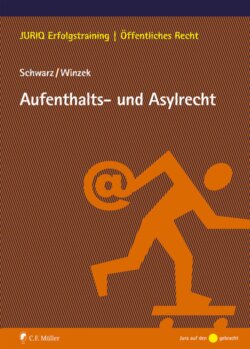Читать книгу Aufenthalts- und Asylrecht - Kyrill-Alexander Schwarz - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2. Teil Das allgemeine Ausländerrecht › C. Beendigung des Aufenthalts
C. Beendigung des Aufenthalts
33
Neben der Einreise und dem Aufenthalt regelt das Aufenthaltsgesetz auch die Beendigung des Aufenthalts. In diesem Abschnitt wollen wir uns daher abschließend mit den gesetzlichen Vorgaben zur Beendigung des Aufenthalts, der Zurückweisung und den staatlichen Instrumenten der Durchsetzung entsprechender Entscheidungen vertraut machen, die das Aufenthaltsgesetz bietet. Im Bereich des Asylrechts bietet das AsylG zusätzliche Instrumente zur Beendigung des Aufenthalts. Eine vertiefende Betrachtung der einzelnen Instrumente und deren Voraussetzungen erfolgt an gegebener Stelle (Rn. 169 ff.). Hier soll nur ein kurzer Überblick über die grundsätzlichen Instrumente des Aufenthaltsrecht verschafft werden.
2. Teil Das allgemeine Ausländerrecht › C. Beendigung des Aufenthalts › I. Beendigung bei Besitz eines Aufenthaltstitels
I. Beendigung bei Besitz eines Aufenthaltstitels
34
Wie wir bereits weiter oben erörtert haben (Rn. 25), erfolgt die Erteilung eines Aufenthaltstitels grundsätzlich lediglich befristet. Aus diesem Grund ist eine Beendigung des Aufenthaltsrecht durch aktives staatliches Handeln in der Regel entbehrlich. Allerdings kann ein einmal erteilter Aufenthaltstitel auch wieder entzogen werden, bevor die Dauer seiner Wirksamkeit abläuft. Darüber hinaus können die zuständigen Behörden einen Ausländer auch trotz gültigem Aufenthaltsrecht unter bestimmten Voraussetzungen ausweisen.
1. Das Erlöschen
35
Wird ein Aufenthaltstitel entzogen, bevor seine Wirksamkeit auf Grund einer Befristung abläuft, so spricht das Aufenthaltsgesetz von einem „Erlöschen“. Für ein Erlöschen kommen mehrere Gründe in Betracht. Zunächst einmal erlischt ein befristeter Aufenthaltstitel mit Ablauf seiner Geltungsdauer. Da es sich bei einem Aufenthaltstitel um einen Verwaltungsakt i.S.d. § 35 VwVfG handelt, kommt auch eine Rücknahme (§ 48 VwVfG) oder ein Widerruf (§ 52 AufenthG als lex specialis zu § 49 VwVfG) in Betracht. Darüber hinaus kann der Aufenthaltstitel auch mit Nebenbestimmungen versehen sein, sodass zum Beispiel auch der Eintritt einer auflösenden Bedingung vorliegen könnte. Es geltend die allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundlagen.
Hinweis
Wir werden weiter unten (Rn. 169 ff.) noch auf die Details von Rücknahme und Widerruf zu sprechen kommen.
Beispiel
Stellt die zuständige Behörde nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis fest, dass die vom Antragsteller gemachten Angaben nicht der Wirklichkeit entsprachen, sodass von vornherein kein Aufenthaltstitel hätte erteilt werden dürfen, so kann sie die Aufenthaltserlaubnis unter den Voraussetzungen des § 48 VwVfG zurücknehmen.
Hinweis
Erlischt ein Aufenthaltstitel, so befindet sich der Ausländer unerlaubt in der Bundesrepublik und ist gem. § 50 Abs. 1 AufenthG i.V.m. § 4 Abs. 1 AufenthG zur Ausreise verpflichtet.
2. Die Ausweisung
36
Der zuständigen staatlichen Stelle steht darüber hinaus das Mittel der Ausweisung nach § 53 AufenthG zur Verfügung.
Die Ausweisung ist die Pflicht, die Bundesrepublik zu verlassen, trotz gültigen Aufenthaltstitels oder gesetzlichem Aufenthaltsrecht.[1]
Lesen Sie die zitierten Normen im Gesetz nach. Es handelt sich um sehr ausführliche Kodifikationen, die größtenteils selbsterklärend sind.
Unter welchen Voraussetzungen eine Ausweisung erfolgt, ist in § 53 Abs. 1 AufenthG geregelt. Das Gesetz geht dabei von einer Abwägungsentscheidung zwischen Ausweisungsinteresse (§ 53 AufenthG) und Bleibeinteresse (§ 55 AufenthG) aus. Auf der einen Seite muss der Ausländer die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die freiheitlich demokratische Grundordnung oder sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik gefährdet haben. Diese Worthülsen werden sodann in § 54 Abs. 1 AufenthG mit Leben gefüllt. So wiegt das Ausweisungsinteresse unter anderem dann besonders schwer, wenn der Ausländer bereits wegen mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig verurteilt wurde (§ 54 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG). Demgegenüber ist das Bleibeinteresse unter anderem dann höher zu bewerten, wenn der Ausländer bereits im Besitz einer Niederlassungserlaubnis ist (§ 55 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG).[2]
Beispiel
Ein Drittstaat-Ausländer, der als Student in Deutschland wohnhaft ist, kann trotz Aufenthaltserlaubnis nach §§ 4 Abs. 1 S. 2 Nr. 2, 7 Abs. 1 AufenthG i.V.m. § 16 Abs. 1 AufenthG auf Grund mehrerer rechtskräftiger Verurteilungen im Sinne des § 54 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG über § 53 Abs. 1 AufenthG ausgewiesen werden, sofern er kein mindestens genauso schwerwiegendes Bleibeinteresse i.S.d. § 55 AufenthG nachweisen kann.
Hinweis
Das Regelungssystem der Ausweisung wurde mit Wirkung zum 1.1.2016 grundlegend geändert. Entsprechend ist die Lektüre von Rechtsprechung und Literatur, die vor diesem Datum veröffentlicht wurde, hinsichtlich dieses Themas nur eingeschränkt nutzbar.
2. Teil Das allgemeine Ausländerrecht › C. Beendigung des Aufenthalts › II. Zurückweisung bereits an der Grenze
II. Zurückweisung bereits an der Grenze
37
Die Bundespolizei kann gem. § 15 Abs. 1 AufenthG einem Ausländer bereits die Einreise an der Grenze verweigern und ihn damit zurückweisen. Die Gründe für die Zurückweisung sind in § 15 Abs. 2 AufenthG und § 18 Abs. 2 AsylG gesetzlich normiert. Die Zurückweisung ist neben der Ausweisung (§§ 53 ff. AufenthG) auch von der Zurückschiebung (§ 57 AufenthG) zu unterscheiden. Bei letzterer ist der Ausländer bereits unerlaubt in das Bundesgebiet eingereist und wurde in unmittelbarem zeitlichen und räumlichen Zusammenhang mit der Einreise aufgegriffen (sog. Schleierfahndung). In diesem Fall soll der Ausländer innerhalb von sechs Monaten zurückgeschoben werden.
JURIQ-Klausurtipp
Das Aufenthaltsgesetz verfolgt demnach folgende Systematik: Ein Ausländer kann unter den Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 AufenthG bereits an der Einreise gehindert werden. Verschafft er sich Zugang zur Bundesrepublik, ohne eine Grenzkontrolle zu passieren, kann er unter den Voraussetzungen des § 57 AufenthG zurückgeschoben werden. Zuletzt kann ein Ausländer, der rechtmäßig nach Deutschland eingereist ist und ein entsprechendes Aufenthaltsrecht innehat, nach §§ 53 ff. AufenthG ausgewiesen werden.
2. Teil Das allgemeine Ausländerrecht › C. Beendigung des Aufenthalts › III. Instrumente zur Durchsetzung
III. Instrumente zur Durchsetzung
38
Wurde einem Ausländer, ob mit Aufenthaltstitel oder ohne, eine Ausreisepflicht auferlegt, so muss er dieser Folge leisten. Tut er dies nicht, steht mit der Abschiebung gem. § 58 AufenthG ein Instrument zur Verfügung, mit dem die Ausreisepflicht zwangsweise vollzogen werden kann.
Die Abschiebung (§ 58 AufenthG) ist der zwangsweise Vollzug der Ausreisepflicht durch Verbringung des Ausländers über die Grenze in ein Land, in das er einreisen kann (i.d.R. das Land seiner Staatsangehörigkeit).[3]
Demnach ist zwingende Voraussetzung für die Abschiebung, dass eine Ausreisepflicht nach § 50 AufenthG vorliegt. Diese kann sich aus den oben genannten Gründen des Erlöschens einer Aufenthaltserlaubnis ergeben oder aus einer Ausweisung (§§ 53 ff. AufenthG). Darüber hinaus muss die Ausreisepflicht auch vollziehbar sein (§ 58 Abs. 1 AufenthG). Zudem dürfen keine Abschiebungsverbote (§ 60 AufenthG) vorliegen. Mit den Einzelheiten dieses Instrumentariums werden wir uns an späterer Stelle aus der Sicht des Asylrechts näher beschäftigen (Rn. 280 ff.).
Beispiel
Fortsetzung des vorigen Beispiels: Mit der Erklärung der Ausweisung nach § 53 AufenthG erlischt der Aufenthaltstitel des Studenten nach § 51 Abs. 1 Nr. 5 AufenthG. In der Folge ist er wegen § 50 Abs. 1 AufenthG unverzüglich zur Ausreise verpflichtet. Kommt er dieser Pflicht nicht freiwillig nach, kann er über die §§ 58 AufenthG abgeschoben werden.