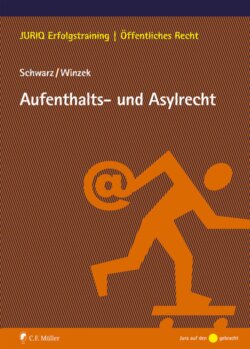Читать книгу Aufenthalts- und Asylrecht - Kyrill-Alexander Schwarz - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3. Teil Das materielle Asylrecht › A. Einleitung
A. Einleitung
39
Nachdem wir uns sowohl mit der Geschichte des Ausländerrechts als auch mit den Grundzügen des heutigen Aufenthaltsrecht in Deutschland und auf völkerrechtlicher Ebene beschäftigt haben, soll in diesem Kapitel nun auf das materielle Asylrecht eingegangen werden. Wir werden sehen, dass das Asylrecht auf verschiedenen Rechtsquellen aufbaut und dass demnach auch verschiedene Asylrechte nebeneinander existieren, die zum einen sehr unterschiedliche materielle Anforderungen aufweisen und zum anderen sehr unterschiedliche Rechte und Pflichten begründen. Die ebenfalls wichtigen formellen Anforderungen an die Gewährung der jeweiligen Asylrechte bleiben hierbei noch außen vor und werden im nächsten Kapitel gesondert behandelt.
3. Teil Das materielle Asylrecht › A. Einleitung › I. Überblick
I. Überblick
40
Kennen Sie noch die Unterscheidung von Territorialhoheit und Personalhoheit? Nutzen Sie die Gelegenheit und wiederholen Sie die Rn. 2 ff.
Wie wir bereits in der historischen Einführung näher erörtert haben, meint Asyl seit der Antike Schutz vor Verfolgung. Wie man diesen Schutz erlangen kann, wo dieser gewährt wird und durch wen sind Fragen, deren Antworten sich im Laufe der Geschichte immer wieder verändert haben. Allerdings ging und geht das Asylrecht stets von einer Institution aus. Denn nur wer die Souveränität über ein Gebiet innehat, kann auf diesem auch Asyl gewähren. Daraus ergibt sich, dass auch heute noch das Asylrecht in erster Linie eine nationale Angelegenheit ist und bis dato kein europarechtliches oder gar völkerrechtliches Asylrecht existiert.
Hinweis
Es sei noch einmal gesondert verdeutlicht, dass ein Asylrecht nur von Staaten ausgehen kann. Zwar existieren auch europäische und andere völkerrechtliche Kodifikationen, die sich dem Asylrecht widmen. Diese verbriefen aber (mit Ausnahme von EU-Richtlinien) gerade kein eigenes subjektives Recht, auf das sich ein Betroffener berufen kann. Diese Kodifikationen wirken sich in der Regel nur mittelbar über eine nationale Norm auf das Asylrecht des Einzelnen aus. Daraus folgt, dass die EU zwar asylrechtlich relevante Kodifikationen erlassen kann, jedoch nur mit dem Ziel, das Asylrecht in den einzelnen Mitgliedstaaten mittelbar zu steuern.
41
Wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln erwähnt, hat sich nach den Weltkriegen parallel zum nationalen auch ein völkerrechtliches und später auch ein europäisches Asylrechtsregime entwickelt. Dieses gilt es unter bestimmten Voraussetzungen auch im nationalen Recht zu beachten und zu gewährleisten. Das europäische Asylrechtsregime dient dabei dem Zweck der Harmonisierung und der Sicherung von grundsätzlichen Standards in den nationalen Rechtssystemen der Mitgliedstaaten. Daraus ergibt sich aber auch, dass das nationale Asylrecht nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern dass es beeinflusst wird von supranationalen Normen, unabhängig davon, ob dies nun europarechtliche oder sonstige völkerrechtliche Normen sind. Aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Rechtsquellen hat sich dadurch mit der Zeit ein komplexes nationales Asylrechtsregime entwickelt, welches vom Schutz vor politischer Verfolgung auf Grund des Asylgrundrechts aus Art. 16a Abs. 1 GG bis hin zum sogenannten internationalen Schutz, der als Ausfluss des Völkerrechts in § 1 Abs. 1 Nr. 2 AsylG einfachgesetzlich normiert ist, reicht. Letzterer unterteilt sich dabei in den Schutz von Flüchtlingen i.S.d. Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) und den subsidiären Schutz i.S.d. Art. 15 RL 2011/95/EU (sog. Qualifikationsrichtlinie).
[Bild vergrößern]
3. Teil Das materielle Asylrecht › A. Einleitung › II. Rechtsquellen
II. Rechtsquellen
42
Zu den Einzelheiten des europäischen Rechtssystems wird auf das JURIQ-Skript „Europarecht“ verwiesen.
Bevor wir in das materielle Asylrecht tiefer einsteigen, soll vorab noch auf das eben angesprochene Verhältnis der verschiedenen Rechtsquellen etwas näher eingegangen werden. Hierbei sei vorweg darauf hingewiesen, dass die nationalen Normen, wie z.B. das Asylgesetz und das Aufenthaltsgesetz, selbstredend unmittelbar Anwendung finden. Als einfaches Recht stehen diese Regelungen allerdings unter dem Rang des Grundgesetzes und damit auch unter Art. 16a GG. Dem Asylgrundrecht kommt demnach eine vorrangige Rolle gegenüber dem internationalen Schutz zu. Dieser Systematik entspringt auch die inhaltliche Struktur des § 1 Abs. 1 AsylG.
43
Näherer Betrachtung bedürfen aber auch die europäischen und sonstigen völkerrechtlichen Normen, die Regelungen bezüglich des Asyls treffen. Denn diese haben, wie wir erörtert haben, wesentlichen Einfluss auf die nationalen Asylrechte. Allen voran ist im sogenannten Unionsasylgrundrecht, dem Art. 18 ChGrEU, die Gewährleistung von Asyl festgeschrieben.
Hinweis
Die EU-Grundrechtecharta beanspruchte zunächst keine rechtliche Bindung der Mitgliedstaaten der Union. Dies änderte sich im Jahre 2009 mit dem Vertrag von Lissabon. Mit diesem wurde in Art. 6 Abs. 1 EUV ein direkter Verweis auf die EU-Grundrechtecharta aufgenommen. In der Folge entfalten die Grundrechte der Charta grundsätzlich auch für die Mitgliedstaaten der Union unmittelbare Wirkung.
Darüber hinaus hat die EU zahlreiche Verordnungen und Richtlinien das Asyl- und Ausländerrecht betreffend erlassen, die hohe Praxisrelevanz aufweisen. Sofern es sich hierbei um Verordnungen, wie z.B. die Dublin-III-VO handelt, finden diese auf nationaler Ebene unmittelbar Anwendung, wie sich aus Art. 288 Abs. 2 AEUV ergibt. Daraus folgt, dass die durch europäische Verordnungen festgelegten Rechte und Pflichten unmittelbar für jedermann in den europäischen Mitgliedsstaaten Geltung beanspruchen. Richtlinien hingegen, wie die Qualifikationsrichtlinie (RL 2011/95/EU), sind nur an die Mitgliedstaaten gerichtet und müssen von diesen erst in nationales Recht transformiert werden. Insoweit geben Richtlinien das erstrebte Ziel lediglich vor und dienen vor allem der Harmonisierung der verschiedenen nationalen Asylrechte der Mitgliedstaaten. Die Form und die Mittel der Umsetzung liegen in der Hand der Mitgliedstaaten, vgl. Art. 288 Abs. 3 AEUV. Entsprechend entfalten Richtlinien keine unmittelbare Wirkung für und gegen jedermann.
JURIQ-Klausurtipp
Merken sollten Sie sich an dieser Stelle, dass Europäische Verordnungen in den EU-Mitgliedstaaten unmittelbar geltendes Recht darstellen, auf die sich der Einzelne direkt berufen kann. Europäische Richtlinien bedürfen dagegen eines nationalen Umsetzungsaktes, sodass sich der Einzelne grundsätzlich nicht auf diese direkt berufen kann.
44
Über das europäische Recht hinaus muss wegen Art. 25 GG auch das allgemeine Völkerrecht beachtet werden. Dem Wortlaut des Art. 25 GG folgend ist entsprechendes Völkerrecht Bestandteil des Bundesrechts und geht den (einfachen) Gesetzen vor.[1] Eines besonderen Umsetzungsaktes bedarf es hier also gerade nicht. Sofern Völkerrecht darüber hinaus in nationales Recht umgesetzt wurde, wie dies beispielsweise bei den Regelungen der GFK oder der EMRK geschehen ist, so gehen die nationalen Umsetzungsakte im Wege der Spezialität den völkerrechtlichen Regelungen vor. Allerdings ist dann aber eine völkerrechtsfreundliche Auslegung des nationalen Rechts nötig, um ein Zurückbleiben des nationalen Regelungsgehaltes hinter dem des Völkerrechts zu vermeiden.
Dieser einfache Grundsatz wirft dann Probleme auf, wenn sich bereits bei der Auslegung des Völkerrechts selbst Fragen ergeben. In diesem Fall muss zunächst geklärt werden, nach welchen Kriterien dieses auszulegen ist. Zur Auslegung völkerrechtlicher Verträge ist grundsätzlich das Wiener Vertragsrechtsabkommen (WVRK) vom 23.5.1969 heranzuziehen. Problematisch ist insoweit jedoch, dass nach Art. 4 WVRK diese selbst nur auf Verträge anwendbar ist, die nach seinem Inkrafttreten vereinbart wurden. Hiervon müssten sowohl die GFK als auch die EMRK ausgenommen sein, da sie vor 1969 vereinbart wurden. Allerdings könnte die WVRK über Art. 25 GG als allgemeines Völkerrecht zu beachten sein, und somit trotz des Art. 4 WVRK anwendbar sein. Nach der Rechtsprechung des BVerfG[2]sind allgemeine Regeln des Völkerrechts dann solche i.S.d. Art. 25 GG, wenn sie von wenigstens der überwiegenden Mehrheit der Völkerrechtssubjekte anerkannt wurden. Da die WVRK von 114 der 193 UN-Mitgliedern (= 59 %) ratifiziert wurde, stellt diese somit ein Bestandteil des allgemeinen Völkerrechts i.S.d. Art. 25 GG dar. Somit sind die Auslegungsregeln der WVRK auch auf die GFK und EMRK anzuwenden.