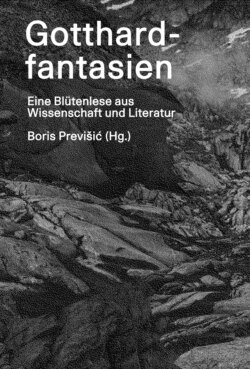Читать книгу Gotthardfantasien - Lars Dietrich - Страница 25
Durchbruch am Berg
ОглавлениеDer Bau der Gotthard-Eisenbahn Ende des 19. Jahrhunderts, eine der ingenieurstechnischen Grosstaten des industriellen Zeitalters, hatte diese Bergregionen in fundamentaler Weise umgestaltet. Da rückte ein Gebiet plötzlich in den Mittelpunkt des Interesses von internationalen Politikern und Bankiers, das sich ja immer schon in der Mitte Europas befunden hatte, auch wenn es sich über lange Zeiten hinweg arg abgeschnitten vorgekommen war. Von den Szenen, die sich beim Bahnbau zwischen 1872 und 1882 abspielten, berichtet Martin Stadler im bebilderten Prosaband Die neuen Postillione. Gemeint sind mit diesen «neuen Postillionen» die Boten des Eisenbahnzeitalters, die den alten Saumweg über den Gotthard nicht mehr benötigten, sondern nun durch den neuen und rekordlangen Tunnel ganz reibungslos binnen Minuten ins Tessin gelangten.
Immer vehementer war in den Jahrzehnten davor die Frage eines Alpendurchstichs für die Eisenbahn erörtert worden, welcher als die konsequente Folge einer überregionalen Verkehrsplanung erschien. Neben dem Gotthard waren auch andere Pässe für die Trassenführung der Bahn im Gespräch, etwa der Simplon oder der Splügen, für den sich vor allem der Bündner Politiker und Ingenieur Simeon Bavier mit Nachdruck einsetzte. Die Priorisierung des Gotthards ging letztlich auf das Betreiben des Zürcher Unternehmers Alfred Escher zurück, der nach seinem Wechsel an die Spitze dieses Bauprojektes 1873 mit dem bekannten Koller-Gemälde von der Gotthardpost geehrt wurde,2 das nochmals eine Szenerie leuchten lässt, die nun bald der Vergangenheit angehören würde.
Der Genfer Unternehmer Louis Favre hatte die Auftragsvergabe für den Tunneldurchstich nicht nur deshalb erhalten weil er als «Fachmann des Tunnelbaus galt», sondern vor allem, weil er niedrige Gesamtkosten und eine Bauzeit von nur acht Jahren kalkuliert hatte (was allerdings dann faktisch nicht eingehalten werden konnte). In den 1870er- und 1880er-Jahren kam ein gewaltiger Aufschwung ins Tal: «Baustellen schossen aus dem Boden, das Handwerk blühte, die Steinbrüche des Reusstales fanden Kunden, Transporte waren nötig, die Beizen machten erhöhte Umsätze, Arbeiter brauchten Unterkünfte.»3 Es entspann sich offenbar seinerzeit eine ganz ähnlich überhitzte und kurzatmige Betriebsamkeit, wie sie die Schriftstellerin Zora del Buono für die jüngste Bautätigkeit im Rahmen des NEAT-Tunnelbaus in ihrer 2015 vorgelegten Novelle Gotthard schildert. Dort memoriert einer der Protagonisten, ein Enthusiast der Eisenbahn und ihrer Geschichte mit dem sprechenden Namen «Bergundthal», unablässig die magischen Gedenkzahlen des früheren, nun schon 140 Jahre zurückliegenden Tunnelbaus und der späteren Durchstiche. «199,19,8»; «199 umgekommene Arbeiter waren es beim Eisenbahntunnel gewesen, 19 beim Autotunnel, und bislang 8 auf der aktuellen Baustelle.»4
Für die schwungvoll angetretenen Protagonisten brachte der Tunnelbau wenig Glück. Louis Favre verstarb 1879, also noch vor dem Durchstich im Februar 1880, und Alfred Escher musste später angesichts eines nicht mehr zu korrigierenden Defizits seiner Gotthardbahn-Gesellschaft deren Vorsitz niederlegen. Als 1882 dann die Strecke mit dem neuen Tunnel fertig war – nach gerade einmal 10-jähriger Bauzeit, was aus heutiger Perspektive durchaus Respekt abnötigt –, zeigte sich die Erfolgsbilanz keineswegs ungetrübt. Ausgerechnet Simeon Bavier, der selbst lange und mit guten Argumenten gegen diese Linie gekämpft hatte, musste, mittlerweile zum Bundespräsidenten der Schweiz avanciert, am 22. Mai 1882 die Gotthard-Eisenbahn im Beisein internationaler Staatsmänner und Ehrengäste feierlich eröffnen. In Luzern fand aus diesem Anlass ein festliches Bankett statt, bei welchem – auch dies ein Rekord eigener Art – «siebenhundert Personen in einem Hotel ein gemeinsames Diner verzehrten».5 Und Stadler ergänzt: «Arbeiter waren keine anwesend an dem rauschenden Feste. Mit ihnen fehlten die Schiffer, Säumer, Karrer, Kutscher und Handwerker der Gotthardroute, die an diesem Tage ihre wirtschaftliche Existenz einbüssten.»
Auf eine sozialgeschichtlich signifikante und politisch bedenkliche Weise begann sich schon vor der Inbetriebnahme des Bahntunnels mit jener Jubelfeier der Auserwählten eine Scheidung zwischen materiellem Transportweg und logistischer Kommunikationsführung zu etablieren. Die mit der raschen Bergdurchquerung ermöglichte Abstraktionsleistung erlaubte es den Reisenden, die hochalpine Engstelle, Wasserscheide und Sprachgrenze hinfort nur mehr als eine vorbeisausende Kulissenwelt wahrzunehmen. Künftig würde die Welt nicht mehr in Gebiete dies- und jenseits des Bergkamms zerfallen, sondern sich an der funktionalen Trennung zwischen topografischer Bindung und nichtterritorialen Verkehrsströmen ausrichten.
Nun galt es, sich entlang der in Rekordzeit passierbar gewordenen Bergstrecken auf neuartige Weise an eine phänotypische Widersprüchlichkeit des Reisens selbst zu gewöhnen, bedeutete doch die möglichst reibungslose Durchquerung eines Gebiets für die Aufmerksamkeitsökonomie der transitorischen Passagiere im Extremfall sogar die tendenzielle Vernichtung der durchquerten Landschaft, ihre Auflösung in den (und mit dem) Bewegungsvorgang selbst.