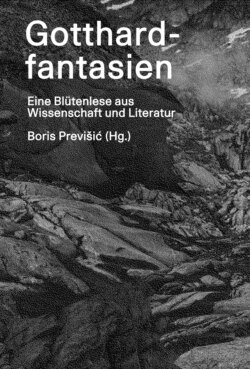Читать книгу Gotthardfantasien - Lars Dietrich - Страница 29
Verena Stössinger Heidelbeeren und der heilige Antonius
ОглавлениеHinter Amsteg, nach der Kurve beim schwarzsteinernen Kraftwerk, das wirkt wie eine Kaserne, ist die Strasse fast leer. Nur ab und zu überholt uns noch ein Urner Auto, und zweimal kommt ein Bus entgegen. Wie eng das Tal hier schon ist. Steil bewaldete Hänge, an denen Nebel klebt; darüber sind manchmal Bergwände sichtbar, weiss gesprenkelt von Schnee. Fast wie in Norwegen, denke ich – habe ich schon am Vierwaldstättersee gedacht, der aussieht wie ein Fjord. Grau und streng. Aber hier sind mehr Laubbäume zwischen den Tannen, und die Häuser sehen sehr anders aus: sind dunkler in ihrem Schindelkleid, geduckter und giebliger. Und es gibt mehr Kirchen.
Intschi, Gurtnellen-Wiler. Strassendörfer, die wirken, als schliefen sie einen tiefen Schlaf. Die Gasthäuser zu, kein Mensch unterwegs, und alles sieht etwas ärmlich aus, aber schon sind die Häuser wieder verschwunden. Die Strasse steigt an. Ziegen weiden auf schrägen Wiesen, wir sehen ihre dicken weissen Hintern. Ein Bauer mäht mit der Sense. Unter der strasse schäumt die weissgraue Reuss zu Tal, in Galerien ziehen Güterzüge und elegante weissrote Fernzüge vorbei, und unter dem Himmel hängt das Betonband der Autobahn. Als wir aussteigen auf einem gekiesten Parkplatz, hören wir erst nur den Lärm der Autos. Er ist lauter als das Tosen der Reuss. Wir schauen uns um. Ein gelber Wanderwegweiser, auf dem Waldboden Brennnesseln, Farn und Erdbeerpflanzen, und «siehst du die Pilze?», fragt Jürgen. Drei verschiedene Arten sind es; er kennt zumindest die eine. Braunweisse Boviste.
In Wassen hat es einen Volg, der offen ist. Wir halten an. Jürgen kauft Birnen und Vogelfutter und ich e Birewegge, die sehr gut riecht. Aber die Tankstelle ist auch hier nicht besetzt; niemand da, der uns helfen kann, den Druckabfall beim hinteren rechten Rad zu korrigieren, auf dem ein gelbes Warnlicht auf dem Display hinter meinem Leihwagensteuerrad beharrt. Wir fahren damit weiter, was bleibt uns übrig; sind auf einmal mit der Autobahn auf gleicher Höhe und sehen, wie sich die Autos, die südwärts fahren, stauen. Sind immer noch Herbstferien? Oder gibt es gar keine Zeit mehr, in der nicht gereist wird? Langsam schon gar, und mit Blick für Unerwartetes? Kurz vor Göschenen finden wir nämlich einen Wunderbaren Stand. Eine Art Kiosk: Berg- und Ziegenkäse gibt es da, Alpenrosenhonig, Rauchwürste, Speck und Heidelbeerkonfi, eingemacht am 1. September 2015, wie auf dem Etikett steht. Wir kaufen Käse und Konfi, denn ja, natürlich: die Heidelbeeren sind aus der Gegend, sagt die Frau im roten Pullover mit eingestricktem weissem Kreuz, die sie verkauft: Sie pflückt sie selbst und mag auch die gezüchteten nicht, obwohl die grösser sind und das ganze Jahr über erhältlich, und wir erzählen von den Beeren, die uns die Schwägerin noch Mitte September vom Luzerner Markt nach Basel brachte. Urner Heidelbeeren aus der Gegend von Gurtnellen waren es. Und während die Verkäuferin wissen will, was die denn da gekostet haben, und zu rechnen beginnt, denke ich wieder an Norwegen. An das Häuschen am Austdalvatnet, wo wir schon fünf lange helle Sommer verbracht haben; erst zu dritt, noch mit Nina, danach zu zweit. Schüsselweise haben wir da Heidelbeeren gegessen, jeden Tag, die Stauden stehen bis vor die Tür, und Jürgen, der sie seit seiner Kinderzeit Blaubeeren nennt, hat jeweils auch Marmelade daraus gekocht auf dem Herd mit dem Holzfeuer und die vollen Gläser dann im Handgepäck nach Hause transportiert, so lange man das noch durfte. Nur einmal hat ihn ein Zöllner am Flughafen angehalten und wollte sehen, was er in der Tasche hatte, die er so sorgsam trug. «Alles Marmelade! Selber gemacht!», sagte er, worauf der Zöllner stotterte: «P-Potz Cheib!»
Heidelbeeren schmecken aber nicht nur gut, sie sind auch sehr gesund. Sie enthalten viel Vitamin C und Antioxydantien, was immer das genau ist, und seien damit geradezu eine «Heildroge»: helfen bei Durchfall, stärken das Immunsystem und befördern die Fruchtbarkeit, und zwar bei Mann und Frau. Der Saft ist ein Gurgelmittel und hilft bei Magen- und Darmgeschwüren, und die getrockneten Blätter, als Tee angesetzt und getrunken, tun gut bei Blasenleiden und senken den Blutdruck. In Nordböhmen wird den Beeren, die an Jakobi, also am 25. Juli, geerntet werden, dabei eine besonders gute Wirkung zugeschrieben, im Allgäu dagegen jenen aus dem «Dreissigst», der Zeit zwischen Mariä Himmelfahrt (15. August) und Mariä Geburt (8. September). Das habe ich in einem alten Buch zur «Geschichte und Volkskunde der deutschen Heilpflanzen» gelesen, und daraus lernte ich auch, dass sich Schwangere in der Umgebung von Karlsbad hüten sollen, «Schwarzbeeren» zu pflücken, um zu verhindern, dass ihr Kind mit schwarzen Muttermalen auf die Welt kommt.
Heidelbeeren heissen nämlich auch Blaubeeren und Schwarzbeeren; und ausserdem nennt man sie Mollbeeren, Wildbeeren, Waldbeeren, Bickbeeren, Zeckbeeren oder Moosbeeren, das habe ich aus Wikipedia. Und es gibt sie auch da, wo ich aufgewachsen bin. Unser Familien-Heubeeri-Revier lag am Nordhang vom Pilatus, im Eigenthal vor allem; da fuhren wir jeweils hin im hellblauen Opel mit dem weissen Dach, und die Behälter, in die hinein gesammelt werden konnte, lagen im Kofferraum bereit. Es waren die Schachteln, in denen die zusammenklappbaren «Doppelmeter» gelegen hatten, die mein Vater an seine Kunden verteilte … und natürlich fällt mir jetzt wie jedes Mal, wenn ich ans Heidelbeerenpflücken denke, die Geschichte von meiner Grossmutter ein.
Meine Grossmutter Anna, die Mutter meiner Mutter, eine schmale, brave Frau, hat einmal beim Heidelbeerenpflücken – wohl eher nicht am Gotthard; sie stammte aus Arth und heiratete nach Luzern – einen Ohrring verloren: Eines der Hängerchen aus Rotgold mit kleinen Granatsteinchen, die rund um einen etwas grösseren angeordnet waren. Wie zu einer Blume. Es waren die einzigen Ohrringe, die sie besass; sie waren ein Geschenk gewesen oder ein Erbstück und sie trug sie immer. Der Verlust war schlimm. Nein, er war unverzeihlich, und sie bekam Angst. Ich weiss nicht mehr, ob sie da schon verheiratet war mit meinem Grossvater, der bei der Polizei war und grobe Hände hatte, oder ob sie sich noch vor dem Zorn ihrer Mutter fürchtete; auf jeden Fall gab es für sie nichts anderes, als den Ohrring zu suchen. Umgehend. Das heisst, ihn zu finden.
Sie ging mit dem vollen Korb den Weg zurück, den sie beim Pflücken gegangen war: immer zwei, drei Schritte talseitig neben dem Pfad (denn bergwärts suchen alle, pflegte sie zu sagen). Sie bog die leeren Sträucher zurück und schaute nach etwas Goldenem, Glänzenden, und als sie lange nichts fand, begann sie zu beten. Rief den heiligen Antonius an, der Verlorenes zu finden weiss, und versprach ihm einen Fünfliber, wenn er ihr half, den Ohrring zu finden. Ging weiter und suchte, man rief jetzt schon nach ihr, «Anni! Wo bisch?»; wenn sie schon verheiratet war, war es ihr Mann, der rief, und da sie wusste, wie schnell er ungeduldig wurde, versprach sie dem Antonius noch einen zweiten Fünfliber. Suchte weiter und tat, als höre sie die immer unfreundlicheren Rufe nicht, «Herrgottsackermänt!», und fand tatsächlich bald darauf den Ohrring. Er hing an einer Staude und baumelte.
In Oberösterreich, heisst es im Buch zur «Geschichte und Volkskunde der deutschen Heilpflanzen», gehe die Sage, dass gerade dort, wo das Volk der Zwerge einschlüpfte, um seine goldenen Schätze im Boden zu bergen, ein Heidelbeerstrauch stand; und weil die Zwerge wegen ihres Reichtums verfolgt wurden, bot der Heidelbeerstrauch ihnen Schutz und versprach, «die Schätze zu verbergen». Meine Grossmutter Anna dagegen hatte das Glück, auf einen Strauch zu treffen, der ihren Schatz, den Ohrring mit der Granatblume, nicht verbarg. Oder ist es doch Antonius gewesen, der ihr geholfen hat?
Der Ohrring jedenfalls war wieder da und der Ärger, den ihr Wegbleiben geweckt hatte, traf sie nicht. Oder nicht wirklich. Wo sie allerdings das Geld hernahm, um ihre Schuld beim Heiligen zu begleichen, weiss ich nicht; ich kann mir bloss vorstellen, wie schwierig es für sie war, es aufzutreiben. Sie hatte bis in ihre Witwenzeit hinein nie eigenes Geld, obwohl sie immer arbeitete, und auch in der Ehe bloss Zugriff auf das Haushaltsgeld, über das Buch zu führen war. Aber vielleicht hat sie mit Antonius auch einen Deal gemacht? Hat ihm irgend etwas anderes versprochen oder ihn auf später vertröstet?
Er muss den Deal akzeptiert haben, denn die Ohrhängerchen gibt es noch. Beide. Meine Grossmutter trug sie, als sie mir die Geschichte erzählte, und sie hat sie uns vererbt, das heisst, der Nina, sobald sie alt genug dafür sei. Und das ist sie natürlich längst, denke ich stolz, während wir nach Teufelsstein und Teufelsbrücke, diesen Schulreise- und Pflichterinnerungsorten, die Haarnadelkurven nach Andermatt nehmen. Auf dem Hochplateau noch den Kreisel, drei Viertel zu umfahren, dann sind wir angekommen. Neben der Strasse liegt Schnee. Ich habe Lust auf einen Kaffee und etwas Süsses. Hoffentlich gibt es die Konditorei noch an der Kreuzung, da, wo die Strasse zum Oberalppass beginnt. Und irgendwo vielleicht sogar eine bediente Tankstelle.