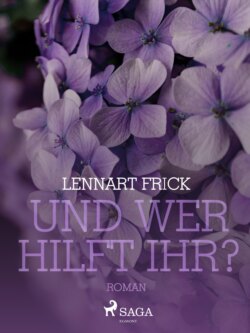Читать книгу Und wer hilft ihr? - Lennart Frick - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление»Es ist vorüber, alles ist vorüber«, denkt sie, als sie aufwacht und plötzlich begreift, daß sie tief und traumlos geschlafen hat. Nur ein vages Bild ist ihr in Erinnerung geblieben. Irgendwann muß sie auch in dieser Nacht hochgeschreckt sein und ängstlich auf ein Kratzen an der Tür gewartet haben. Sie erinnert sich, daß sie aufrecht im Bett gesessen, das Kissen fest an die Brust gepreßt und mit angehaltenem Atem die Stille um sich herum abgehorcht hat, diese totale Stille, die ohne Laut und Bewegung war. Sie erinnert sich auch, daß der Geruch der rauhen Luft sie hatte begreifen lassen, daß sie nicht zu Hause in ihrem Bett lag, daß sie weggefahren war, daß sie keine Angst mehr zu haben brauchte. Mitten im Halbschlaf hatte sie gefühlt, daß sie außer Reichweite war, hierher würde ihr keiner folgen, hier konnte sie völlig allein, völlig sicher sein.
Sie hatte sich wieder in die Kissen gekuschelt, zufrieden sogar mit der feuchten, kalten Luft, die unter das Deckbett drang.
Das Licht des Vormittags hat sie geweckt, das durch das niedrige Fenster mit dem schmalen Baumwollvolant fällt. Als die Tischler dieses Fenster mit den kleinen, quadratischen Scheiben auswechseln wollten, hatte sie sich hartnäckig widersetzt. Zwar ist der Rahmen undicht und verzogen, und außerdem deformiert das alte Glas jedes Bild, doch sie hatte sich schon bei ihrem ersten Besuch hier draußen in das Fenster verliebt und weigerte sich daher, sich von ihm zu trennen.
Es hat schon viel mitgemacht, denkt sie, ich darf es nicht ausrangieren.
Jetzt, als sie aufwacht, ist es fast halb zehn, sie ist völlig ausgeruht, ist nicht vom Wecker aus dem Schlaf gerissen worden. Sie kann sich nicht erinnern, wann das das letzte Mal der Fall gewesen ist, und hat das Gefühl von Luxus und Überfluß. Sie ist sofort hellwach, kann sich jedoch nicht entschließen aufzustehen, sie wickelt das Deckbett fester um sich und spürt, daß ihr Körper in der weichen Wärme völlig entspannt ist. Sie zieht die Beine an und betrachtet im Liegen die eigenartigen, an den Rohrschachtest erinnernden Muster an der Decke, die vieldeutbaren Wasserflecken, die Zeichnungen, die in den Ecken von den Rissen in der Tapete gebildet werden, die schiefen, massiven Türrahmen und die kleine Garderobentür mit dem altertümlichen Riegel. Sie atmet den Geruch ein, der verrät, daß hier seit Monaten nicht geheizt worden ist, und ohne es gesehen zu haben, weiß sie, daß die Ritzen zwischen den bloßen Stämmen in der Garderobe mit einer dünnen Haut Eisrosen überzogen sind.
Alles ist so, wie es sein muß, denkt sie, und leise perlt Freude in ihr auf. Hier ist sie außer Reichweite, hier kann niemand sie finden, hier gibt es niemanden, der sie braucht.
Keiner weiß, wo du bist, denkt sie und kichert leise vor sich hin, während sie die Bettdecke zur Seite schlägt, die Füße in die groben Schisocken steckt, die sie auf dem Stuhl neben dem Bett bereitgelegt hat, und den Morgenrock überzieht.
Auch er ist ein wenig klamm, und bis sich die Haut daran gewöhnt hat, fröstelt sie ein bißchen.
Nun müssen sie zusehen, daß sie, so gut es geht, ohne mich fertig werden. Sie werden meine Klienten aufteilen und auch die Verantwortung für sie übernehmen müssen. Mich interessieren sie einen Dreck, denkt sie, und die Freude nimmt noch zu.
Ihr fällt wieder ein, weshalb sie weggefahren ist, doch das beunruhigt sie jetzt nicht mehr. Daß sie ruhig geschlafen hat und zum erstenmal seit über einer Woche nicht von Alpträumen geplagt wurde, beweist hinreichend, daß sie richtig gehandelt hat. Die Unruhe und die Angst, die sie gejagt hatten, konnten ihr hierher nicht folgen, sie ist frei davon und wird sich nicht wieder einfangen lassen.
Ich habe es geschafft, denkt sie, ich bin schließlich doch noch losgekommen!
In dem gesprungenen Spiegel, der an der einen Längswand über dem weißgestrichenen Waschtisch hängt, nimmt sie flüchtig ihr Gesicht wahr; bei dem Anblick runzelt sie mißvergnügt die Stirn.
Mein Gott, wie sehe ich aus, denkt sie. Ich muß etwas dagegen tun, ich darf mich nicht so gehenlassen.
Das dunkelbraune Haar ist völlig glanzlos und hängt ihr in Strähnen in die Stirn, die Haut ist trocken und schuppig und hat sich unter den Augen zu schweren Tränensäcken gefaltet. Sie befühlt sie mit den Fingerspitzen und registriert wieder einmal das Netzwerk der Runzeln, das sich im Laufe der letzten Jahre herausgebildet hat.
Es ist lächerlich, denkt sie, aber ich mache mir etwas daraus! Sie haben nichts zu bedeuten, trotzdem mache ich mir etwas daraus.
Sie fährt sich mit den Fingern durch das Haar und streicht es hinter die Ohren, sie spürt, daß es sich am Hals kräuselt, und ihr fällt ein, daß sie seit langem keine Zeit mehr für den Friseur gefunden hat. Dann geht sie zum Fenster und öffnet es vorsichtig. Der Rahmen ist schief und rissig, und der Haken ist alt und hängt nur noch lose daran.
Die kalte Morgenluft flutet herein. Sie lehnt sich weit über das Fensterbrett hinaus und atmet tief ein, um auch den letzten Rest der Nachtluft aus den Lungen zu vertreiben. Es ist kühl draußen, und der Nebel hat sich noch nicht verzogen. Von hier oben kann sie ihn auf den Äckern liegen sehen, die das Haus umgeben, er gleicht dünnen Bändern, die langsam, beinahe unmerklich auf- und abwogen. Wie Felsinseln aus einem Meer von schäumendem weißem Gischt ragen die kleinen Hügel aus dem milchigen, feuchten Dunst.
Es ist nicht schwer zu erkennen, denkt sie, daß hier einmal Meeresboden war, und sie versucht, sich vorzustellen, wie die Gegend ausgesehen haben mag, als das Wasser noch hier heraufreichte und gegen die kahlen Felsen klatschte.
Von diesem Fenster aus ist keiner der Nachbarhöfe zu sehen, die liegen auf der anderen Seite, und obwohl sie angestrengt lauscht, kann sie auch keinen Laut von dort vernehmen, kein Hundegebell und keine Traktorengeräusche. Lediglich das leise Rascheln der Ahornbäume unten am Schuppen ist zu hören.
Es ist still, denkt sie. So eine Stille sollte man immer um sich haben.
Dann steigt sie die morsche, knarrende Treppe hinunter, durchquert die große, zugige Diele, die sie sich noch nicht hatte vornehmen können, und geht in die Küche. Sie muß sich ein wenig bücken, um sich nicht den Kopf am Türrahmen zu stoßen, und wieder einmal wundert sie sich über die Proportionen dieses Hauses.
Man muß früher wirklich sehr viel kleiner gewesen sein, denkt sie, diese Türen hier scheinen für Zwerge gemacht.
Obwohl sie keine Übung hat, bringt sie das Feuer bald zum Brennen. Der Herd ist ein alter, rostiger Husqvarna, und zwischen den undichten Ringen kann sie sehen, wie die Flammen im Zeitungspapier aufflackern und dann über die kleingespanten Holzscheite herfallen. Bis der Ofen gleichmäßig zieht, schlängeln sich dünne Rauchfäden durch die Ritzen. Der Geruch erinnert sie an ihre Kindheit, und das läßt sie ein wenig schwermütig werden. Sie sieht den Vater vor sich, wie er, den Rücken ihr zugekehrt, am Herd steht und sich den dickflüssigen und gallebitteren schwarzen Kaffee in seine große, henkellose Tasse gießt, und sie weiß noch, wie still es so früh am Morgen in der Küche war, bevor der Vater gähnend die an der Tür stehenden, schweren Stiefel anzog und leise zum Melken hinausging. Doch sie schüttelt das Bild ab, reibt sich die Hände über dem Herd warm und läßt, vor sich hin pfeifend, Wasser in zwei große Töpfe und den Kaffeekessel laufen.
Ich will mich ordentlich waschen, mit warmem Wasser, denkt sie und erinnert sich, daß sie die Abendtoilette übersprungen hat, daß sie vor Müdigkeit förmlich ins Bett gefallen war.
Zuvor aber war sie noch fleißig gewesen. Sie hatte vom Brunnen zwei Eimer frisches Wasser geholt, danach ein paar Armvoll Holz hereingetragen und es vor dem Herd zerkleinert. Sie war lange aufgeblieben, hatte eine Strickjacke über die andere gezogen und sich bemüht, das Haus warm zu bekommen. Seit ihrem letzten Augustbesuch war sie nicht mehr hiergewesen, und die Novemberkälte hatte sich nur schwer hinausdrängen lassen. Immer wieder hatte sie im Kachelofen oben im Schlafzimmer, im Küchenherd und in dem frischgesetzten Kamin im großen Zimmer bergeweis Holz nachgelegt, doch kurz vor zwölf hatte sie es aufgegeben; sie war von der Fahrt und der Anspannung zu müde gewesen, um noch weiterzumachen.
Nachdem sie den Kaffee aufgesetzt hat, wirft sie sich eine Lodenjacke über und schlüpft in die alten Stiefel, die, noch immer lehmverkrustet vom Augustregen, in der Diele standen. Sie geht zur Küchentür hinaus, sie mag nicht hinunterlaufen bis zum Abort in dem alten Stall, der unterhalb des Wohngebäudes am Fuße des Abhangs liegt, sie kann sich ebensogut hinter das Haus setzen, sie tut das nicht zum erstenmal. Sie hockt sich unter einen der kahlen Apfelbäume, und als der warme Urin dampfend in das frostige Gras rinnt, fühlt sie sich mit einemmal völlig gelöst.
So sollte man es immer machen, denkt sie und lächelt ein wenig bei dem Gedanken an die Kollegen im Büro. Jetzt müßten sie mich sehen können, sie würden ganz schön staunen!
Sie fröstelt in der Kälte, die ihr unter dem Morgenrock und der Lodenjacke die Beine heraufkriecht, bleibt aber dennoch eine ganze Weile auf dem Vorplatz stehen und betrachtet das alte Haus, das zu Anfang des Jahrhunderts erbaut wurde und das Wind und Wetter stark mitgenommen haben. Sie mustert die bejahrten Obstbäume, die trotz ihres Alters noch Früchte tragen – im August hatte sie so manches Kilo geerntet –, und läßt den Blick über die umgebrochenen Äcker schweifen. Der Nebel löst sich allmählich auf, doch der Eindruck von Laut- und Reglosigkeit bleibt. Die Landschaft scheint stillzustehen, scheint Urzeiten anzugehören. Aus weiter Ferne dringt Hundegebell herüber, die Laute sind gedämpft, beinahe unwirklich, und plötzlich erinnert sie sich an das unaufhörliche Brausen, das von der Tegnérgatan herauf in ihr Büro dringt, an den Straßenlärm, der sie so oft gestört hat, an das heftige Hupen und die stechenden, süßen Abgase.
So wie jetzt müßte es immer sein, denkt sie.
Plötzlich glaubt sie, in der Nähe Geräusche, irgendein Knacken vernommen zu haben, hinter dem kleinen Schuppen auf halber Höhe, dem Häuschen mit der alten Tischlerwerkstatt, die sie sich bisher noch nicht einmal näher angesehen hat.
Dort ist jemand, denkt sie und bleibt wie angewurzelt stehen. Sie wagt es nicht, sich zu rühren. In der Morgenstille hört sie ihr Herz eigentümlich laut pochen.
Das ist er, denkt sie, und obwohl sie weiß, wie absurd der Gedanke ist, hilft ihr das nicht; er erschreckt sie, auch wenn ihr klar ist, wie krankhaft und lächerlich das ist.
Und dann meint sie, die ganze Fahrt vergebens gemacht zu haben.
Ich entgehe dem nicht, denkt sie müde. Kalte Schauer laufen ihr über den Rücken, und sie weiß, daß die kleinen Härchen auf der fröstelnden Haut ihrer Arme in diesem Moment kerzengerade in die Höhe stehen.
Dann kann sie die Angst unterdrücken und sich zwingen, zum Schuppen hinunterzugehen. Leise schleicht sie sich über den dünnen Kiesbelag und läuft dann durch das frostkalte Gras bis zur Ecke des Gebäudes. Sie hält sich an der schon recht morschen, früher einmal weiß gestrichenen Eckplanke fest und beugt sich vorsichtig vor.
Ein paar Meter weiter stehen zwei Elche, mitten zwischen den Wacholderbüschen auf der Wiese, die sich bis zum Weg hinzieht. Ihr Fell glänzt im Licht der niedrig stehenden Sonne, und lediglich die feuchtweichen Mäuler und die großen, schweren Ohren bewegen sich.
Sie kann nur mühsam einen Ausruf der Überraschung unterdrücken. Sie hat Elche bisher noch nie aus der Nähe gesehen, und so versucht sie, sich ganz still zu verhalten, um die Tiere nicht zu erschrecken. Dennoch dauert es nur wenige Sekunden, bis sie mißtrauisch werden, erstarren und plötzlich aufbrechen, mit langen wiegenden Schritten zwischen den kleinen Wacholderbüschen davontraben und über den niedrigen, fast völlig zu Boden gesunkenen Zaun hinwegsetzen. Sie sieht sie den halbzugewachsenen Weg überqueren und das gepflügte Feld am Fuße des Illkärrsberges, und dann verschwinden sie in dem morgenkühlen Nebel.
So etwas kann es doch nicht geben, denkt sie und streicht sich mit der Hand über die Stirn, als sei alles nur ein verwirrender Traum gewesen.
Sie merkt, daß die Hand von der Planke feucht geworden ist, und verspürt einen leicht säuerlichen Geruch, wie von Falläpfeln in tauigem Gras, und plötzlich schaudert es sie in der kühlen Luft, und sie läuft schnell über den Vorplatz zurück, um wieder ins Warme zu kommen. Als sie die Außentür hinter sich zuzieht, hört sie das leise Prasseln im Küchenherd.
Es ist nicht zu fassen, denkt sie. Das war ja ganz einfach!
Als sie vor der Spülbank mit dem abgewetzten braunen Linoleumbelag steht und sich wäscht, bemerkt sie mit einigem Erstaunen, daß sie vergnügt, aber gräßlich falsch vor sich hin pfeift. Das Becken ist viel zu niedrig, als daß sie bequem hätte stehen können, doch das macht ihr nichts aus, sie ist wieder ruhig und gefaßt, nichts mehr wird sie aus dem Gleichgewicht bringen. Sie seift sich gründlich ein, und als sie den Schaum vom Körper spült, läßt sie das Wasser auf den Fußboden platschen. Sie tritt mit den Zehen in die Pfützen, ist plötzlich fröhlich und unbeschwert. Sie kennt das Gefühl von den ersten Tagen der Sommerferien her, wenn die Eltern und die anderen Erwachsenen noch keine Zeit gefunden hatten, ihr neue Forderungen zu stellen.
Hier gibt es nur mich, denkt sie, hier brauche ich keinem etwas vorzuspielen.
Dann, als sie sich einige der im Sommer vergessenen Kleidungsstücke überzieht, ein Paar abgewetzte Jeans, ein weiches, mit Malerflecken übersätes Baumwollhemd, das schon seit Tobs Tagen mitmachte, und den dicken Pullover, den sie gekauft hatte, als sie mit Kurt in Bergen war – 1966 mußte es gewesen sein –, trällerte sie laut und fröhlich vor sich hin, und plötzlich hat sie das Gefühl, Stockholm und ihr Leben dort seien abwegig und sinnlos.
Vom Küchenherd hat sich die Wärme allmählich auf den ganzen Raum ausgebreitet, und auch der Kaffee hat sich bereits gesetzt. Sie durchwühlt den Beutel mit den Lebensmitteln, den sie in den kleinen Korridor am Hintereingang gestellt hat, schneidet ein paar dicke Scheiben vom Roggenbrot ab, schmiert ordentlich Butter darauf und säbelt mit dem Finnmesser ein paar ansehnliche Stücke von dem trockenen Västerbottenkäse. Mit den Fingerspitzen nimmt sie die Krümel auf, sie brennen auf der Zunge, und der Geschmack ist noch lange am Gaumen zu spüren. Sie gießt eine große Teetasse voll Kaffee, stapelt die Schnitten darauf und balanciert das Ganze ins Wohnzimmer hinüber.
Merkwürdig, denkt sie, ich bin völlig ruhig, das bin ich lange nicht gewesen.
Sie setzt sich an den rustikalen Klapptisch vor dem niedrigen Giebelfenster und genießt die Proportionen des Zimmers, freut sich über die breiten Dielen, die der Nachbar für sie abgehobelt hat, über den niedrigen Raum, der nur wenig mehr als zwei Meter hoch ist, wodurch die Wärme auf einer für den Menschen günstigen Höhe gehalten wird, über die soliden Türrahmen und das durch die winzigen Scheiben hereindringende Licht.
Dieses Zimmer hatte an jenem Sonnabend den Ausschlag gegeben. Sie hatte die Annonce Ende Mai in »Dagens Nyheter« gelesen und war mehr zum Spaß hier herausgefahren, denn das konnte als akzeptabler Grund gelten, um sich vor den Pflichten zu drücken. Sie hatte sich in dem Augenblick entschieden, als sie diesen Raum betrat. Sie hatte nicht einmal vermocht, den Preis herunterzuhandeln, sie hatte das Häuschen ja ohnehin billig erstanden und war somit endlich das bedrückende Erbe losgeworden.
Hier werde ich ganz ruhig, denkt sie. Hier gibt es nichts, was mich beunruhigen könnte.
Die frischgehobelten Dielen und die blaue Tapete mit den hellen Streifen hatten das Zimmer zum freundlichsten des Hauses werden lassen. Sie hatte es sparsam möbliert, mit alten Möbeln, die sie auf Auktionen erstanden hat, mit einem massiven Klapptisch, einem hohen Sekretär und fünf handgetischlerten, rustikalen Stühlen. Ein niedriges Bücherregal hatte sie ebenso wie das Radio und den Plattenspieler aus der Stadt mitgebracht, und in Norrköping hatte sie sich einen weichen, behaglichen Lesesessel mit einem Bezug aus grobem Leinen beschafft.
Sie kaut die Brote langsam und sorgfältig, der Kaffee ist kochendheiß, und der scharfe Käse brennt auf der Zunge.
Ich habe gestern zuviel geraucht, denkt sie. Ich habe mir auf der Fahrt ja eine Zigarette nach der anderen angezündet.
Ihre Zungenspitze ist noch immer ein bißchen empfindlich, und sie erinnert sich an die qualvolle Unlust, von der sie unterwegs gepeinigt wurde, an die hektischen Blicke in den Rückspiegel, an die Angst, die sie bei dem Gedanken überlief, sie werde verfolgt und bald eingefangen werden.
Ich war hysterisch, denkt sie und versucht, sich von dem Gewesenen zu distanzieren, ich wußte nicht, was ich tat, ich war aus dem Gleichgewicht geraten, das ist alles.
Doch plötzlich verkrampft sich ihr Magen, ist das Entsetzen wieder da, das sie übermannt hatte, als sie einen Blick unter das Laken geworfen, sein bleiches Gesicht auf der Trage erkannt und das blutige Handgelenk gesehen hatte, und sie wehrt sich gegen die Erinnerung.
»Bleib ruhig«, sagt sie halblaut vor sich hin, und ihre Stimme klingt unpersönlich, ist ganz die der Fürsorgerin, es gibt absolut keinen Grund zur Panik.
»Jetzt ist alles vorüber«, fügt sie lauter hinzu, und sie merkt, daß ihre Lippen trocken und aufgesprungen sind, daß sich die Worte gleichsam ineinander verhaken und in diesem Milieu eigentümlich fremd klingen. »Jetzt kannst du in Ruhe über alles nachdenken, das Schlimmste hast du überstanden.«
Geh aber systematisch vor, ermahnt sie sich. Dann gibt es nichts, wovor du erschrecken mußt.
Und sie braucht sich ja nur auf dem Stuhl zurückzulehnen und die Augen zu schließen, dann quellen die Erinnerungen sofort hervor, das weiß sie seit langem, denn so ist es bei ihr immer gewesen. Und wie pflegt sie doch zu den zögernden Klienten zu sagen, zu denen, die sich verschließen, die sich nicht trauen, frei zu reden, die nicht wissen, womit sie beginnen sollen?
»Fangen Sie irgendwo an«, ermuntert sie dann, »Sie kommen schon zu dem, was Sie sagen wollen.«
Das hilft meistens, denkt sie, ich beherrsche die Kniffe meines Berufes, ich weiß, wie man es macht. Nachdem sie ein wenig drumherumgeredet haben, kommen sie schließlich doch zum Wesentlichen.
»An und für sich habe ich gar keinen Grund, Sie aufzusuchen, doch ich meinte, daß ...«
»Sie müssen nicht glauben, daß ich zu denen gehöre, die ständig Hilfe benötigen, aber ...«
»Sie finden es sicher lächerlich, doch ...«
»Liebe Frau Lundell, Sie dürfen mich nicht auslachen ...«
So reden sie alle, denkt sie, und sie wissen nicht, wie oft ich ihre Geschichte schon gehört habe.
Sie selbst weiß nur zu genau, wo sie zu beginnen hat. Denn das Ganze fing ja wohl am sechsten November an, das war ja wohl der Tag, an dem sich in ihrer gewohnten Sicherheit plötzlich Risse zeigten, an dem diese Sicherheit von innen heraus zu bröckeln begann. Am sechsten November also, am Montag, dem sechsten November 1972. Gut eine Woche war es her, daß sich der erste Riß gebildet hatte.
Doch sie fühlt, daß das nicht genau stimmt, und die Unruhe läßt ihr Herz immer heftiger klopfen, läßt das Schlagen zu einem nervösen, ungleichmäßigen Flattern werden.
Du hast es hinter dich gebracht, denkt sie, du bist mit heiler Haut davongekommen. Doch du darfst nicht vergessen, die Krise zu rekonstruieren, du mußt sie auch bearbeiten. Sie grinst voller Selbstironie, als sie die Floskeln ihres Berufes wiedererkennt und feststellen muß, daß die Sprache sie fest in ihrem Griff hält.