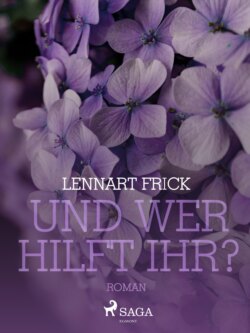Читать книгу Und wer hilft ihr? - Lennart Frick - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSie schaltete das Besetztzeichen über ihrer Tür ein, legte den Hörer neben den Apparat und griff nach einer Zigarette.
Agneta Roslund – sie konnte sich nur allzu gut an sie erinnern. Als erstes war ein Brief an den Rundfunk gekommen, dann hatte sie sich ihrer außerhalb der Reihe angenommen. Solche Fälle wurden vom Büro normalerweise nicht berücksichtigt, Barbro sortierte sie meistens schon beim ersten Anruf aus. Das Personal hätte verdreifacht werden müssen, wenn sie sich auch noch um alleinstehende Personen mit Kontaktschwierigkeiten kümmern sollten.
Doch Agneta hatte im Frühjahr einige Male nach Feierabend heraufkommen dürfen. Kristina hatte die junge Studentin nicht abweisen können. Das verweinte, blasse Gesicht, das lange, glanzlose Haar – es war ihr wie ein Bild aus der eigenen Vergangenheit vorgekommen, und sie hatte nicht gewagt, das Mädchen wegzuschicken, obwohl das eigentlich ein Fall für den Studentenfürsorger gewesen wäre.
Rein mechanisch suchte sie ihre Aufzeichnungen über den Fall heraus, doch sie brauchte gar nicht erst hineinzusehen. Sie erinnerte sich an alles, an die ganze banale Geschichte des Mädchens vom Lande, das mit der Umstellung auf das Großstadtleben nicht fertig geworden war. Agneta war neunzehn, kam aus einem Dorf bei Ljusdal und studierte seit dem Herbst 1971 in Stockholm. Sie bewohnte ein Zimmer im Studentenheim in Kungshamra und wagte sich dann und wann zu den Vorlesungen nach Frescati, doch die meiste Zeit über hielt sie sich, von Minderwertigkeitsgefühlen geplagt, versteckt. Im Hintergrund standen die Eltern mit enormen Erwartungen. Sie hatte das Gymnasium mit guten Ergebnissen abgeschlossen, und auch im ersten Semester in Stockholm schien alles einigermaßen zu klappen. Doch dann war sie festgefahren, war bei einigen Zwischenprüfungen durchgefallen und hatte nicht gewagt, zu den Nachprüfungen zu erscheinen. Den größten Teil des Frühjahrssemesters hatte sie sich von der Umwelt ferngehalten. Sie hatte einen Notruf an den Fragebriefkasten des Rundfunks gesandt, und während der ersten Besuche im Büro hatte sie fast nur geweint. Dann war es möglich geworden, mit ihr zu reden, und Kristina hatte ein eigentümliches Gefühl der Zärtlichkeit für dieses völlig wehrlose Mädchen empfunden.
Ende Mai hatte sie sie überreden können, einer Konfrontation mit den Eltern im Sommer auszuweichen, ganz woanders hinzufahren und ihr Selbstvertrauen unter weniger anspruchsvollen Bedingungen zu trainieren. Sie hatte ihr in Norwegen einen Platz in einem Sommerkurs für Interessenten der allgemeinen Geologie besorgt.
»Pfeif auf die Bücher«, hatte sie ihr geraten. »Es ist wichtiger, daß du lernst, mit anderen umzugehen, als daß du dich kaputtmachst, um all das nachzuholen, was du in diesem Jahr versäumt hast.«
Im Sommer hatte Agneta ein paar fröhlich klingende Ansichtskarten geschickt, die den Anschein erweckten, alles verlaufe planmäßig, doch als sie Ende September wieder vorbeikam, war sie in einem miserablen Zustand. Noch ehe sie ihr Geständnis schluchzend herausgebracht hatte, wußte Kristina, was kommen würde: Die leidenschaftliche Schwärmerei für den Kursusleiter und dann, nachdem alle gefeiert hatten und ein wenig beschwipst waren, der nicht sonderlich geglückte Beischlaf. Und nun bekäme sie natürlich ein Kind und wage nicht, mit dem Mann in Verbindung zu treten, denn er sei verheiratet und sie wolle das Kind nicht, aber wisse auch nicht, was sie tun solle ...
Und an Verhütungsmittel habe sie wohl nicht gedacht?
Nein, die Pille getraue sie sich nicht zu nehmen, denn sie habe gelesen, es könnten sich Blutgerinsel bilden, ein Pessar besäße sie nicht und an ein Kondom habe sie nicht gedacht.
»Ich wollte nicht über so etwas reden, um nichts kaputtzumachen«, hatte Agneta schluchzend gestanden und sie mit verweinten Augen angesehen. »Ich konnte doch nicht ahnen, daß gerade ich so schnell schwanger werden würde!«
Sie kannte diese Geschichte, in den Jahren, in denen sie im Fürsorgeamt gearbeitet hatte, war sie bis zum Überdruß damit konfrontiert worden, und als sie die Formulare für den Abort-Antrag hervorsuchte, hatte sie sich beherrschen müssen, um nicht ihren Ärger zu zeigen.
»Du weißt wohl, daß du das Kind nicht zu bekommen brauchst?« hatte sie gefragt.
»Ja, deshalb bin ich ja hier. Könnten Sie so freundlich sein?«
Nachdem sie das Mädchen zur Tür begleitet und die notwendigen Telefonate geführt hatte, kam sie sich plötzlich schäbig vor – als hätte sie nur deshalb so resolut gehandelt, weil sie die ganze Angelegenheit so schnell wie möglich vom Tisch haben wollte. Sie wußte, daß das nicht stimmte, daß sie nur getan hatte, was in solchen Fällen zu tun war, doch sie wurde das Gefühl der Unsicherheit nicht los, den Verdacht, daß gerade dieses Mädchen die Ausnahme war.
Ich hätte es vielleicht nicht so eilig haben dürfen, hatte sie gedacht. Doch schließlich muß sie selbst es entscheiden. Sie hat noch Zeit, sich die Sache zu überlegen.
Ein paar Wochen später hatte eine Kollegin vom Fürsorgeamt sie angerufen und ihr mitgeteilt, daß der Abort nicht komplikationslos verlaufen sei und daß Agneta Roslund nun unter schweren Depressionen leide, völlig apathisch geworden sei und sich weigere, nach Hause zu fahren. Kristina hatte Clas angerufen, und es war ihr gelungen, für Agneta einen Platz in der psychologischen Klinik des Karolinischen Krankenhauses zu bekommen, und dann hatte sie die ganze Geschichte aus ihren Gedanken zu verdrängen versucht, sie hatte anderes zu tun, als über ehemalige Klienten nachzugrübeln.
»Und jetzt das!« murmelte sie vor sich hin. »Doch es war nicht meine Schuld, ich konnte ja nicht wissen ...«
Im Laufe ihrer Tätigkeit im Fürsorgeamt hatte sie sich zu der Erkenntnis durchringen müssen, daß ein Abort, der schnell und ohne aufrèibendes Moralisieren durchgeführt wurde, in Fällen wie diesem im allgemeinen vorzuziehen war. Früher, als sie noch Fürsorgerin an der Neuen Grundschule gewesen war, hatte sie vor jedem Abort-Antrag eine Heidenangst gehabt und die Entscheidung bis zuletzt hinausgezögert, doch als die Mädchen immer jünger und die Schwangerschaften immer häufiger wurden, hatte sie den Versuch aufgegeben, die ethischen und moralischen Konsequenzen mit ihren Klientinnen zu diskutieren. Die Gespräche waren nur aufreibend und voll von Vorwürfen gewesen, und sie mußte erkennen, daß sie die Situation der Hilfesuchenden erschwerten, viele wurden unschlüssig, viele schienen danach von Reue gepackt zu werden, von Gewissensqualen, die sich oft in Angriffen auf diejenige äußerten, die die Sache organisiert hatte.
Um die Realität so zu sehen, wie sie ist, hatte sie trotzdem beim Fürsorgeamt angefangen, und die zwei Jahre dort hatten die letzten Reste ihres Zögerns hinweggefegt. Vor dem anschwellenden Strom von Antragstellern gab sie auf: vor den mageren Grundschulmädchen, die träge und kaugummikauend mit der Standardbescheinigung ihrer Schulfürsorgerin an ihr vorbeizogen, den vielen Jugendlichen, die gerade erst ins Berufsleben getreten waren und nun zu ihr kamen, um den ersten, zweiten oder dritten Abort zu beantragen, den Frauen im mittleren Alter, die nach der Urlaubsreise in den Süden voller Panik angestürzt kamen. Sie war nicht imstande, sich in die einzelnen Fälle zu vertiefen, sie glichen einander allzusehr, da war nirgends etwas auszurichten, und sie beschränkte sich darauf, die Anträge auf Auskratzungen und andere Eingriffe schnell und ohne unnötige Wartezeit und peinliche Fragerei zu erledigen.
Ja, sie hatte gelernt, mit diesen Fällen fertig zu werden, und auch wenn sie routinemäßig Broschüren über Verhütungsmittel verteilt und die Jüngsten in vielen Fällen mit kostenlosen Kondomen beinahe überschüttet hatte, tat sie es doch ohne große Hoffnung auf Erfolg.
Sie kriegen es einfach nicht fertig, hatte sie manchmal gedacht. Sie wollen nicht den Eindruck erwecken, durchtrieben und berechnend zu sein, und so die Gefühle zerstören.
Sie erinnerte sich, was das zwölfjährige Mädchen aus Gubbängen auf die Frage geantwortet hatte, warum sie denn nicht darauf achte, daß die Jungen Kondome benutzen.
»Wenn man verliebt ist, will man doch nicht an so etwas denken!«
Und nun das mit Agneta Roslund! Es kam ungelegen und unerwartet. Sie konnte nichts gegen das Unbehagen tun, das plötzlich in ihr aufstieg, und sie fühlte sich fast so unsicher wie in den ersten Jahren nach der Sozialhochschule. Dieses Gefühl rief einen unangenehmen Geschmack im Mund hervor, brachte sie aus dem Gleichgewicht, ließ all die Erinnerungen auf sie einstürzen, die zu verdrängen sie gelernt, die zu vergessen sie sich gezwungen hatte. Doch sie wollte sich nicht erinnern. Sie stand vom Schreibtisch auf und ging hinüber zur Toilette, um zu gurgeln und sich das Gesicht mit kaltem Wasser abzuspülen.
Doch das Unbehagen saß tiefer, es hatte mit vernarbten Erinnerungen zu tun, mit den Gerüchen einer Klinik in einer Gasse in Kopenhagen, mit einer kalten Sonde in den harten, gefühllosen Händen eines fetten, nach Bier stinkenden Arztes, der hinter dem Mundschutz Unverständliches vor sich hin brummelte; mit den verächtlichen Blicken einer Nachtschwester, die sie aus dem Operationszimmer hinausgeführt hatte und in einem kalten Zimmer mit einem feuchten Bett zurückließ; mit einer langen, ermüdenden Zugfahrt, während der sie wieder und wieder auf die Toilette laufen mußte, um die vollgesogenen Binden zu wechseln; mit dem ohnmächtigen Versuch, das Gesicht zu wahren, als einer ihrer Lehrer zustieg und sich mit ihr die ganze Strecke von Ånge nach Östersund lebhaft über die Sportferien unterhielt. Und es hatte mit dem Anruf nach Hause zu tun, als sie ihrem Vater mitten im Monat dreihundert Kronen zusätzlich abnötigen mußte, für Literatur, wie sie sagte, die sie vor dem Abitur noch unbedingt brauchte, mit seiner Ratlosigkeit und seinem Seufzer, bevor er zustimmte; und auch mit den Gesprächen mit Sigfrid, dem Aushilfslehrer in Deutsch, mit seinem Erröten und Stammeln, als er die restlichen fünfhundert zusammengekratzt und sie weinend angefleht hatte, diese Reise zu unternehmen. Ja, vor allem erinnerte sie sich wohl an seine zitternde Feigheit, seine Angst davor, die Unachtsamkeit könne offenbar werden, an seine plötzlich gute Laune, als sie nachgab, und ihre unbändige Verachtung für ihn, als die Sache vorüber war. Und da war auch ihre tränenvolle Angst auf der Fahrt nach dem unbekannten Kopenhagen und die Leere und Kälte in ihr auf der Heimreise, als alles vorbei war und sie allein um die brennenden Schmerzen wußte. Sie hatte es nicht bereut; der Schleimklumpen, der ihre ganze Zukunft hätte zerstören können, war weg, übriggeblieben war nur der kühle Entschluß, niemals jemandem davon zu erzählen, und die Erkenntnis, das Geheimnis ganz allein tragen zu müssen. Auf der langen Reise in dem rüttelnden Sitzwagen war ihr das immer klarer geworden, und als sie im Schneegestöber aus dem Zug stieg und den Kindesvater hinter das Bahnhofsgebäude entwischen sah, hatte sie ein kaltes, triumphierendes Gefühl der Kraft in sich verspürt, hatte die Gewißheit sie erfüllt, daß nichts mehr sie unterkriegen würde, daß sie niemandem mehr erlauben würde, sie zu Boden zu drücken, daß sie sich niemals so feige und erbärmlich verhalten würde, wie er es getan hatte, daß sie stark sein würde, sehr stark.
Damals hatte sie sich endgültig für diesen Beruf entschieden, und als sie jetzt in der Toilette stand und den unangenehmen Geschmack loszuwerden trachtete, sah sie ihre Eltern vor sich, wie sie in ihren blankgewetzten und unmodernen Sonntagskleidern feierlich steif im Gewühl vor dem Tor des Gymnasiums gestanden und pathetisch die Blumensträuße umklammert hatten, und sie dachte daran, wie verloren die beiden ausgesehen hatten.
Sie hörte noch den Stolz in der Stimme des Vaters, als er zu Hause auf der Vortreppe den Nachbarn ihre Zukunftspläne entwickelte. »In dem Mädchen steckt etwas! Sie wird denen da oben schon zeigen, was wir wert sind!«
»Du darfst nicht sentimental werden, das führt zu nichts«, sagte sie halblaut vor sich hin, und als ihr bewußt wurde, daß jemand vor der Tür stehen und lauschen könnte, zog sie heftig an der Spülung.
Du mußt einen klaren Kopf behalten, dachte sie, wenigstens du mußt damit fertig werden!
Gleich nach der Mittagspause, als sie unten im Konsum für die ganze Woche eingekauft und noch Zeit gehabt hatte, in dem kürzlich umgebauten Restaurant »Tre bockar« rasch einen Kaffee zu trinken, fiel ihr auf dem Weg zur vierten Etage, wo am Nachmittag die Versammlung stattfinden sollte, wieder ein, was Elisabet am Morgen gesagt hatte. Sie machte kehrt und ging hinunter zu Barbro Wallin, der Leiterin des Büros, zu deren Aufgabenbereich es unter anderem gehörte, die Klienten auf die elf Fürsorger aufzuteilen. Barbro war die Älteste im Büro, sie wurde bald sechzig, war aber noch immer äußerst interessiert an ihrer Arbeit; noch immer voller Enthusiasmus über die Bedeutung der Familienberatung. Sie hatte einen Zug von Idealismus an sich, der Kristina zuweilen irritierte, doch ihre jahrzehntelange Erfahrung hatte ihr eine Autorität verliehen, die niemand in Abrede stellen konnte.
»Gut, daß du hereinschaust«, sagte Barbro, die gerade dabei war, die Notizen über die Fälle zusammenzusuchen, die aller Wahrscheinlichkeit nach auf der Sitzung zur Sprache kommen würden. »Ich habe da ein Problem. Du weißt ja, daß Svea nächste Woche frei hat, sie will mit ihren Eltern eine Autotour durch Dänemark machen. Kannst du einspringen und ihr einen Fall abnehmen? Die Klientin kommt das erstemal und hat schon einen Termin für Montagvormittag.«
»Jaa«, antwortete sie zögernd, »ich könnte schon, obwohl es mir lieber wäre, wenn ich es nicht brauchte. Ich habe morgen schon einen Besuch, und die verbleibende Zeit wollte ich für den Rundfunk nutzen, mir fehlt noch das Manuskript für die nächste Sendung. Ist es etwas Besonderes?«
»Nein, ganz und gar nicht«, antwortete Barbro und zog bekümmert die Stirn in Falten, »sie will nur etwas über die juristischen Konsequenzen einer Scheidung wissen. Doch wenn du nicht willst, dann geht es wohl ...«
»Nein, nein, ich übernehme das schon«, fiel sie rasch ein, »es scheint ja nicht weiter kompliziert zu sein. Für den Rest des Tages werde ich allerdings das rote Lämpchen einschalten.«
»In Ordnung, Kristina«, sagte Barbro, und ihr Gesicht hellte sich auf. »Man kann sich eben auf dich verlassen. Sie kommt um elf.«
Ich bin zu gutmütig, geradezu töricht, dachte sie, als sie dann gemeinsam die Treppe zu dem neueingerichteten Sitzungszimmer im obersten Stockwerk hinaufstiegen. Ich bringe es wohl niemals fertig, nein zu sagen.
Fast die ganzen zwei Stunden, die die Beratung dauerte, saß Kristina schweigend da. Normalerweise pflegte sie ihre Gesichtspunkte eifrig darzulegen, sie selbst war eine derjenigen gewesen, die sich für die einmal in der Woche stattfindenden Besprechungen mit allen Angestellten und den vier Experten eingesetzt hatte, die als ständige Berater des Büros fungierten. Sie wußte, daß die Zusammenkünfte von Nutzen waren, daß sie dem einzelnen Mitarbeiter die Möglichkeit boten, Fälle, bei denen er nicht weiterkam, aus neuer Sicht zu sehen, daß sie zu der Offenheit beitrugen, die die Arbeitsatmosphäre in hohem Maße bestimmte. Doch heute war ihr die ganze Angelegenheit zuwider. Sie hatte das Gefühl, so etwas schon zu oft mitgemacht zu haben, und es gelang ihr, den plötzlich aufsteigenden Wunsch zu unterdrücken, den Roslund-Fall zur Sprache zu bringen.
Sie wußte noch immer zuwenig über das, was wirklich geschehen war, und war außerdem unsicher, wie sie die Sache darlegen sollte, denn Agneta war ja eigentlich ihre private Klientin. Außerdem befürchtete sie, man könne den Fall als Mißerfolg für sie werten. Sie wußte ja, daß einige der älteren Fürsorgerinnen ihre Arbeitsweise noch immer (und das nach sieben Jahren) ein wenig skeptisch betrachteten. Als sie hier angefangen hatte, war sie von allen die Jüngste gewesen und zudem unverheiratet. Das hatte genügt, um die Älteren gegen sie einzunehmen. Sie wußte, einige waren der Ansicht, sie sei arrogant und überheblich, und ihr war auch bekannt, daß ihre Privilegien – die Freistellungen für Konferenzen und die Arbeit beim Rundfunk – immer mal wieder mit säuerlichen Kommentaren bedacht wurden. Sie wußte, daß man sie im Auge behielt, also wollte sie es tunlichst vermeiden, das Feuer, das vielleicht von selbst am Verlöschen war, neu zu schüren.
Sie sind nur neidisch, dachte sie, viele wären nur allzugern an meiner Stelle.
Sie saß dösend in einer Ecke des niedrigen, weichen Sofas, direkt unter einem der großen Atelierfenster, und malte zerstreut auf dem Rand ihres Notizblocks herum. Es fiel ihr schwer, Interesse für die auf der Tagesordnung stehenden Probleme aufzubringen, sie meinte plötzlich, das alles schon viele Male gehört zu haben, glaubte im voraus zu wissen, wie die Diskussion verlief, denn zu oft schon waren sämtliche Varianten eines möglichen Vorgehens durchgesprochen worden.
Ich hätte über die Anzahl meiner Fälle Buch führen sollen, dachte sie. So weiß ich nicht einmal, ob es tausend oder zweitausend sind, seit ich hier angefangen habe.
Trotzdem registrierte sie dieses Gefühl der Unlust mit einiger Verwunderung; es kam nur selten in ihr auf, und wenn, glich es zumeist einem dumpfen Groll, den sie sich nicht anmerken lassen durfte. Sie konnte es manchmal kaum noch ertragen, daß die Klienten sich ausschließlich auf ihre Gefühle konzentrierten, daß sie die wirkliche Situation von ihren Erlebnissen verdecken und sich selbst von momentanen, ständig schwankenden irrationalen Gefühlen leiten ließen, daß sie diese Gefühle nicht unter Kontrolle hatten. Zuweilen konnte sie diese ständige Beschäftigung mit den Gefühlen nicht mehr ausstehen, und ihr verhaltener Zorn war dann am stärksten, wenn die Klienten zu den Wohlhabenden zählten, denn fast immer waren sie es, die am schwierigsten zur Vernunft zu bringen waren.
Nur sie können es sich leisten, ihre Gefühle zu hätscheln, dachte sie bitter und merkte, daß ihr Kritzeln aggressiv und heftig geworden war, nur sie kommen zu uns. Ein Arbeiter hat sicherlich weder Zeit noch Geld, sich um psychische Zipperlein zu kümmern.
Die offensichtliche Disproportion bei der sozialen Zugehörigkeit der Klienten beunruhigte sie oft, und ab und zu empfand sie leichtes Unbehagen wegen ihrer Rolle in diesem Spiel.
Ich sitze hier und doktere an denen herum, die mich am wenigsten benötigen, dachte sie. Nicht ihnen zuliebe habe ich mich schließlich für das Sozialwesen entschieden.
Doch das Gefühl, diejenigen im Stich gelassen zu haben, denen sie sich vor allem hätte widmen sollen, konnte sie in der Regel abschütteln, und das Gefühl der Wut und des Triumphes, das sie packte, wenn die Begüterten plötzlich ihre Armseligkeit vor ihr ausbreiteten, hatte sie hinlänglich zu verbergen gelernt. Ein für allemal hatte sie ihre Gefühle beherrschen gelernt, sie ließ sich nicht mehr von ihnen verleiten, sie verstand sich auf die Tricks ihres Berufs, sie hatte sich gezwungen, stark und kühl zu sein, und von den Mädchen in der Anmeldung hatte sie erfahren, daß fast die Hälfte aller Klienten um einen Termin bei ihr baten. Das alles wußte sie, und das flößte ihr beinahe immer Ruhe und Sicherheit ein.
Gleich nach der Sitzung kam Nora auf sie zu und zupfte sie leicht am Ärmel.
»Hast du Zeit, mal kurz bei mir hereinzuschauen?«
»Aber sicher, du weißt doch, daß ich für dich immer Zeit habe!«
Nora war die Jüngste im Büro, sie hatte gerade ihren dreißigsten Geburtstag hinter sich und arbeitete erst knapp sechs Monate bei ihnen. Vorher hatte sie sich vier Jahre lang im Jugendfürsorgeamt abgerackert, wo Kristina sie entdeckt und – vom Scharfblick und Arbeitsvermögen des Mädchens beeindruckt – überredet hatte, die Stelle zu wechseln. Sie hatte gebeten, das Mädchen im ersten Jahr selbst anleiten zu dürfen. Nora war mit ihrer Frische, ihrem ein bißchen ruppigen Ton und ihrer legeren Kleidung ein willkommener Neuzugang in diesem Büro, in dem die leise und lavendelduftende Altjüngferlichkeit manchmal in gefährliche Nähe rückte.
»Du darfst mich nicht auslachen«, sagte Nora, als sie die Tür hinter sich zuzog, »aber ich muß dich etwas fragen. Es geht um Peter Hallberg, du kannst dich vielleicht an ihn erinnern.«
Kristina war nicht erstaunt. Sie bemerkte die leichte Röte auf Noras Wangen und die plötzliche, nervöse Aktivität, mit der diese den Schreibtisch abräumte.
»Ja, sicher«, antwortete sie. »Stimmt mit ihm irgend etwas nicht?«
Peter Hallberg war einer von Noras ersten Klienten gewesen. Als Betreuer hatte Kristina dem Verlauf der Geschichte aus der Ferne folgen können. Hallberg war siebenundzwanzig und Diplomökonom. Nach einer komplizierten Doppelscheidung war er am Ende das fünfte Rad am Wagen, das man nicht mehr benötigte.
Er hatte seine Frau und zwei Kinder verloren, das Einfamilienhaus in Vinsta verlassen und sich ein Zimmer irgendwo auf Kungsholmen mieten müssen. Sie wußte, daß Nora viel Zeit in den Fall investiert hatte, zumal Peter Hallberg noch immer zur Konsultation kam, obwohl die vier anderen Beteiligten ihre Besuche längst eingestellt hatten.
Nora spielte mit ihrem Füllfederhalter und rückte die große, viereckige Brille von Zeit zu Zeit nervös zurecht.
»Ich weiß nicht mehr, wie ich mich zu ihm verhalten soll. Es klingt vielleicht lächerlich, doch ich glaube, er ist drauf und dran, sich in mich zu verlieben. Jedenfalls sieht es so aus.«
Sie hätte es voraussehen müssen, genau das war zu erwarten gewesen! Nora war ja nicht nur intelligent, sie war außerdem auffallend schön und weder verlobt noch verheiratet. Und Peter Hallberg – sie hatte es selbst konstatiert – war trotz aller Bescheidenheit und Schüchternheit ein ungewöhnlich gutaussehender Mann.
»Na und du?« fragte sie und versuchte, so zu tun, als bemerke sie Noras Verlegenheit nicht. »Du magst ihn auch, nicht wahr?«
»Irgendwie, ja. Zu Anfang hatte ich vor allem Mitleid mit ihm wegen dieser ganzen Scheidungsgeschichte, den Kindern und seiner Angst vor der Impotenz. Doch inzwischen habe ich entdeckt, daß er mich nicht kaltläßt. Und das beunruhigt mich.«
»Hat er schon irgendwie etwas angedeutet?«
»Nein, er hat bisher noch kein Wort gesagt. Noch nicht.« Noras Stimme zitterte ein wenig, als hätte sie Angst. »Doch es ist ihm deutlich anzumerken, daß er sich hier wohl fühlt, ja, es ist nicht zu übersehen, daß er sich fast schon an mich klammert. Deshalb fürchte ich mich ein wenig vor ihm, oder richtiger, vor mir selbst. Denn ich spüre ja genau, daß ich eigentlich nichts dagegen habe, ihm über diese Impotenzangst hinwegzuhelfen. Zugleich weiß ich aber, daß es dumm von mir wäre, daß es die ganze Angelegenheit nur noch komplizieren würde.«
»Dann ist es ja gut«, sagte Kristina rasch. »Dann weißt du ja, was du zu tun hast. Man muß bei seinem Engagement gewisse Grenzen einhalten, das ist eine gute Regel in unserem Beruf. Fängt man an, die eigene Person mit dem Privatleben der Klienten zu verquicken, ist man bald übel dran. Wir sollen Berater sein, nicht Samariter. Kurzum: Willst du mit Peter ins Bett steigen, solltest du wenigstens warten, bis er mit seiner Therapie hier fertig ist.«
»Das habe ich mir auch schon gesagt«, antwortete Nora und sah plötzlich erleichtert aus. »Und ich wußte, daß du mir genau das raten würdest. Ich wollte es nur von dir selbst hören, das macht die Sache für mich sehr viel leichter. Aber eigentlich ist es doch zum Kotzen, daß man ...«
Nora biß sich auf die Zunge und wurde glühend rot. Kristina stand rasch auf, tätschelte ihr leicht die Wange und stimmte ihr mit einem verständnisvollen Lachen zu.
»Ja, Nora, es gibt in diesem Beruf auch eine Reihe von Nachteilen. Manchmal beschneidet er unsere Entscheidungsfreiheit.«
In der Tür drehte sie sich noch einmal um und fügte mit beherrschterer Stimme hinzu: »Aber leider ist es so: Voraussetzung für ein positives Ergebnis unserer Arbeit ist nun einmal, daß wir uns nicht in die Konflikte der Klienten hineinziehen lassen. Geben wir da nach, haben wir kaum eine Möglichkeit, die eigenen Gefühle im Zaum zu halten.«
Vielleicht war ich zu schroff, dachte sie, als sie die Treppe hinunterging. Doch ich mußte ihr ja abraten, ich weiß doch, was aus solchen Geschichten werden kann.
In ihren ersten Jahren hier im Büro, ehe sie gelernt hatte, eine schützende Distanz zu wahren, war sie einige Male in ähnliche Situationen geraten. Sie hatte sich in männliche Klienten verliebt, in einem Fall sogar dem Wunsch nachgegeben, in eigener Person zu helfen, und sich unvorsichtigerweise auf eine nervenaufreibende Verbindung eingelassen. Er hieß Kurt Landgren, war Zahnarzt, seine Frau hatte ihn wegen eines anderen verlassen, und er selbst war auf dem besten Wege, sein Selbstvertrauen und jegliche Tatkraft einzubüßen. Er hatte sie ein paarmal zu Hause angerufen, und aus einem plötzlichen Gefühl des Mitleids und der Verantwortung heraus hatte sie ihn auf einen kurzen Winterurlaub nach Norwegen mitgenommen. Danach war es wahnsinnig schwierig gewesen, ihn wieder loszuwerden. Er hatte sich an sie geklammert, hatte all seine wiedergefundene Virilität auf sie konzentriert, und damit er begriff, daß sie es ernst meinte, war sie schließlich gezwungen, ihn brutal und schmerzhaft abzuweisen.
Sie mochte Nora viel zu gern, als daß sie hätte zusehen können, daß diese sich der gleichen Gefahr aussetzte.
Sie ist zu weich, dachte sie. Sie muß lernen, härter zu sein. Sonst wird man sie früher oder später kaputtmachen.