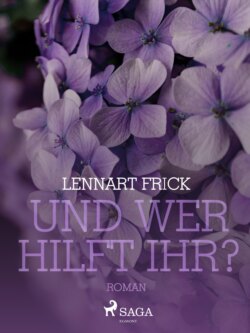Читать книгу Und wer hilft ihr? - Lennart Frick - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSie stand, hinter der Gardine verborgen, am Fenster des Wohnzimmers und sah ihn kommen. Sie hatte hastig und ohne viele Umstände gegessen, hatte nur etwas Braten aus der Büchse gewärmt und ihn auf ein paar Scheiben Knäckebrot gelegt. Am Abwaschtisch lehnend hatte sie die Brote nervös und mehr aus Pflichtgefühl hinuntergeschlungen. Sie hatte eine Dose Bier geöffnet, doch nur ein kleines Glas davon getrunken. Sie war voller Unruhe, denn trotz aller Bemühungen war sie den lächerlichen Argwohn nicht losgeworden, der ihre Sicherheit untergrub.
Ich stelle mich ans Fenster und schaue ihn mir an, dachte sie. Sieht er verdächtig aus, lasse ich ihn gar nicht erst herein.
Doch sie wußte nicht genau, was sie mit »verdächtig aussehen« meinte.
Genau drei Minuten vor sieben entdeckte sie ihn. Plötzlich stand er einfach da, jenseits der Rasenfläche mit dem herbstlich leeren Planschbecken. Er rührte sich nicht von der Stelle und sah zum Haus herüber. Dann überquerte er ruhig und zielbewußt die Straße und verschwand aus ihrem Blickfeld. Sie wußte, daß er um das Haus herumging, daß er das Gartentor öffnete und dann mit wenigen Schritten an der Haustür war. Sie konnte sich vorstellen, daß er im Flur stehenblieb und im Halbdunkel die Namen überprüfte, bevor er langsam die Stufen bis zum zweiten Treppenabsatz hinaufstieg.
Jetzt! dachte sie, und im gleichen Augenblick, als die Glocken der Västerledskyrka zu läuten begannen, klingelte es spröde und blechern an ihrer Wohnungstür.
Sie registrierte seine übertriebene Pünktlichkeit ohne Erstaunen, diese Eigenheit hatte sie schon seinem Anruf entnehmen können.
Entweder ist er krankhaft pedantisch, dachte sie, oder so völlig eingeschüchtert, daß er nicht wagt, auch nur eine Minute zu spät zu kommen.
Bevor sie die Tür öffnete, warf sie noch einen Blick in den Garderobenspiegel. Sie hatte ein flauschiges Hauskleid angezogen, als wolle sie sich von ihrer sonstigen Rolle, ihrem Aussehen im Büro, distanzieren. Nervös zupfte sie das Kleid über den Hüften zurecht, und als sie die Tür öffnete, spürte sie, daß ihr Willkommenslächeln steif und unnatürlich ausfiel. Sie wußte nicht, wie sie das Gespräch beginnen sollte, trat daher nur schweigend zurück, und er hängte, ebenso schweigend, seinen graublauen Trenchcoat an den Garderobenhaken. Er trug einen nüchternen, doppelreihigen Anzug und einen äußerst konventionellen Schlips, und sie war nicht verwundert, als er sich bückte und ein paar abgetragene Galoschen von den Füßen streifte.
Auch das noch, dachte sie. Hat er Angst, sich zu erkälten?
Mit einer einladenden Geste bat sie ihn ins Zimmer, er verbeugte sich ein wenig förmlich und rieb die leicht gelblichen Hände aneinander.
»Es ist außerordentlich nett von Ihnen, mich empfangen zu wollen«, sagte er, und wieder fiel ihr seine etwas umständliche Ausdrucksweise auf.
Sein Blick irrte die ganze Zeit umher, und sie bemerkte, daß er die Angewohnheit hatte, beim Sprechen die Lippen mit der Zungenspitze anzufeuchten. Sie kannte das, hatte es bei vielen ihrer Klienten gesehen, vor allem bei solchen, denen Psychopharmaka verordnet worden waren, die trockene Schleimhäute und Durst verursachten.
Er blickte sich abschätzend im Zimmer um, bevor er sich auf dem äußersten Rand des unbequemsten Sessels niederließ.
»Ich habe es mir schon gedacht«, sagte er leise. »Sie haben es nett hier, hübsch eingerichtet und gemütlich. Und die vielen Bücher!«
»In fünfzehn Jahren kommt so einiges zusammen.« Sie wußte nicht recht, wie sie auf den leichten Neid in seiner Stimme reagieren sollte.
»Ja, wer die Möglichkeit dazu hat, kann sich manches anschaffen«, fuhr er mit einem schiefen, ein wenig flatternden Lächeln fort.
»Wie wäre es mit einer Tasse Kaffee?« fragte sie. »Ich habe gerade gegessen und würde gern ...«
»Nicht für mich, auf gar keinen Fall für mich«, entgegnete er äußerst bestimmt. »Ich verlange nichts dergleichen. Trinken Sie nur, ich werde unterdes reden. Ich habe viel zu sagen und keine Zeit zu verlieren.«
Zu Anfang nahm sie Anstoß an seinem brüsken Ton, dann jedoch war sie beeindruckt von seiner geraden Art, die auch nicht die geringste Heuchelei zuließ.
Er weiß, was er will, dachte sie, und er hat nicht die Kraft, mir etwas vorzuspielen.
Als sie mit der gefüllten Kaffeetasse zurückkam, hockte er noch immer in der gleichen verkrampften Haltung auf dem Sessel. Sie setzte sich ihm gegenüber auf das weiche Sofa und zündete sich eine Zigarette an. Aus alter Gewohnheit erhob sie sich dann und holte einen Notizblock und einen gespitzten Bleistift aus einer Schublade im Bücherregal. Sie legte beide in Reichweite vor sich auf den Tisch, merkte jedoch sofort, daß er erstarrte.
»Sie dürfen keine Notizen machen«, sagte er, »Sie haben hier keinen vor sich, über den sie Ermittlungen anstellen sollen.«
Sie schob Block und Stift beiseite.
»Es war nicht böse gemeint«, erklärte sie. »Es fällt mir nur leichter, zuzuhören, wenn ich bestimmte Dinge notieren kann. Doch wenn es Sie stört, unterlasse ich es natürlich.«
Er saß verkrampft, leicht vornübergebeugt da, und als er die Hände aneinanderrieb, war ein trockenes, schabendes Geräusch zu hören. Jedesmal, wenn sie seinen Blick einzufangen versuchte, irrte er zur Seite.
»Sie werden es vielleicht merkwürdig finden, daß ich Sie aufsuche«, sagte er dann, und es war ihm anzumerken, daß er sich einen Stoß geben mußte, daß er diesen einleitenden Satz lange vorbereitet hatte. »Im Normalfall bin ich nicht so aufdringlich. Doch bei Ihnen wage ich es. Ich pflege Ihre Rundfunkprogramme zu hören und habe gelesen, was Sie geschrieben haben. Das hat mich veranlaßt, Ihnen zu vertrauen, Ihnen zu glauben, daß Sie wirklich helfen wollen.«
»Es ist nett von Ihnen, mir so freundliche Worte zu sagen«, erwiderte sie. »Ich hoffe, ich werde Sie nicht enttäuschen.«
Dieser Einwurf schien ihn ein wenig irritiert zu haben, denn er fuhr mit lauterer Stimme fort: »Sie behandeln die Leute nicht von oben berab. Sie schieben sie und ihre Probleme nicht einfach von sich. Sie nehmen jeden ernst. Sie scheinen nicht vorauszusetzen, daß diejenigen, die Ihnen schreiben, nur unter Einbildung leiden oder schwachsinnig sind. Aus diesem Grunde ...«
Er verstummte plötzlich, als sei er mitten in einem gut eingeübten Monolog steckengeblieben, und biß sich leicht auf den Zeigefinger der rechten Hand. Sie bemerkte den dunklen Zahnstein gleich über dem Zahnfleisch, die zerfransten Nagelfalze und die Schuppen, die durch das schüttere Haar am Scheitel schimmerten. Er machte keinen gepflegten Eindruck, ihn umgab der unverkennbare, säuerliche Geruch muffiger Abgestandenheit, doch der Anzug war auffallend gut gebügelt, als komme er gerade aus der Reinigung.
»Es ist lächerlich«, fuhr er dann fort und blickte zu ihr auf. »Ich habe dieses Gespräch fast ein ganzes Jahr lang vorbereitet, habe alles aufgeschrieben, was ich sagen wollte, und nun kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wie ich es aufgebaut hatte. Die Einleitung ist so wichtig, verstehen Sie, es ist wichtig, daß Sie wirklich begreifen, daß es mir Ernst ist, daß es Realitäten sind, von denen ich spreche, und keine krankhaften Hirngespinste. Doch ich bin so lange allein gewesen, daß ich nicht mehr recht weiß, wie ich mich ausdrücken soll. Sie müssen mir versprechen, mich nicht auszulachen!«
»Natürlich nicht!« Sie beugte sich vor und drückte die Zigarette aus. »Und selbstverständlich behalte ich alles, was Sie sagen werden, für mich. Sie erwähnten gerade, daß Sie allein sind. Sie sind nicht verheiratet?«
»Nein, ich bin nicht verheiratet«, antwortete er schroff. »Und ich habe keine Verwandten. Ich habe zwar einen Bruder und eine Schwägerin hier in der Stadt, doch die rechne ich nicht. Sie werden noch verstehen, weshalb. Und ich habe keine Bekannten, überhaupt keine.«
»Aber bei der Arbeit müssen Sie doch wohl ...«
»Ich arbeite nicht«, unterbrach er sie. »Es ist fünf Jahre her, daß ich meine letzte Arbeitsstelle hatte. Sie sind alle gegen mich gewesen, und ich lasse mich nicht schikanieren. Seit fünf Jahren sitze ich zu Hause und denke darüber nach, was vordem geschehen ist, und die ganze Zeit über habe ich mit niemandem verkehrt. Fünf Jahre völlig allein, begreifen Sie, was das heißt?«
»Wohnen Sie hier draußen?« fragte sie. Sie fühlte sich äußerst unsicher, wußte nicht, wie sie mit ihm fertig werden sollte.
»Das sage ich nicht«, entgegnete er. »Ich habe nicht die Absicht, Ihnen meine Adresse zu geben. Sie sollen mich nicht ausfindig machen, mir nicht die Behörden auf den Hals schicken können!«
»Aber was reden Sie da! Seien Sie doch nicht so mißtrauisch. Ich habe doch gar nicht vor, Sie irgendwohin zu bringen, ich wollte nur wissen, wie Sie wohnen, ob in einem Häuschen oder in einer Wohnung. Und wie Sie zurechtkommen.«
»Ein Haus? Ich? Wenn Sie wüßten, wie schlecht es mir geht«, antwortete er, erhob sich und ging ein bißchen steifbeinig und mit eckigen Bewegungen im Zimmer auf und ab.
»Sie dürfen mir nicht böse sein«, fuhr er bittend fort. »Ich bin vielleicht ein wenig mißtrauisch, aber glauben Sie ja nicht, das sei krankhaft. Es liegt nur daran, daß alle immer gegen mich waren. Und nun ist es bald aus mit mir, wenn Sie ihnen nicht Einhalt gebieten können.«
»Wem? Von wem sprechen Sie?«
»Das ist eine lange Geschichte«, sagte er und setzte sich wieder. »Dazu brauche ich mindestens drei Stunden.«
In diesem Augenblick klingelte das Telefon im Schlafzimmer. Bevor er gekommen war, hatte sie es hinübergetragen. Sie erhob sich rasch und sagte: »Ich werde zusehen, daß es nicht lange dauert.«
Es war Gunilla Granberg. Sie fragte nervös und aufgeregt: »Wie ist es? Meinst du, er ist gefährlich?«
»Alles okay«, antwortete sie leise. »Nett und freundlich, aber ein bißchen paranoid. Kein Typ, der Leute vergewaltigt oder erwürgt.«
Und etwas lauter, damit auch er es hören konnte: »Nett von dir, daß du anrufst. Aber ich habe gerade Besuch. Ich laß morgen von mir hören. Mach’s gut!«
»Was für eine Schauspielerin an dir verlorengegangen ist«, sagte Gunilla und kicherte. »Du hast Talent für Charakterrollen.«
Als sie ins Zimmer zurückkam, stand er am Bücherschrank und betrachtete einen Stoß psychiatrischer Handbücher, die er aus dem Regal genommen hatte. Sie wollte sich wegen des Anrufs entschuldigen, doch er unterbrach sie sofort und stellte die Bücher so nachdrücklich zurück, daß es beinahe aggressiv wirkte.
»Ich sehe, Sie interessieren sich für Psychiatrie«, sagte er. »Ich glaube nicht daran. Das ist der reinste Humbug. Es gibt keine psychischen Probleme. Es gibt nur soziale Konflikte, aus denen psychologische Probleme erwachsen können. Also versuchen Sie gar nicht erst, diese psychiatrischen Begriffe auf mich anzuwenden, das werde ich mir nicht gefallen lassen. Schizoid, Paranoiker, Schizophrenie, manisch-depressiv, Ödipuskomplex, Verdrängungen, nein, versuchen nicht auch Sie es noch mit diesem Blödsinn. Es ist schon genug, daß mir die anderen diese Etikette aufkleben wollten.«
»Jetzt sprechen Sie schon wieder von den anderen«, sagte sie und bemühte sich, ihre Stimme so neutral wie möglich klingen zu lassen, »wen meinen Sie damit?«
Da läutete das Telefon zum zweitenmal. Sie wiederholte das Manöver, sprach aber auch mit Clas nur ein paar Worte.
»Du gewinnst die Wette«, flüsterte sie, »doch er ist völlig ungefährlich.« Und lauter fügte sie hinzu: »Vielen Dank, es ist lieb von dir, daß du an mich gedacht hast, doch heute kann ich leider nicht. Ich rufe dich morgen an.«
Sie hatte den Hörer kaum aufgelegt und das Zimmer eben betreten, da klingelte es zum drittenmal. Mit einer übertriebenen Geste des Bedauerns ging sie zurück. Es war Lars-Göran.
»Du brauchst dich nicht zu beunruhigen«, flüsterte sie. »Mächtig lieb, daß du angerufen hast.« Und dann wieder mit der Theaterstimme: »Es wäre wunderbar gewesen. Doch ich habe heute abend Besuch, ja, den ganzen Abend. Du kannst mich aber morgen gern anrufen.«
Als sie zurückkam, stand er mitten im Zimmer, und sie hatte plötzlich den Verdacht, er habe sich an die Tür geschlichen und gelauscht.
»Es tut mir leid, daß wir unterbrochen wurden«, entschuldigte sie sich. »Es waren Bekannte von mir, die sich einsam fühlten und Gesellschaft haben wollten. Und das Telefon abzustellen fällt mir auch dann schwer, wenn ich Ruhe brauche. In diesem Beruf ist das nicht einfach.«
»Freuen Sie sich, solange noch jemand anruft«, entgegnete er. »Bei mir klingelt es jetzt nur noch selten. Und wenn es läutet, hat entweder jemand eine falsche Nummer gewählt, oder es ist einer meiner Verwandten. Wissen Sie, die rufen an, um mich zu kontrollieren, manchmal sogar mitten in der Nacht. Sie sagen nie etwas, doch ich höre sie atmen. Sie wollen mir Angst einjagen, möchten, daß ich krank werde, damit sie mich einliefern können.«
»Wieder sie«, warf Kristina ein. »Sie müssen erklären ...«
»Ja, ja«, sagte er ungeduldig, »doch dann muß ich alles von Anfang an erzählen. Sonst begreifen Sie überhaupt nichts.«
Ich werde es über mich ergehen lassen, dachte sie müde, er soll sich aussprechen können. Doch ich weiß schon jetzt, was er sagen wird.