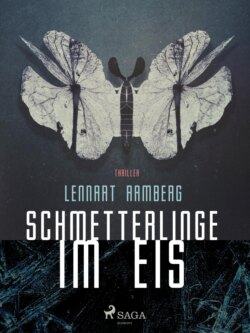Читать книгу Schmetterlinge im Eis - Lennart Ramberg - Страница 8
Kapitel 5
ОглавлениеEs sah aus wie die Geburt eines Schiffes, befreit aus der engen Welt – entlassen in eine neue. Zwei schwere Stahltore schützten das kleine Hafenbecken vor der unsicheren Zukunft, in die das Schiff fuhr. Auch die sechs Mitglieder an Bord empfanden das so. Es war eine Wiedergeburt.
Diana stand am Ruder, fünf Speichen und mit Glanzlack gestrichen. Betont vorsichtig steuerte sie den schlanken Schiffskörper auf seinem Weg zur Schleuse um die erste Steinmole. Ab und zu wurden sie von einer Windböe getroffen, die von den hohen Backsteinhäusern am Ufer herüberstrich, trotz dieser kleinen Zwischenfälle gelang es ihr, ohne Einsatz der Bugschraube die S/Y Guillemot sicher zu der kleinen Klappbrücke zu manövrieren. Die Leute beobachteten das Schiff, zeigten mit den Fingern darauf und unterhielten sich darüber. Einige von ihnen mussten warten, bis der Steg wieder freigegeben wurde, andere hatten ihr Bierglas in der Hand und freuten sich auf ein Mittagessen. Es war warm, Jacken hingen über den Stuhllehnen, und die Frauen hatten nackte Beine. »Mast- und Schotbruch, Guillemot!«, rief ihnen ein verschwitzter Mann mit hoch gekrempelten Hemdsärmeln und einem Bierkrug in der Hand zu.
»Auf in den Kampf!«, schrie Diana zurück. Vor wenigen Wochen noch hätte so ein Spruch Mordgelüste in ihr ausgelöst. Das Heer von gesprächigen Herren, die in ihrer Mittagspause das Schiff musterten, war immer sarkastischer und spöttischer geworden. Sie konnte es sogar verstehen, das Schiff hatte sehr lange, zu lange in den St. Katharine Docks gelegen. Und im Vergleich zu dem hehren Ziel der Guillemot war es natürlich viel zu kostspielig und luxuriös ausgestattet, eine großzügige Zielscheibe bissiger Ironie für Umweltschützer jedweder Couleur.
Aber das alles spielte jetzt keine Rolle mehr. Bald würden sie das offene Meer erreicht haben. Sie verließen das kleinere, schattige Schleusenbecken und erreichten das mittlere. Hinter ihnen senkte sich der Steg der kleinen Klappbrücke. Die letzte Brücke vor der Ausfahrt war bereits hochgezogen, und die Schleusentore öffneten sich langsam. »Das ist ja total krank mit diesen ganzen Dosen!«, stieß Abraham hervor, während er einen Fender an der Steuerbordseite befestigte.
Die Schleusentore setzten eine Welle aus Cola- und Bierdosen in Bewegung.
»Das ist eine verdammte Ressourcenverschwendung, so was. Warum holt keiner den Dreck da raus?«
Abrahams Gedanken machten Diana noch vergnügter. Dieselbe Person hatte diese Dosen nämlich ein halbes Jahr vor der Nase gehabt, ohne ein einziges Wort darüber zu verlieren. Sie bemerkte die Veränderung. Alle erwachten langsam aus ihrer Lethargie, sie waren bereit.
Sie beobachtete Abraham. Ein Kosmopolit mit israelischem Pass. Er hatte einen zwanzigjährigen Sohn, dessen Militärdienst ihm Kummer bereitete. In seinem robusten Körper ruhte eine friedfertige Seele, ausgestattet mit einem großen Maß an Empathie für die Umwelt und für das Wohl anderer Menschen. Wenn jemand in seiner Umgebung hervorhob, wie nett er sei, erwiderte er immer, dass er eigentlich als Buddhist hätte geboren werden und ein Leben zwischen zufriedenen Kühen in einem schönen, friedlichen Tal führen sollen. Aber dann habe es da wohl ein logistisches Problem gegeben und darum sei er in Tel Aviv gelandet. In diesem Augenblick blinzelten seine braunen Augen durch eine Harry-Potter-Brille und betrachteten ein Hotel, das sich am Ufer erhob.
»Sieht aus wie ein Bunker in Bethlehem«, brummelte er vor sich hin und fügte dann lauter hinzu: »Flaggen einholen, Boss?«
»Lass sie dran!«
Diana hielt sich nicht an die Regel, die große Beflaggung nur im Hafen gestattete. Sie mochte den Anblick der bunten Kette, Weißblau folgte Hellrot, dann kam Blauweißrot gestreift und so weiter, das ganze Flaggen-Alphabet kletterte das Achterstag hoch, kam das Vorstag wieder herunter und endete mit dem rotgelben Nullwimpel am Bugkorb. Seit Tandons Erkrankung war auf dem Schiff keine Flagge mehr gehisst worden. Farbe und Glanz waren Mangelware an Bord gewesen, jetzt konnten sie auch mal ruhigen Gewissens die Strecke bis Tilbury wie eine blühende Gärtnerei unterwegs sein.
»Willst du übernehmen, Peter?«
»Gern!«, antwortete der Kapitän und krempelte die Ärmel seines marineblauen Pullovers hoch. Die römische Locke, die ihm in die Stirn fiel, bewegte sich im Wind, als er das Ruder in die Hand nahm.
Er hatte kaum mehr Erfahrung als Diana, diese 85-Fuß-Segelyacht zu steuern. In den vergangenen zwei Wochen an Bord hatte er nur ein Mal, während der etwa zehnminütigen Fahrt von der Werft zum freien Liegeplatz vor den Bars an den St. Katharine Docks, den Tandon damals organisiert hatte, hinterm Ruder gestanden. Aber Peter zögerte keine Sekunde, die Guillemot das letzte Stück ins schmale Schleusenbecken zu manövrieren und Anweisungen für Fender und Leinen zu geben.
Die Tore schlossen sich hinter ihnen. Das Schiff zerrte an den Leinen, mit denen es vertäut war, als das Becken geflutet wurde. Und dann öffneten sich die Tore zum Fluss und in die Freiheit. Die Ebbe hatte noch nicht eingesetzt. Die Themse lag still vor ihnen, sie würden auf dem Weg zum Meer, vorbei an den etwa zwei Dutzend Flussbiegungen, eine günstige Strömung haben.
Ein Auto kam auf der schmalen Uferpromenade angefahren, viel zu schnell rollte es durch die Menge der Spaziergänger und Mittagstischgäste, um dann mit quietschenden Reifen stehen zu bleiben. Der Fahrer sprang aus dem Wagen und winkte, er ließ die Tür offen, rannte hinunter zur Kaimauer und wedelte erneut mit den Armen. Diana winkte zurück, allerdings fiel ihr Gruß etwas reservierter aus als der an die Biertrinker kurz zuvor.
»Der scheint aber ein wichtiges Anliegen zu haben. Kennst du ihn?«, fragte Vanessa, die untätig auf dem Mittelschiff stand.
»In gewisser Weise ja. Er ist das höchste Tier in unserem Vorstand, unser Treuhänder, du weißt schon.« Diana verriet jedoch nicht, dass er ihr in einer ganzen Reihe von Mails versichert hatte, der Abreise der Guillemot beiwohnen zu wollen und alle aus der Truppe mitzubringen, die sich freinehmen könnten.
»Wirklich toll, dass der Vorstand das Geld organisieren konnte, um unsere Abreise zu ermöglichen, oder?« Vanessa winkte dem Mann am Ufer fröhlich zu, der eine Kamera aus der Jackentasche holte, um ein Foto des Schiffes mit der Tower Bridge im Hintergrund zu machen.
»Ja, klar«, erwiderte Diana. »Hoffentlich hat er ein paar schöne Bilder im Kasten.«
Vanessa Varejão stammte aus São Paulo, eine kluge und schöne Frau mit einer energischen Ausstrahlung. Ein Stipendium hatte sie an die Tampa University in Florida verschlagen, wo sie eine Doktorarbeit begonnen hatte. Aber sie entdeckte bald, dass die Beschäftigung mit der Mesofauna und ihren millimetergroßen Krebstierchen nicht den von ihr gewünschten Effekt hatte, und war vor fast drei Jahren an Bord gekommen. Sie war zwar hauptsächlich wegen ihrer Kochkünste genommen worden, aber das trug sie mit Gelassenheit.
Das Heck der Guillemot drehte ab, und sie nahmen Fahrt durch das trübe Wasser der Themse auf. Diana war an die Bugspitze gegangen, wo Karen mit einem widerspenstigen Knoten an einem Tampen kämpfte.
»Brauchst du Hilfe?«
»Nein, warum sollte ich?«
Vielleicht, weil deine Knöchel schon ganz weiß sind, deine Wangen glühen und deine linke Halsschlagader wie ein bläulicher Wurm aussieht, dachte sich Diana, sagte aber nichts.
In Dianas Augen war Karen eine junge, wütende Krawalltouristin, die alles in Frage stellte und am zufriedensten schien, wenn eine Kampagne außer Kontrolle geriet und in Handgreiflichkeiten endete. Karen fand jede tiefer gehende Analyse überflüssig. Es würde doch schließlich genügen, sich umzusehen. In einer Welt, die so aussah, wie sie aussah, musste doch etwas Grundlegendes schiefgelaufen sein, fand sie. »Hallo, verdammte Axt, hast du keine Augen im Kopf?«, war ihre häufigste Zwischenbemerkung im Laufe einer Diskussion.
Tandon hatte Karen damals aufgrund ihrer Glaubwürdigkeit mit ins Team aufgenommen, erzählte er Diana einmal in einem vertraulichen Gespräch, ohne jedoch zu erläutern, worauf sich sein Urteil gründete. Allerdings erkannte sie durchaus auch Karens gute Seiten. Sie war sehr mutig, bis an die Grenze zur Unerbittlichkeit gegen sich selbst, und ungeheuer eifrig bei Aktionen jeder Art. Die Liegezeit in den St. Katharine Docks hatte sie meistens mürrisch und einsilbig verbracht und dabei raubkopierte mp3-Musik gehört. Jetzt war ihre Wut sehr viel extrovertierter, und das interpretierte Diana als ein gutes Zeichen. Deshalb ließ sie Karen, das wütende dunkelhaarige Mädchen aus Liverpool, die gekleidet war, als hätte sie gerade eine Armee-Kleiderstube ausgeraubt, auch in Ruhe weiter mit ihrem Tampen kämpfen.
Acht Monate lang hatte die Guillemot auf Reede gelegen, gefangen im trüben Wasser und in der stickigen Großstadtluft. Im Laufe des grauen verregneten Winters hatte Serve Earth nur eine einzige Bewegung vollzogen: den Weg aus dem Rampenlicht, fort von den Titelseiten hinein ins Schattendasein. Der Unterschied zu ihren vergangenen großen Tagen konnte nicht gravierender sein: Unter Tandons Führung hatte die Organisation phasenweise mehr Sendezeit und Zeitungsspalten gefüllt als Greenpeace.
Als der Tennisstar Roger Tandon damals seinen Rücktritt vom Profisport bekanntgegeben und verkündet hatte, er wolle eine Umweltorganisation gründen, hatten die Journalisten sehr skeptisch reagiert. Aber sie mussten bald umdenken. Mit seinen Wimbledonsiegen im Rücken war es Roger Tandon gelungen, die Medienaufmerksamkeit auf sich zu ziehen und für seine Botschaft zu nutzen. Diese war zwar manchmal ein wenig schwammig formuliert, aber die neu entworfenen Aphorismen konnten von jedem nach Belieben gedeutet werden: »Die Natur hat keinen zweiten Aufschlag« oder »Die Atmosphäre ist kein Balljunge«. Es zeigte sich, dass viele bereit waren, diesem Mann zuzuhören, dem der Ruf eines Gentleman und einige mäßig komplizierte Frauengeschichten vorauseilten. Nicht zu vergessen die ausgezeichnete Rückhand, weder besonders hart noch besonders gut platziert, dafür aber war der Ball so angeschnitten, dass der Gegner nie wusste, wohin er fliegen würde. »Früher wusste niemand, wo meine Rückhand den Ball hinbefördern würde«, hatte er auf der ersten Pressekonferenz gesagt, als er die Organisation vorstellte, »in Zukunft wird Serve Earth ein ähnliches Staunen hervorrufen, wenn wir irgendwo auftauchen.« Roger Tandons Engagement war bedingungslos, viel ausgeprägter als bei den meisten, die sich nach beendeter Karriere ein neues Aufgabenfeld suchten. Für Tandon war Serve Earth eine Lebenseinstellung, eine Vollzeitbeschäftigung für ihn und das Team, mit dem er sich umgab.
Diana McManus gehörte von Anfang an dazu. Ihr Bewerbungsschreiben hatte ihm sehr gut gefallen, ihre flüssige Handschrift, die nach rechts kippte und nicht nach links, wie so oft in England. Und in einer fröhlichen Bierlaune ein halbes Jahr später hatte er ihr gestanden, dass er auch ihren Geruch mochte.
Zur Medienelite aber zählten sie erst nach der Taufe der Guillemot. Seit den Tagen der Onassis’ hatte wohl keine Yacht eine so hohe Konzentration an bekannten Persönlichkeiten an Bord erlebt. Die Medien berichteten hungrig über alles. Tandon war sehr geschickt, er kombinierte Cocktailpartys auf dem Vordeck mit Kampagnen, die an sorgfältig ausgewählten Flecken dieser Erde stattfinden sollten. Schildkröten wurden vom Bootssteg eines Mauritius-Resorts gerettet, die Überfischung des Thunfisches wurde von Portofino aus bekämpft und der Ölverklappung von Cancún aus Einhalt geboten. Die Stifte kratzten nur so über das Papier, die Kameras klickten, die Leute lasen, sie schauten hin. Tandon hatte zwar nicht – wie Onassis seinerzeit–die Barhocker mit der Vorhaut von Walen beziehen lassen, aber ansonsten hatte er an nichts gespart, um die Guillemot zu einer der edelsten und schönsten Segelyachten ihrer Größe ausstatten zu lassen. Für die Klientel, die sich oft an Bord befand, stellte sie somit eine ganz natürliche Umgebung dar. Alles passte zusammen. Serve Earth erlangte in kürzester Zeit einen mächtigen Status als tonangebende Umweltorganisation.
In dieser Atmosphäre hatte Diana McManus fünf glückliche Jahre verbracht. Immer vorne mit dabei im Eifer des Gefechts einer Kampagne, immer im Klaren über das visuell Machbare, immer gut vorbereitet, so wie es in den Statuten von Serve Earth festgehalten war.
Diana wandte ihren Blick nach achtern und ließ ihn über die Tower Bridge wandern, zum Museumsschiff HMS Belfast und hinüber zu The Eye, dem gigantischen Riesenrad, das seit dem Jahrtausendwechsel die Londoner Skyline zierte.
Lieber Tandon, dachte Diana, wärst du noch hier, hätten wir diesen Auftrag nicht annehmen müssen. Aber du würdest es bestimmt zu schätzen wissen, was wir hier tun! Was ich hier tue! Wir müssen wieder raus auf den Platz. Aufstehen, nicht aufgeben bei einem Stand von null zu fünf und Vorteil des Gegners.
Tandon hatte Diana eines Tages unverblümt von seiner Krebserkrankung erzählt, die sich von der Bauchspeicheldrüse aus im ganzen Körper verbreitete. Ihr war der Boden unter den Füßen weggerissen worden. Sie hatte es noch nicht einmal zu seiner Beerdigung geschafft. Deshalb war sie umso verwunderter gewesen, als eine Delegation von Honoratioren sie aufgesucht hatte. Sie kannte den Vorstand der Organisation kaum, eine bunte Gruppe aus dem britischen Jetset. Sie sollte zur neuen Chefin der Organisation ernannt werden.
Es war, wie es war. Seit sie den Vertrag mit Serve Earth unterschrieben hatte, war dieser Dienstag im Mai, an dem sie mit der Guillemot die Themse hinunterfuhr, der schönste gewesen. Sie empfand so etwas wie Glück.
Höhe Canary Wharf holten sie die Signalflaggen ein und machten Platz für den gewaltigen Gennaker. Zwischen den Wolkenfetzen lugte ab und zu die Sonne hervor, die allgemeine Stimmung an Bord war ausgezeichnet, und kurze Zeit später erstreckte sich das bunte Logo von Serve Earth über die zweihundert Quadratmeter Nylontuch des Gennakers. Außer einem verhakten Schot gab es kein Missgeschick. Sie wurden von der Strömung getragen und fuhren mit vierzehn Knoten flussabwärts.
Vier Tage lang steuerten sie Richtung Norden, die gesamte Ostküste Schottlands hinauf. Sooft es ging, wechselten sie die Segel und wurden zu einer Mannschaft, die langsam alle Ungeschicklichkeit und Unbeholfenheit ablegte.
Während der langen Nachtwachen hatte Diana ausreichend Gelegenheit, sich über ihre Besatzung Gedanken zu machen. Wen hatte sie da eigentlich an Bord? Vanessa. Ohne sie hätte sich Serve Earth wahrscheinlich während der langen, kargen Wartephase im Hafen aufgelöst. Sie hatte für die Besatzung erschwingliche Unternehmungen aufgetan, mal einen Salsakurs in einer Schulaula in Richmond, mal ein Drachenflug auf Kite Hill. Abraham hatte sich zwar zu keinem Zeitpunkt über das lange Warten beschwert, aber auch er wirkte jetzt, da es endlich losging, wie aufgeputscht. Er durfte gern alle Klischees bedienen mit seiner kreisrunden Nickelbrille und den groben Strickpullovern, solange er dabei der fähige Chemiker und Steuermann blieb, der niemals sinnlos herumjammerte. Karen hatte sich bisher nicht zu erkennen gegeben. Diana wunderte sich darüber, dass sie noch dabei war. Unbeugsam, geradezu angstfrei, war sie von allen am besten geeignet, bei schwerer See in die Takelage zu klettern und die Segel einzuholen. Dianas persönlicher Rekrut, der Fotograf Klaus, war drei Tage nach dem designierten Kapitän Peter an Bord geklettert. Sein Gepäck bestand aus drei Fototaschen und zwei zerschlissenen T-Shirts. An Klaus und Peter war die lähmende Marter des Hafenaufenthalts vorbeigegangen, und sie brachten frischen Wind und neue Energie in die Gruppe, die sich während des Winters an Bord gequält hatte.
Die Guillemot hatte gerade mit Genua und Großsegel Stronsay, die östlichste der Orkney Inseln, passiert, als Diana den Motor starten lassen wollte.
»Aber was haben wir auf den Shetlandinseln verloren? Wir müssen keinen Diesel bunkern und haben auch sonst nichts an Land zu verrichten. Wir gewinnen doch viel Zeit, wenn wir einfach weiterfahren, oder nicht?«
Peters Fragen waren berechtigt, und weil ihr Verhältnis zwischen ihm als Kapitän und Diana als einer Art Reederin noch nicht richtig geklärt war, verhaspelte sie sich bei der Antwort.
»Ich glaube, alle haben Lust, sich mal die Beine zu vertreten ...«
«Diesen Wunsch habe ich bisher von niemandem gehört.«
»Außerdem können wir Frischwasser aufnehmen.«
»Aber wir haben doch einen eigenen Trinkwasseraufbereiter!«
»Ja, das weiß ich doch, aber ich traue diesen Apparaten nicht. Außerdem ist es nicht besonders umweltfreundlich, Energie zu verschwenden, wenn es nicht notwendig ist.«
»Ja, ja, schon gut. Ich verstehe deine Gründe zwar nicht, aber ich füge mich. Wir steuern auf Lerwick zu. Punkt, aus, basta.«
Backbord sichteten sie Daire Isle, aber die Strömung zwang sie dagegenzuhalten, und deshalb konnten sie nur die Spitze von Sheep Rock in der Nebelbank erahnen. Danach waren sie bis Sumburgh Race allein auf dem Meer, nur begleitet von den Seevögeln. Sie lagen günstig im Gezeitenzyklus, das Wasser stieg, und das Bestreben des Atlantiks, die Nordsee zu füllen, hob sie in die geschützten Gewässer östlich der Shetlandinseln, wo der Seegang sie nicht mehr erreichte. Vereinzelt sahen sie Fischerboote, die in Küstennähe nach Kammmuscheln suchten, und steuerbord kreuzten zwei Trawler auf ihrem Weg ins offene Meer. Nach etwa einer Stunde entdeckten sie das erste Haus, das wie ein Würfel in der Landschaft lag, gebaut aus demselben grauen Stein, auf dem es stand. Die Besiedlung nahm zu, wurde dichter, Weiß mischte sich unter das Grau, der Friedhof auf der Klippe wurde sichtbar, unregelmäßige Häuserblocks häuften sich, eine Stadt tauchte auf. Lerwick hieß die Besatzung der Guillemot in Grau gehüllt und verschlafen auf seine besondere Art herzlich willkommen.
Es gab keine wichtigen Besorgungen oder Aufgaben, die sie an Land erledigen mussten. Das erhöhte auch Dianas Risiko, dass jemand Lust hatte, sie zu begleiten. Darum verkündete sie kurz und knapp, dass sie einen Morgenspaziergang machen wolle, und sprang an Land. Während die übrigen Besatzungsmitglieder an Bord blieben und aufräumten, verschwand sie zwischen den grau verputzten Fassaden der kleinen Stadt, die noch nicht zum Leben erwacht war.
Bleischwer lag das Telefon in ihrer rechten Jackentasche, obwohl es nur etwa zwei- oder dreimal so schwer war wie ein normales Handy. Die Gasse, in die sie, einer spontanen Idee folgend, hineinging, war so schmal, dass ein Hausvorsprung sie fast unbegehbar machte. Sie passierte einen Buchladen, das mit Zetteln vollgehängte Schaufenster eines Immobilienmaklers, Sammelbüchsen für die Seenotrettung. Niemand schien sie zu beachten.
An einer Straßenkuppe blieb sie stehen. Lehnte sich gegen eine Mauer unter der windschiefen, gebogenen Krone einer Kiefer, die es gewagt hatte, ihren Kopf über die kleine Anhöhe hinausragen zu lassen. Sie holte das Satellitentelefon aus der Jackentasche. Ungeübt und unsicher zog sie die Antenne heraus und tippte den Pin-Code ein. Sie wählte die anonyme Rufnummer und ging auf die Anhöhe, um einen besseren Empfang zu haben. Das Rauschen erinnerte sie an die Zeit der alten Bakelittelefone, deren Ende sie als Kind noch gerade so erlebt hatte. Eine schöne Erinnerung von längst vergangener Geborgenheit streifte sie, als jemand am anderen Ende der Leitung antwortete.
»Ja?«
»Hallo, hier spricht Diana. Diana McManus.«
»Ich weiß. Wo sind Sie?«, fragte eine Männerstimme, die sich überall auf der Welt hätte befinden können. Eine Stimme, die versuchte wie eine Maschine zu klingen, mit unterdrückter Satzmelodie und unnatürlichen, gleichmäßigen Pausen zwischen den Worten.
»In Lerwick, auf den Shetlandinseln.«
»Gut. Sehr gut.«
»Mit wem spreche ich denn bitte?«
Diana meinte ein Atemgeräusch im Rauschen der Satellitenverbindung zu hören. Keine Antwort.
»Okay«, sagte sie dann. »Was soll ich tun? Wie lautet mein Auftrag?«
»Sie sollen nach Ny-Ålesund fahren, wohin Sie ja auch eingeladen wurden, und dort das Ballonexperiment überwachen!«
»Überwachen?«
»Betrachten Sie sich als eine Beobachterin, wenn Sie so wollen, von der UN, oder als eine Gesandte der Regierung. Jemand, der sich umsieht, Fragen stellt, Recherchen vornimmt. Oder als eine Auslandsreporterin.«
»Ist das alles?«, fragte Diana erstaunt.
»Ja, das ist alles«, erwiderte die Stimme, fügte jedoch nach einer Kunstpause, die durch die Satellitenverbindung noch verlängert wurde, hinzu, »vorerst.«
Nachdem sie die Antenne wieder ins Telefon geschoben hatte, fragte sie sich, warum sie eigentlich ein Satellitentelefon benutzen sollte. Vielleicht war er davon ausgegangen, dass sie die meiste Zeit auf See sein würde, oder zumindest nicht in der Nähe eines Funknetzes. Aber vielleicht wollte er auch die Nummer als Identifikation haben. Aber diese Ungereimtheiten waren unwichtig, bedeutungslos im Vergleich zu den Antworten, die sie auf ihre Fragen erhalten hatte.
Sie zuckte mit den Schultern. Natürlich wusste sie, dass von ihr eine Gegenleistung verlangt werden würde, aber eben nicht, was für eine. Nach wie vor war ihr Auftrag unklar und unergründlich, aber sie ahnte bereits mit Unbehagen, dass sie ihren Gastgeber Emil Planck hintergehen sollte.
Auf dem Rückweg hielt sie kurz an, rieb sich die Wangen rot, ging zügig weiter und blieb dann vor einem Schaufenster mit Elektrowerkzeug stehen, in dem sie sich spiegeln konnte. Sie gab vor, sehr an einer Stichsäge interessiert zu sein. Vorsichtig warf sie den Kopf in den Nacken und schob dann die Kapuze ihrer Jacke auf dem Kopf hin und her. Sie wiederholte diese Bewegung immer wieder. Ihr dunkelblondes Haar stand ihr wie ein Reifrock vom Kopf ab, so wie früher, wenn sie ihre Lachexplosionen nicht zurückhalten konnte und den Kopf so in den Nacken warf. Sie war sich dessen nie bewusst gewesen und hatte es zum ersten Mal bei der Ausstrahlung eines Fernsehbeitrags entdeckt. Genauso sollte es jetzt aussehen.
Niemand sollte aus ihrem kurzen Ausflug irgendwelche Rückschlüsse ziehen können, noch nicht einmal erahnen, was sich da anbahnte.
Karen saß mit Zigarette im Mund an Deck, trotz Rauchverbot. Sie sah, wie Diana die schattige Allee herunter auf die Anlegestelle zukam, als würde sie aus einer Grotte auftauchen. Karen registrierte ihre veränderte Körperhaltung, aufrechter als zuvor, in gewisser Weise stolzer. Sie folgte Dianas Gestalt, deren kraftvoller Gang ihre Haare zu Berge stehen ließ.
Was glaubst du eigentlich, wem du was vormachen kannst?, dachte Karen. Natürlich war sie telefonieren. Was sollte sonst in ihrer ausgebeulten Jackentasche liegen? Eine alte Packung After Eight? Aber warum rief sie nicht vom Boot aus an? Sehr verdächtig. Sie schnippte den Zigarettenstummel weg, der mit einem wütenden Zischen im Wasser versank. Dass sie bloß nichts Dummes anstellte. Oder sogar Serve Earth in Gefahr brachte.
Lässig kam Diana den Ponton entlangstolziert.
»Willst du nicht an Land, Karen?«
»Mal sehen. Hast du gesehen, ob die Post geöffnet ist?«
»Ähm ... Nein, das habe ich nicht.«
»Und der Bäcker?«, fragte Karen und sah zu Boden.
»Nein.«
»Nee, klar.«
»Aber du«, setzte Diana nach. »Siehst du die weißen Vögel da hinten? Sind das Sturmvögel?«
»Nein. Schwäne«, zischte Karen, als sie merkte, dass Diana unbedingt das Thema wechseln wollte. Jeder hätte auf diese Entfernung Basstölpel erkannt. Karen stand wortlos auf und hisste die kleine norwegische Gastlandflagge unter der Backbord-Saling.