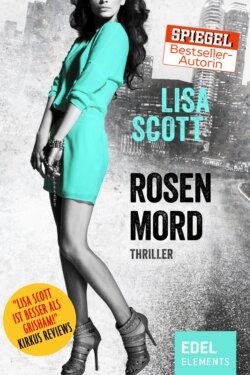Читать книгу Rosenmord - Lisa Scott - Страница 5
3
ОглавлениеAuf der Platte von Armens Besprechungstisch stehen leere Kaffeetassen inmitten eines Durcheinanders von sich aufrollenden Faxen, Fotokopien von Fällen und Prozeßunterlagen des Hightower-Falles. Wir arbeiteten ohne Pause, auch während des Abendessens und bis in die Nacht hinein, lasen Fallberichte und sprachen über das Gutachten. Schließlich begann Armen, auf seinem Laptop einen Entwurf aufzusetzen, und ich nahm mir zur Überprüfung der Fakten die Habeas-Petition vor.
Darin steht, daß Thomas Hightower siebzehn war, als er die Schule schwänzte und mit seiner Clique trinken ging. Die Jungs machten ihn betrunken und forderten ihn heraus, das hübscheste Mädchen der Schule zu küssen. Hightower ging zu der Farm, wo das Mädchen wohnte, und traf Sherri Gilpin im Schuppen an. Er lud sie ein, und sie lachte ihn aus. »Ich und mich mit einem Nigger verabreden?« sagte sie. Angeblich.
In aus der Trunkenheit resultierender Wut schlug Hightower sie, sie verlor das Gleichgewicht und krachte mit dem Schädel gegen einen Traktor. Er unternahm Wiederbelebungsversuche. In diesem Moment kam ihre kleine Schwester Sally herein und begann zu schreien. Hightower sagt, er geriet in Panik. Er durfte keine Zeugen zurücklassen; es hätte seine Mutter umgebracht. Deshalb erdrosselte er das Kind. Im Anschluß an die Tat ging er zu seinem Wagen und fuhr absichtlich gegen einen Baum. Und nun tritt der Staat Pennsylvania auf den Plan. Er rettete ihm das Leben und behielt sich damit die Ehre vor, ihm den Prozeß zu machen und ihn zu verurteilen. Zum Tode.
Hightower konnte sich keinen Rechtsanwalt leisten, ohnehin hätte ihn keiner aus der kleinen Bergarbeiterstadt vertreten. Der Bezirksrichter betraute einen Jungen mit dem Fall, der gerade die Abendschule absolviert hatte, und die Geschworenen verurteilten Hightower wegen Mordes. Als über das Strafmaß verhandelt wurde, eine Argumentation, in deren Anschluß die Geschworenen über Leben und Tod entscheiden, berief sich Hightowers Anwalt auf ein Gesetz, das bereits drei Jahre zuvor vom Obersten Gerichtshof Pennsylvanias als verfassungswidrig verworfen worden war. Irgendwie hatte er das nicht mitbekommen.
Dieses überholte Gesetz, das einzige, das den überwiegend weißen Geschworenen zur Kenntnis gebracht wurde, ließ die Möglichkeit außer acht, die Jugend Hightowers, seine aufgrund des Alkoholkonsums verminderte Zurechnungsfähigkeit, seine nicht vorhandenen Vorstrafen und die Reue, die er mit seinem Selbstmordversuch gezeigt hatte, als »mildernde Umstände« bei der Entscheidung über das Urteil, Todesstrafe ja oder nein, zu berücksichtigen. Die Geschworenen brauchten nur fünfzehn Minuten bis zu ihrem Urteil. Tod.
Ich lege die Papiere auf den Tisch und schaue aus den riesigen Fenstern, aus denen die vierte Wand des Zimmers besteht. Es ist mitten in der Nacht. Orangefarbene Straßenleuchten überspannen bandartig den Delaware. Weiße Lichter punktieren die Tragseile der Ben-Franklin-Brücke. Ampeln leuchten auf: rot, gelb, grün. In der dunklen Nacht blitzen die Lichter wie Edelsteine auf. Während das Funkeln draußen vor dem Fenster meinen Blick auf sich zieht, beschäftigt sich mein Verstand mit den juristischen Fakten.
Die Frage lautet, war Hightowers Anwalt derart inkompetent, daß der Prozeß nicht fair abgelaufen ist. Streng juristisch gesehen, verdient Hightower wohl einen neuen Prozeß; was er unter dem Gesichtspunkt Gerechtigkeit verdient, steht auf einem anderen Blatt. Aus diesem Grund praktiziere ich Handelsrecht. Da geht es nicht um Leben oder Tod; die Fragen, die sich dabei erheben, sind schwarz und weiß, und die richtige Antwort lautet stets grün.
»Tja«, murmelt Armen vor sich hin. »Tja, tja, tja.« Er hört auf zu tippen und liest die letzte Seite seines Entwurfs. Im Büro ist es still, seit Bernice ihr Schnarchen eingestellt hat. Ich habe das Gefühl, als seien wir die einzigen Menschen auf der Welt, die noch wach sind, hoch oben im nächtlichen Himmel über der glitzernden Stadt.
»Tja was?«
»Ich glaube, wir werden dem Jungen das Leben retten. Was meinen Sie?«
Die Frage bestürzt mich. »Ich weiß nicht. So denke ich nicht darüber.«
»Ich schon.« Er lächelt müde, die Krähenfüße, die ihn älter aussehen lassen, als er ist, kräuseln sich. »Ich würde dem nicht Einhalt gebieten können, wenn ich nicht so darüber denken würde.«
»War das Ihr Ziel?«
»Zwangsläufig. Sein Anwalt war inkompetent. Jeder andere hätte ihn lebend ins Gefängnis gebracht, statt dessen ist sein Tod beschlossene Sache. Man hat ihn reingelegt.« Er lehnt sich in seinem Sessel zurück. Die Übermüdung hat ihn verändert: vielleicht seine Abwehrhaltung gemildert, oder die berufsmäßige Distanz zwischen uns verringert. Er scheint mir gegenüber offen wie noch nie.
»Für mich geht es nicht darum, ihm das Leben zu retten. Ich betrachtete die Sache vielmehr unter streng juristischen Gesichtspunkten.«
»Ich weiß, Grace. Deshalb wollte ich, daß Sie an dem Fall arbeiten. Ihre Sicht beschränkt sich ungeachtet der Moral auf die rein rechtlichen Belange.«
Das tut weh. »Werfen Sie mir das vor? Schließlich handelt es sich um eine rechtliche Frage und nicht um eine moralische.«
»Wirklich? Wer sagt das?«
»Holmes.«
»Holmes kann mich mal«, antwortet er und streckt sich genüßlich in seinem blauen Oxfordhemd. Die Hemdsärmel hat er bis zu den Ellenbogen hochgekrempelt, die Krawatte gelockert. Er ist mir so nah, daß ich einen Hauch seines Aftershaves erhasche. »Es geht um beides, Grace, um Recht und Moral. Sie können Recht nicht von Gerechtigkeit trennen. Sie sollten das gar nicht wollen.«
»Aber dann ist das, was Sie als gerecht erachten, maßgeblich, und das ist subjektiv und unterscheidet sich zwangsläufig von Richter zu Richter.«
»Damit kann ich leben, das steht in meiner Arbeitsplatzbeschreibung. Von einem Richter wird erwartet, daß er richtet. Dem achten Zusatzartikel zur Verfassung entnehme ich, daß deren Verfasser der Meinung sind, die Regierung dürfe nicht foltern und nicht töten. Denn das ist das Böse in höchster Vollendung, nicht wahr, und es läßt sich unmöglich kontrollieren.« Sein Gesicht verdüstert sich.
»Ich verstehe nicht«, sage ich, aber teilweise verstehe ich schon. Armens Herkunft steht auf seinem olivfarbenen Gesicht geschrieben und zeigt sich ebenso unübersehbar in seinem Büro: in den gerahmten Urkunden mit den schnörkeligen Buchstaben an den Wänden, dem Bild vom Berg Ararat hinter seinem Schreibtischsessel, den mit seltsamen Mustern reich verzierten Lampenständern und Brokatkissen.
»Bei den Armeniern begann es ganz allmählich«, sagt er und beugt sich vor. »Unser Recht auf unsere eigene Sprache wurde uns genommen. Dann das Recht auf Ausübung unserer christlichen Religion. Etwa um 1915 raubten sie uns das Leben. Wir verhungerten, wurden aufgehängt und gefoltert. Zu Tode geprügelt, die meisten von uns damit.« Er deutet auf einen derben Holzknüppel, der über dem Bücherregal hängt.
»Das wußte ich nicht.«
»Das wissen viele nicht. Die Hälfte meines Volkes wurde umgebracht. Eine halbe Million Menschen, ausgelöscht von der türkischen Regierung. Meine ganze Familie, bis auf meine Mutter.« Aufflackernder Schmerz überschattet sein Gesicht.
»Das tut mir leid.«
Er achtet nicht darauf. »Der entscheidende Punkt ist, eine Regierung darf ihre Bürger nicht töten, nicht mit meiner Hilfe. Ich weiß, Hightower hat eine furchtbare Tat begangen. Er hat getötet, aber ich werde ihn nicht töten, um zu beweisen, daß Töten Unrecht ist. Er gehört für immer hinter Gitter, damit er nie wieder einem Kind Leid zufügen kann. Und dahin kommt er, wenn ich in dieser Sache irgend etwas zu sagen habe.« Mitten in seiner Rede bricht er plötzlich ab; seine Gesichtszüge werden weicher. »Deshalb danke ich Ihnen, daß Sie sich damit beschäftigt haben.«
»Hatte ich denn eine Wahl?«
»Nein.« Er entspannt sich in seinem Ledersessel. »Sie sind betroffen, das wissen Sie«, fügt er rasch hinzu.
Hinter ihm leuchten verschwommen die Lichter der Stadt, und ich fühle mehr, als daß ich verstehe, daß wir jetzt nicht mehr über den Fall sprechen. »Ich weiß nicht …«
»Doch, Sie wissen es. Ich bin auch betroffen, Grace. Stark betroffen, ehrlich gesagt.«
Ich kann nicht glauben, was ich höre. Ich spüre, wie mein Herz sacht zu hämmern beginnt. »Daran läßt sich nichts ändern.«
»Doch, läßt sich. Gib mir deine Hand.« Er streckt die Hand aus.
Sie schwebt zwischen uns in der Luft, Frage und Antwort zugleich. In dieser Situation sollte alles entweder schwarz oder weiß sein, aber die innersten Gefühle sind nicht so eindeutig.
»Hör auf zu denken. Nimm sie.«
Ich ergreife seine Hand, sie fühlt sich stark und warm an. Er zieht mich an sich, so selbstverständlich, als hätten wir das schon millionenfach getan, und im gleichen Moment liege ich in seinen Armen und spüre seinen Kuß sanft auf meinem Mund. Plötzlich höre ich draußen vor dem Büro ein Geräusch. Ich stemme mich von seiner Brust ab. »Hast du das gehört?«
»Was?«
»Da war ein Geräusch. Vielleicht die Tür?«
»Alles in Ordnung«, meint er. Wieder küßt er mich und verlagert sein Gewicht unter mir, aber ich schiebe ihn weg.
»Warte. Halt. Das geht nicht.«
»Warum nicht?«
Es gibt Regeln, oder nicht? »Du bist verheiratet, um mal damit anzufangen.«
Zärtlich streicht er mir die Haare aus der Stirn und betrachtet eingehend mein Gesicht. »Nicht mehr«, sagt er. »Meine Ehe ist zu Ende.«
Das ist ein Schock. »Was? Wieso?«
»Sie ist schon lange am Ende. Susan bat mich, bis nach der Wahl bei ihr zu bleiben, und das habe ich getan. Sie kommt am Vormittag, um die Papiere zu unterschreiben. Morgen reichen wir die Scheidung ein.«
»Die Scheidung?«
»Ja.«
»Das glaube ich nicht.«
»Es stimmt.« Er berührt mein Gesicht. »Dann liebst du mich also nicht? Habe ich mich geirrt?«
Soviel zum erfolgreichen Verbergen meiner Gefühle. »Ich weiß nicht. Ich meine, ich denke an dich, schon lange.«
»Wie lange?«
»Zu lange, um es zugeben zu können.«
»Das ist lange genug, findest du nicht.« Er küßt mich leidenschaftlich. Bevor ich protestieren kann, merke ich, wie ich seinen Kuß erwidere, und will nicht mehr protestieren. Ich verliere mich in seinem Kuß, in seiner Wärme. Seine Hände finden den Weg zu meinen Brüsten. Er liebkost sie, während wir uns küssen, und erregt mich. Er beginnt, meine Bluse aufzuknöpfen, und Scheu regt sich in mir, eine Art Scham.
»Bist du sicher, daß da draußen niemand ist? Draußen im Büro?« frage ich.
»Kein Mensch.« Er öffnet den Knopf über meinen Brüsten und enthüllt die Perlenkette, die ich unter der Bluse trage. Ich halte seine Hand fest. Verständnislos sieht er mir in die Augen. »Ich tue dir nicht weh, Grace«, sagt er sanft. »Laß mich. Laß mich dich ein bißchen liebhaben.«
»Aber ich …«
»Schsch. Ich träume davon. Davon, dich zu lieben.«
»Armen …«
»Laß mich. Du mußt.« Lächelnd nimmt er meine Hände und legt sie auf die Armlehnen seines schweren Sessels. »Da läßt du deine Hände. Wir machen ganz langsam.«
Mein Atem geht schwer, ich bin zugleich erregt und ängstlich. »Wir dürfen das nicht tun, nicht hier.«
»Pst.« Er öffnet einen Knopf nach dem anderen. »Sieh dich an, du bist wunderschön.«
Ich blicke hinab und sehe aufblitzende Perlen zwischen meinen Brüsten baumeln. Das bogenförmige Körbchen eines BHs. Mein Rock ist hochgezogen, über das blickdichte Elfenbein meiner Strumpfhose hinauf. Ich ertrage es nicht, mich in diesem aufgelösten Zustand zu sehen, deshalb wende ich den Blick ab und schaue aus dem Fenster. Aber statt des Nachthimmels sehe ich in der Wand aus Glas das Spiegelbild eines dunkelhaarigen Mannes und einer rittlings über ihm sitzenden Frau mit helleren Haaren. Seltsamerweise ist der Anblick so leichter zu ertragen. Wie in einem Spiegel. Ich kann hinsehen, als wäre es jemand anderer.
»Alles ist gut«, flüstert er.
Ich sehe zu, wie er mir die Seidenbluse von den Schultern streift, erst den einen Arm aus dem Ärmel zieht, dann den anderen, anschließend greift er um meinen Körper und hakt meinen BH auf. Ich kann kaum atmen. So langsam, als würde er etwas Kostbares und Reines enthüllen, nimmt er den BH ab, umschließt mit jeder Hand eine Brust und streichelt die Brustwarzen. Als sie unter seinen Daumen steif werden, spüre ich ein köstliches Prickeln. Ich umfasse seinen Kopf, diesen Kopf mit den zu langen Haaren, die mir so vertraut sind, und er vergräbt sein Gesicht glücklich zwischen meinen Brüsten, erst die eine, dann die andere liebkosend.
Ich höre mich stöhnen und schlinge meine Beine fester um ihn. Er reagiert, wiegt mich gegen die zunehmende Härte in seinem Schoß und saugt abwechselnd an meinen Brustwarzen. Ich fühle die Feuchtigkeit da, wo er saugte, und ein leichter Schauder überläuft mich, als er mich plötzlich hochhebt und in seinen Armen sacht auf den Tisch legt. Meine Beine umschließen seine Taille, und meine Hände greifen nach der Tischkante. Meine Perlen fallen zur Seite, die Hightower-Unterlagen flattern zu Boden, und Gott weiß, was sonst noch alles vom Schreibtisch rutscht.
Sein Körper scheint über mir zu schweben, doch plötzlich hält er inne. »Du siehst mich nicht an. Sieh mich an, Grace.«
Ich betrachte ihn im Spiegel der Glaswand. Ich kann nicht tun, worum er mich bittet.
Er dreht mein Gesicht zu sich, und in seiner Miene zeigen sich Besorgnis und Erregung gleichermaßen. »Warum siehst du mich nicht an?«
»Ist deine Ehe wirklich vorbei?«
»Ja.«
»Schwörst du es?«
»Bei meinem Leben.« Er beugt sich über mich, küßt mich zärtlich und drängt sich zwischen meine Beine. »Laß dich gehen, Grace. Laß dich gehen.«
Ich schließe die Augen. Erst reagiert mein Körper auf ihn. Und dann mein Herz.