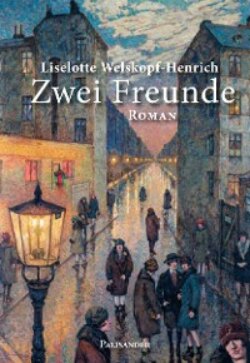Читать книгу Zwei Freunde - Liselotte Welskopf-Henrich - Страница 15
9
ОглавлениеSehr langsam ging der junge Mann durch die Nacht seinem Heime zu. Alles Wirkliche schien unwirklich, nach dem das Unwirkliche wirklich geworden war.
Wenn ich nun schlafe, alter Heiliger, wirst du dann deine reichen Faltengewänder ablegen und im leinenen Kittel übers Land gehen, um Anuschka zu grüßen? Ich bin müde und verwundert wie ein Kind, das mehr gesehen hat, als es noch begreifen kann. Drüben rauscht der Ahornbaum im Wind, und es ziehen wieder Wolken über den Mond. Das Haus im Garten schläft, es schläft der Trauer und dem Leid entgegen. Weißt du das, alter hölzerner Mann? Der früheste Morgen fand den Schläfer wieder wach. Noch brach kein Sonnenstrahl durch die graue Helle, als Oskar Wichmann schon an seinem Renaissance-Schreibtisch saß. Vor ihm, auf der großen saffianledernen Schreibmappe, lag das Diadem mit seinen funkelnden Diamanten. Der Betrachter kam sich vor wie jene Jünglinge in der Sage, denen sich des Nachts Zauberkammern der Unterirdischen aufgetan haben und die des Morgens, noch mit irgendeinem Zeichen in der Hand, herumirren vor nie wieder auffindbaren Türen. Wie ein solches Zeichen aus versunkenem und verbotenem Wunderreich lag die kleine Krone vor ihm. Er erinnerte sich an den Abend, an dem er sie zum erstenmal im Lichtschimmer des Schaufensters als Königin zwischen blitzenden Ringen und matten Perlenketten gesehen hatte. Das war damals gewesen, als er in das Ministerium eintrat. Die Melodien Verdis schwangen um diesen Reif. Der junge Mann sah Aida in schwarzer Spitze mit gelben Rosen und um sie die Fülle des Lichts, das sich in Kristall und auf der Politur edler Hölzer spiegelte. Er spürte wieder den herben Duft ihres Haares. Unter dem Stern der Venus war diese Frau geboren.
Anuschka hatte sie eine böse Frau genannt.
Das Herz wand sich. Über die ersten Stunden hatten ihm Anuschka und der Schlaf hinweggeholfen, aber jetzt brannte das Feuer. Die Betäubung verging, der Schmerz wurde hell wach. Musa – der Bebrillte – der Schwätzer – er ist es wert gewesen, daß du dich weggeworfen hast, Marion – daß du einen Justus Grevenhagen verraten und mit meinen Träumen gespielt hast. – Und liebst du denn jetzt diesen? Kannst du überhaupt lieben? Oder willst du dich nur mit dem Besonderen, dem Aparten, dem Auffälligen seines Daseins schmücken, wie du dich mit Grevenhagenschem Stolz und Reichtum geschmückt hast? Bist du gekommen, du Elfenblütige, um unter den Menschen zu tanzen und sie in den Schlamm und stinkenden Tang deines Sees zu ziehen?
Still, ohne Antwort, zierlich und spöttisch glitzerte das Diadem auf der Saffianmappe.
Wie war einem Fisch an dem Angelhaken zumute? Wichmann wußte es, ja, er wußte es. Aber lieber die Zunge zerreißen, als sich noch einmal herbeiziehen lassen.
Hätte er ihr’s vor die Füße geworfen!
Jetzt lag es da und glitzerte.
Was tun, Anuschka? Gehen, fortgehen, wie du gegangen bist, in eine andre Stadt, unter andre Menschen. Eine andre Arbeit tun? Man war jung, und die Kräfte waren noch unverbraucht.
Nein, Anuschka, wir sind ein Mann und wollen dies erst zu Ende bringen.
Was tat ein Gentleman an Oskar Wichmanns Stelle? Was? Ja, was? Er wollte sich nicht rächen. Nur eine Genugtuung wollte er genießen, die, daß er Marion beschämte. Es war ein Gedanke wie Balsam, Marion Grevenhagen dreißigtausend Mark zu überweisen – da – nimm das Geld, um das es dir zu tun war. Die Gedanken mochten einmal diesen Weg laufen. Wie, wenn der Assessor über Sonntag in seine Heimatstadt fuhr und den alten vornehmen Juwelier Helmbrecht aufsuchte, der mit seinem Vater bekannt gewesen war und mit dessen Kindern Oskar gespielt hatte? Ein Diadem – sehr kostbar – eine Familie ist in Verlegenheit – sie möchte den Verkauf nicht öffentlich bekannt werden lassen. Vielleicht gibt sich eine günstige Gelegenheit unter der Hand …? Ja. Und dann? Was dann? Was tat Oskar Wichmann mit einem Betrag, nun, sagen wir, von zwanzigtausend Mark? Auf das Gutskonto überweisen, auf das Konto, das Marions leichtsinnigem Bruder auch offenstand? Oder ihr selbst den Betrag überbringen? Sie noch einmal sehen – aber wo und wie, ohne bemerkt zu werden? Vielleicht ergab sich wochenlang keine Gelegenheit, und wenn sie sich ergab, durfte er dann Justus Grevenhagen noch in die Augen blicken? Der Gatte hatte das Diadem gekauft, ohne Zweifel, mit Geldern seines Vermögens. War es ehrenhaft, wenn Oskar Wichmann sich von Marion anstiften ließ, es heimlich zu verschachern? Schomburg drängte. Drängte er wirklich? War er nicht vorläufig zufrieden, nachdem er gehört hatte, daß Grevenhagens Beamteneinkünfte noch nicht angetastet waren?
Fragen, Fragen ohne Antwort.
Du bist kein guter Geist, Marion. Verwirrung begleitet dich. Felonie, Felonie …
Oskar Wichmann hätte noch einmal fünf Jahre alt sein mögen, heimlich heulen wie ein trotziger Junge und die Tränen abwischen, ehe die Mutter sie sah, die ja doch alles wußte.
Dirne.
Wichmann faßte das Schmuckstück an wie Nesseln. Er packte es hastig ein und verschloß es in dem mittleren Fach des kleinen Schranks, zu dem er den Sicherheitsschlüssel besaß und in dem er auch einiges Wertvolle aus eigenem Besitz aufzubewahren pflegte.
Nun konnte sie ihn des Diebstahls bezichtigen! Warum denn nicht. Die Haussuchung entlarvte ihn als Verbrecher. Draußen war die Sonne aufgegangen, die Strahlen spielten am Fenster. Wichmann sehnte sich nach der Ruhe, der weltüberwindenden Stimmung des vergangenen Abends. Anuschka hatte sie ihm gegeben. Aus eigener Kraft vermochte er sie nicht wiederherzustellen. Sie war dahin. Widerwärtige Eifersucht bedrängte ihn, sein Gefühl wurde zu einem brodelnden Kessel mit häßlichen Blasen. Er haßte sich und das Weib; er haßte den Dienst, in dem er dem Namen Grevenhagen wieder begegnen mußte. Du hast recht gehabt, Anuschka, ein böser Käfer hat sich in meine Knochen gefressen, und nun wühlt er. Nichts mehr ist heiter und rein.
Assessor Dr. Wichmann kam an diesem Tag um halb acht Uhr mit den Amtsboten zum Dienst. Aber auch die Fäden der Arbeit wollten sich ihm nicht ordnen, und sein ›Wi‹ hatte einen zerfahrenen Zug. Ein unsichtbarer Angelhaken reichte bis in das Ministerium. Die Gedanken drehten und wanden sich. Marion hätte diesen Platinreif Schomburg unmittelbar als Pfand für seine Forderungen geben können. Warum denn die Umwege? Hatte sie gehofft, aus Wichmann einen höheren Betrag herauszuziehen? Allerdings, gnädige Frau, ein Verehrer, der ohne Umschweife zwanzigtausend Mark auf den Tisch gelegt hat, der besitzt wohl hunderttausend oder zweihunderttausend nach Ihrer Rechnung. Irrtum, Marion, es gibt Menschen, die bereit sind, alles zu schenken, wenn sie lieben, die alles schenkten, wenn sie liebten – es war einmal. Nimm dein Platin wieder, du kannst es ja jetzt mit Schomburg versuchen. »Wir sind mit Schomburg in großen Schwierigkeiten«? Wir? Wer? Marion und ihr Bruder Luftikus? Oder Marion und ihr Gatte? Alles blieb offen. Warum sprach Schomburg nicht mit Grevenhagen selbst? Warum wählte er die Hintertüren für seine Erkundigungen? Hatte er etwas zu verbergen? Hatte er den Gatten zu scheuen? Auch er?
Pfui, Wichmann. Wohin bist du geraten.
Nein – was hast du dir schon vorzuwerfen? Gedanken – Träume – keine Sünden, die die Welt faßt. Einmal hatten ihre Hände an seinen Wangen gelegen, einmal hatte ihr Kopf an seiner Schulter gelehnt. Ich habe dich nie geküßt, Marion. Warum muß in einem schönen Körper nicht auch eine schöne Seele wohnen? Wie du die Zigarette hieltest, Marion – ich hätte dich getötet, wenn ich nicht ein Feigling wäre.
Sie sind bieder und schal – Kasper, Korts, die Hüsch und Dieta. Du warst einmal anders als alle – aber wenn du Frau Musa sein wirst … Marion, bist du kein Geheimnis mehr – und Anuschka ist größer als du.
Anuschka, es ekelt mich hier alles an. Es ekelt mich vor mir selbst. Ist solches Gedankengewimmel eines Mannes würdig? Du hast ganz einfach gehandelt. Das wollen wir auch tun. Laß uns doch einmal ruhig nachdenken und ordnen, was ist. Wir sind um einen wunderbaren Traum ärmer geworden. Gestehen wir, daß es schmerzt, und arbeiten wir.
Wichmann wartete an den folgenden Tagen darauf, ob in der ›Stillen Klause‹ von dem Abend bei Musa gesprochen werde. Niemand erwähnte ihn. Loeb war schweigsam.
Als das Wochenende kam, meldete Oskar Wichmann ein Ferngespräch zu seiner verheirateten Schwester an und teilte mit, daß er vom Sonntagmittag bis zum Abend bei seinen Verwandten sein werde, Sonntag vormittag wolle er gern unbehelligt streunen und eine kleine persönliche Angelegenheit ins reine bringen. Er werde des Nachts hin- und herfahren – ja, mit Schlafwagen, natürlich.
In Wahrheit natürlich nicht, liebe Schwester Olga, denn Oskar hat zwanzigtausend Reichsmark verliehen und eine Barschaft von dreihundert Reichsmark am vorigen Abend in Anuschkas Manteltasche gesteckt. Er ist heute auf die Bank gegangen und hat hundert abgehoben, was nicht zu tun er doch entschlossen gewesen war.
Die Nachtfahrt war langweilig und ermüdend, aber als Wichmann in der Morgenfrühe des Sonntags durch die stillen, besonnten Straßen ging, die er alle kannte, und als die Leute ihn grüßten, die alle noch von seinem Vater Professor Ludwig Wichmann wußten, da hoben sich seine Stimmung und seine Kräfte. Er pfiff vor sich hin. Ein Frühstück in der kleinen Kneipe, in der er als Primaner den ersten heimlichen Rausch gehabt, erfreute ihn sehr. Er aß Würstchen mit Senf, ein Paar, ein zweites und ein drittes Paar. Die Sonne schien herein, und der Wirt ließ sich erzählen, was man in der großen Stadt denn am Sonntag tue und wie es wohl in den Restaurants zugehe, in denen man ein halbes Hundert Mark für ein einziges Essen mit unbewegter Miene auf den gedeckten Zahlteller legte.
Als zehn Uhr vorbei und die Würstchen verzehrt waren, machte sich der Gast auf den Weg zur Helmbrechtschen Wohnung. Sie befand sich in einem alten, gediegenen, nur zweistöckigen Haus der gartenreichen Seitenstraßen, und als der Ankömmling die Klingel drückte, kam Emmeline, das Faktotum, um zu öffnen.
»Nein, aber was, der junge Herr Doktor!« Sie lief fort, um anzumelden.
Als Wichmann bei dem alten Herrn in dem vertrauten, altväterisch reich möblierten Zimmer stand, wurde er in einen Sessel genötigt und mußte erzählen. Man sprach dies und das, von Politik, von der Arbeit, von der Stadt, von den gemeinsamen Bekannten. Es wurde Wichmann doch schwer, mit seinem Anliegen herauszurücken. Die sehr hellen blauen Augen des zierlichen alten Mannes beschworen eine Erinnerung. Endlich gab Wichmann sich einen Ruck. Zu lange konnte man einen Vormittagsbesuch nicht ausdehnen.
»Bitte stellen Sie sich vor, Herr Helmbrecht, daß ich Sie heute als Geschäftsmann – vertraulich – um ein Gutachten bitten möchte. Sie sind der einzige, zu dem ich mit diesem Anliegen kommen kann, und ich habe, ehrlich gestanden, darum die Reise hierher unternommen.«
Der Gesichtsausdruck des Juweliers mit dem weißen Henri-Quatre-Bart wechselte. Er wurde sofort ernst, es war, als ob ein dünner Vorhang vor seinen Augen niederginge. »Und was für ein Gutachten wäre das, lieber Oskar?«
Wichmann öffnete ein Paketchen und klappte den Deckel der Schmuckschatulle auf, die er sich zur Aufbewahrung des Diadems verschafft hatte.
»Der Gegenstand hier gehört einer mir gut bekannten und sehr angesehenen Beamtenfamilie, deren Namen ich zunächst nicht nennen möchte. Eine Verlegenheit – es handelt sich wohl um die Schulden eines Verwandten, die bezahlt werden sollen – eine Verlegenheit gibt Anlaß zu dem Wunsch, dieses Stück hier in nächster Zeit zu verkaufen oder zu beleihen. Der Kaufpreis war achtundzwanzigtausend Mark. Die Familie möchte sich unter der Hand und ohne Aufsehen erkundigen, ob sich eine mehr oder weniger zufällige Möglichkeit auftun kann, das Diadem ohne allzu großen Verlust abzugeben, oder zu welchem Preis ein Juwelier es heute übernehmen würde.«
»Ja, mein lieber Herr Oskar, das sind sehr schwierige Fragen.«
Der alte Herr holte eine scharfe Brille und ein Vergrößerungsglas.
»Im Juweliergeschäft rechnet man mit langen Lagerzeiten und großen Verdienstspannen beim einzelnen Stück. – Es ist auch ein wenig Spekulation dabei, und damit sieht es jetzt schlecht aus, denn die Geschäftsleute fangen an zu jammern. Man spricht mehr von Baisse als von Hausse. Das Stück ist gut, das sehe ich schon. Aber es muß einen Liebhaber finden. Haben Sie schon einmal einen Fachmann gefragt?«
»Nein.«
»In einer sehr großen Stadt finden sich natürlich immer mehr reiche und kauflustige Leute als gerade bei uns.«
»Sicher. Aber die Familie möchte die Sache nicht an die große Glocke hängen und nicht in der Oper ihrem eigenen Schmuck wiederbegegnen.«
»Tja … ja. Platin ist natürlich wertvoll, und der Stein ist schön. Ich weiß nicht, wann der Preis von achtundzwanzigtausend Mark bezahlt worden ist. Heute und bei uns – da muß ich Sie leider sehr enttäuschen – gibt ein Juwelier für dieses Stück nicht mehr als sagen wir – sechs- bis siebentausend Mark, wenn er es auf Lager nehmen muß und nicht zufällig schon einen privaten Interessenten an der Hand hat.«
»Das bedeutet allerdings einen beachtlichen Verlust – zweiundzwanzigtausend Mark Verlust. Und wie steht es mit den möglichen privaten Interessenten?«
»Reiner Zufall. Ich glaube nicht, daß eine der eingesessenen Familien bei uns das Ding kauft. Sie kennen ja die Leute hier. Höchstens ein Ortsfremder, irgendein reicher Gast, dergleichen Herren zeigen sich manchmal. Man muß warten können.«
»Was würden Sie in dem Fall raten?«
»Guter Rat ist teuer. Wenn die Familie nicht gezwungen ist zu verkaufen, würde ich den Besitz jetzt halten bis zu besseren Zeiten. Wenn sie aber verkaufen muß aus irgendwelchen Gründen, und zwar bald – dann allerdings so schnell wie möglich! Denn die Preise werden vorläufig kaum besser, wahrscheinlich aber noch schlechter.«
»Können Sie vielleicht eine Zeichnung und Beschreibung des Diadems hierbehalten, Herr Helmbrecht, für den Fall, daß einmal ein Deus ex machina in Gestalt eines englischen Lords oder eines reichen Amerikaners auftaucht?«
»Das kann ich natürlich, wenn Sie darauf Wert legen. Ich möchte Ihnen nur keine Hoffnungen machen.«
»Ihre Auskunft war mir schon sehr wertvoll und durchaus genügend. Ich danke Ihnen, Herr Helmbrecht, für die Freundlichkeit, mit der Sie sich am Sonntagmorgen meinetwegen geschäftlich bemüht haben. Vielleicht lasse ich das Stück bis heute abend hier – um diese Zeit fahre ich zurück –, und Sie werden bis dahin die Zeichnung und Beschreibung machen lassen?«
»Ich bin Ihnen dankbar, Herr Oskar, wenn es so geht und ich die Sache nicht überstürzen muß. Auf meine Diskretion können Sie sich verlassen.«
Man plauderte noch von vergangenen Zeiten und von Oskar Wichmanns Vater, dann verabschiedete sich der Assessor. Er wurde bei seinen Verwandten zum Mittagessen sehr erfreut und ein klein wenig neugierig empfangen und spürte die Versuche der älteren Schwester, über die Ursache seines plötzlichen Auftauchens etwas zu erfahren. Mit Lächeln wich er aus und blieb bei der Unterhaltung mit dem Schwager, der als Geschäftsmann über die Stimmung der Großstadt manches zu erfahren wünschte. Wichmann erreichte auch, daß er nicht an die Bahn gebracht wurde, so daß er unbemerkt noch einmal bei Helmbrecht vorbeigehen und dann in das Abteil 3. Klasse einsteigen konnte. Die Zahl der Mitreisenden war diesmal geringer, und der Heimreisende konnte sich einige Stunden auf der Bank ausstrecken. Er hatte den früheren Zug gewählt und kam schon um sechs Uhr fünfzehn morgens in der rußgeschwärzten weiten Bahnhofshalle an. Es blieb Zeit, vor dem Dienst in die Kreuderstraße zu gehen und sich zu erfrischen. Die Frau Geheimrat hatte das versäumte Sonntagsfrühstück auf den Montag verlegen lassen.
Als Wichmann an seinem Fensterplatz seinen gewohnten guten Frühstückskaffee trank, wurde drunten die Straße gekehrt. Die Uhr war noch nicht auf acht gerückt, und der Assessor griff nach der Zeitung, die Martha immer noch regelmäßig zum Frühstück mitbrachte. Nach halb neun Uhr, wenn der Ministerialdirigent im Kabriolett zum Dienst gefahren war, wollte Oskar Wichmann in der Kreuderstraße 3 ein Paketchen für Frau Grevenhagen abgeben. Vermutlich wunderte sich niemand darüber, und wenn sich die Wißbegier von irgendeiner Seite doch regte, stand Marion gewiß eine Ausrede zur Verfügung.
Die Ahornblätter hatten sich mit ihren Flächen zur Sonne gestellt. Die Rosenbeete zwischen Weg und kurzgeschnittenem Rasen standen in voller Pracht. Knospen und Blüten drängten sich und leuchteten mit ihren Farben durch die Eisenzierden des Gartentores. Das eine Fenster des Hauses, das auch im Sommer nach der Straße sichtbar blieb, lag in schimmerlosem Graublau. Wichmann hatte die Zeitung sinken lassen und schaute hinüber. Der Klang von Schritten kam an sein Ohr. Zwei Menschen gingen, der Rhythmus des Ganges verriet den ungleichen Wuchs. Von dem hellgrauen Pflaster im Morgensonnenschein hoben sich die beiden Gestalten in dem schwarzglänzenden Tuch der Reitkleidung ab. Die gemeinsame Schönheit der schlanken und aufrechten Linie ließ den Herrn und die Dame wie ein einziges Zusammengehöriges empfinden. Das hellgraue Haar des zurückkehrenden Reiters, sein schmales, Gesicht und die schlanken Hände waren die Einzelheiten, die den Charakter seiner Erscheinung dem Bewußtsein verdeutlichten. Seine Begleiterin war dunkel und weich in der Bewegung. – Er ging zwei Schritte voran und öffnete das Rosentor, und sie trat auf den sandbestreuten Weg, der das Geräusch ihrer Schritte schluckte. Die Pforte klinkte zu; der Betrachter sah die hell behandschuhte Rechte, die den Rosengriff wieder schloß. Der Kavalier führte seine Dame zwischen den blühenden Beeten und den grün schwellenden Rasenpolstern dem Hause zu. Das Schwarz der eleganten Reitkleidung, besonders wirkende Note im hellen Sommer, entschwand dem Auge des Außenstehenden.
Wichmann sah auf die Zeitung, ohne die Buchstaben zu erkennen. Er zweifelte einen Augenblick an sich selbst und daran, daß die Dame, die er soeben beobachtet hatte, dieselbe gewesen sei, die bei Alfons Musa gewesen war. Aber das Diadem in der Schatulle zeugte für die Wahrheit des bösen Traumes.
Der Assessor stand auf und ließ sich von Martha ein kleines Stück gutes Packpapier bringen.
Als das Frühstücksgeschirr abgeräumt war, packte er die Schmuckschachtel um, legte einige Zeilen mit dem Bericht über das Helmbrechtsche Gutachten bei und schrieb die Adresse:
Frau M. Grevenhagen – Kreuderstraße 3
Die Lektüre der Zeitung hatte ihre Anziehungskraft verloren. Die Uhr, die menschlicher Unruhe spottet, ging in nicht zu veränderndem Tick-Tack, Schritt um Schritt, Sekunde um Sekunde, Minute um Minute bis acht Uhr fünfundzwanzig. Der Motor des dunklen Kabrioletts gegenüber sprang an, und der Wagen verschwand in Richtung des Parks.
Oskar Wichmann nahm den grauen Sommerhut und machte sich auf seinen Weg. Es ist der letzte, Justus Grevenhagen, den ich ohne dein Wissen tue. Vielleicht ist es überhaupt der letzte, der mich in dein Haus führt.
Mit einem besonderen Gefühl ging der Besucher durch die eiserne Pforte und im Dufte der Rosen der Villa zu. Als er klingelte, öffnete der Diener, den er schon kannte, auch am frühen Morgen im Dreß. Wichmann trat in die lichte Diele ein, deren Wände mit englischen Stichen geschmückt waren.
»Wollen Sie dieses Päckchen Frau Grevenhagen überbringen, Johann, Frau Grevenhagen erwartet es.«
»Wollen Herr Doktor bitte einen Augenblick Platz nehmen?«
Als Johann gegangen war, bereute Wichmann, zugestimmt zu haben. Er setzte sich nicht. Mißgestimmt über sich selbst betrachtete er an der Wand die Bilder glücklicher Familien und edler Vollblutpferde.
Die gnädige Frau war zu Hause und ließ bitten.
Johann führte durch die Flucht der vorderen Zimmer, die dem Besucher schon genau bekannt war. Aber Wichmann dachte heute mehr an sein erstes Hiersein als an alle späteren.
Im Herrensalon am Kamin stand Marion. In der schwarzen Georgette des schlicht gearbeiteten Vormittagskleides waren dunkelrote, mattfarbene Blüten eingewebt. Die Zartheit des Stoffes ließ Arme und Schultern durchschimmern. Die Hand hielt das Blatt mit den Aufzeichnungen Wichmanns über Helmbrechts Äußerungen.
»Sie haben die Freundlichkeit gehabt, Herr Doktor Wichmann, einen Juwelier Ihrer Heimatstadt wegen des Diadems zu befragen, über das wir kürzlich sprachen. Ich bin Ihnen sehr verbunden für die Mühe, die Sie sich gemacht haben. Sie haben dem Herrn unseren Namen genannt?« – Die Stimme klang dunkel, samten, wie immer.
»Ihren Namen habe ich nicht genannt, gnädige Frau.«
»Ich danke Ihnen dafür, daß Sie mir eine Möglichkeit eröffnet haben.«
Das Morgenlicht fiel auf Marions Gesicht. Die Haut, vom Schmelz eines hellen Rosenblattes, war sehr gepflegt. Um die Mundwinkel und um die Augen lagen beginnende, noch halb verborgene Falten. Das schwarze Haar war glatt aus der schön geformten Stirn gestrichen.
Oskar Wichmann machte seine Abschiedsverbeugung, und Frau Grevenhagen reichte ihm die Hand zum Kuß. Er führte die Förmlichkeit aus, ohne die warme Hand mit den Lippen zu berühren. Als er den Kopf wieder hob, trafen sich zwei Augenpaare, die vieles verbargen. Was sie verschwiegen, wußte doch jeder. Es war Feindschaft.
Oskar Wichmann ging.
Er ging nicht durch den Park. Seine eiligen Füße suchten die Straßen der Stadt. Im Ministerium sprang er die Treppe des Nebeneingangs über zwei Stufen hinauf, um nicht unpünktlich zum Dienst zu sein. Noch einmal dachte er an die Art, wie Marion Grevenhagen ihm die Hand gereicht hatte. Es war der letzte Versuch, die unausgesprochene Frage gewesen, ob sie ihre Macht über ihn wiederherstellen könne. Nein, Frau Marion. Der Stachel sitzt zu tief, und Sie sollen nie erfahren, daß er gequält hat.
Oskar Wichmann saß über den Akten und beantwortete Anfragen.
Dem jungen Manne war zumute wie den Kirchhofgängern, wenn sie nach einer Beerdigung heimkehren. Er hatte das Gefühl eines vollständigen Abschlusses. Wenn die Liebe zu Marion im Hause Musa gestorben war, so war sie jetzt begraben. Endgültig war die schaumumwobene Frauengestalt zu Staub geworden. Er hatte die zurückgebliebene Körperlichkeit, so schön sie auch war, sehen können, ohne daß sein Gefühl mehr berührt wurde, und nur seine Selbstachtung schmeichelte sich mit dem Gedanken, daß Wichmann keine gewöhnliche Frau geliebt habe. Marion Grevenhagen hatte bei dem letzten Gespräch Haltung gewahrt, obwohl ihre Lage dem Untergebenen des Gatten gegenüber weder besonders glücklich noch besonders würdig war. Nun war das Traumbuch der Liebe zugeklappt, das Leben in einer entgötterten Welt ging weiter. Es blieben die Arbeit, der Urlaub, die Kollegen, Dieta. Die Arbeit war das beste, vielleicht war auch der Urlaub gut. Während der Assessor dem kleinen Fräulein Sauberzweig seine Briefe diktierte, erschien ihm eine erste schüchterne Illusion firnbedeckter Gipfel, aus Nebel steigender Felsen. Fort von hier, ja fort! Wichmanns Empfinden war jung. Wenn es auch Trauerkleidung trug, so wandte er sich vom Vergangenen doch der Gegenwart und dem Kommenden zu. Auch hinter dem Alltäglichen des Dienstes und des Freundeskreises lagen für den noch nicht Dreißigjährigen allgemeine Hoffnungen, mögliche Erfüllungen, ein Unbestimmtes, noch nicht Abgegrenztes, das den Schritt lockte. Er hatte einen Fall getan und war dabei, sich wieder aufzurichten, um weiterzugehen. Die Nähe des Urlaubs drang dabei immer tiefer in seine Vorstellungen, um sich allmählich zum Mittelpunkt zu machen. Die Ferien vom Ich, das Spiel der Freiheit, das der auf Zeit entlassene Städter sich selbst vorspielt, hatte für Wichmann in diesem Jahr den Reiz eines Heilmittels, nach dem der Genesende gierig greift.
Bei der Mittagsrunde in der »Stillen Klause« schlug der Assessor das Urlaubsthema an.
»Was machen denn unsre hohen Chefs in den Ferien?« wollte die Bibliothekarin wissen.
»Ha, die lieben sich gegenseitig so arg, daß sie sich gar nicht recht trennen können – jeder meint, er dürfe den andern net allein lassen. Der Boschhofer ischt so besorgt um das Wohlergehen der Abteilung, daß er sich überhaupt noch kein Urlaub ang’setzt hat, und der Nischan nimmt immer bloß acht Tage hintereinander. Der Grevenhagen geht scheint’s Anfang Auguscht, wenn du wieder da bischt, Wichmann. Mehr als drei Wochen bleibt er jetzt net weg, kalkulier’ ich, damit’s ihm im Winter nachher noch zum Skifahre langt.«
Die folgenden Tage vergingen im Flug, und der Morgen kam, an dem Oskar Wichmann im Touristenanzug Dienst tun wollte, um den Mittagszug vom Büro aus zu erreichen. Der kleine Handkoffer war gepackt und verschlossen, der Rucksack lehnte dick beleibt daneben, und der erwartungsfreudige Urlauber verzehrte Ei und Schinkenbrot. Da klingelte es, und Martha brachte die eingelaufene Post. Das treue Tanzstundenfräulein hatte wieder einmal einen dicken hellblauen Brief geschickt, den man auch in der Bahn lesen konnte. Daneben lag auf dem Tablett ein weißes Herrenkuvert. An die Schrift vermochte sich Wichmann nicht zu erinnern. Der Stempel verriet, daß das Schreiben aus seiner Heimatstadt kam. Wichmann aß sein Ei fertig, schaute auf die Uhr – es war noch Zeit –, dann öffnete er und las. »Lieber Herr Oskar!«
Na, wer …? Wichmann drehte den festen Bogen um, um nach der Unterschrift zu sehen: Gottfried Helmbrecht.
Ach, das Diadem! Ob ein reicher Onkel aus Amerika aufgetaucht war?
»Lieber Herr Oskar!
Vor zwei Tagen erhielt ich den überraschenden Besuch einer Frau Marion Grevenhagen, die sich als Gattin des Ministerialdirigenten Grevenhagen auswies. Ich erinnerte mich, daß Sie diesen Herrn als Ihren Vorgesetzten erwähnt hatten.«
Da soll doch der Donner dreinschlagen. Reist das Frauenzimmer hinterher und enthüllt sich …
»Frau Grevenhagen vermochte mir ihr Anliegen als sehr dringend darzustellen, und da ich annahm, Ihnen persönlich durch Entgegenkommen einen Gefallen zu tun, habe ich mich entschlossen, der Dame gegen die Hinterlegung des Schmuckgegenstandes fünfzehntausend Mark auf zwei Monate zinslos zu leihen …«
Zinslos zu leihen … Wichmann ließ den Brief auf den Tisch sinken.
Lieber Helmbrecht, auch du, mein Sohn Brutus – auf deine alten Tage – und du denkst vielleicht, der Wichmann hat Geld und wird einspringen, aus Anstand, wenn die Sache schiefgeht – nein, mein guter Onkel, der Herr Oskar hat auch kein Geld mehr. – Aber die Person war ja wirklich erfolgreich mit ihrer Pumperei.
Fünfzehntausend Mark waren mehr als das Doppelte von dem, was Helmbrecht für das Stück hatte anlegen wollen, wenn er nicht einen Liebhaber dafür fand. Alle Achtung, Marion, du verstehst das Kreditgeschäft. Betreibst du das vielleicht überhaupt im großen, einmal Geliebte? Wichmann konnte sich eines plötzlich aufsteigenden Verdachts nicht erwehren. Was sollte er Helmbrecht schreiben? Sich bedanken für das Entgegenkommen, als ob ihm damit ein Gefallen geschehen sei? Oder sagen: Mein Bester, ich fürchte, du hast eine Dummheit gemacht? Widerliche Angelegenheit, ausgerechnet zum Urlaubsantritt. Man sollte doch die Hände von den Weibern lassen. »Auf dem Weg zu des Teufels Haus haben die Frauen tausend Schritte voraus« – so oder ähnlich sangen ja wohl die Hexlein am Blocksberg.
War dieses Weib doch imstande gewesen – und berief sich auch noch auf die amtliche Eigenschaft ihres Gatten und, weiß der Teufel, auf Wichmann. Es wurde immer besser. Herr Bankdirektor Schomburg schien ihr hart auf den Fersen zu sein. Hoffentlich war er der einzige ungeduldige Gläubiger.
Es tat Wichmann wohl, in so zornigen und groben Ausdrücken über Marion Grevenhagen und auch über den feinen alten Gottfried Helmbrecht zu denken. Er spürte auf einmal den Faden, durch den er immer noch mit der gestorben und begraben geglaubten Liebe verbunden war. Er erschrak wie ein Mann, dem der Geist eines Totgeglaubten wiedererscheint. Er hatte dieses Diadem absichtlich aus seinem Bewußtsein gestrichen gehabt. Nun war es wieder da. Scher dich doch fort … Nein, es blieb. Die Frau Geheimrat hatte einmal erzählt, daß die Japaner ihre Toten auf Umwegen zum Grabe bringen, damit der Geist nicht zurückfinde, und daß sie bei den Gräbern Trauerweiden pflanzen, in denen die Totengeister gerne weilen und die sie davon abhalten, ihre alte Wohnung aufzusuchen. Oskar Wichmann hätte auch eine solche Trauerweide für die Erinnerung an Marion und ihre Geldgeschäfte pflanzen sollen. –
Drüben fuhr das Kabriolett schon ab.
Der Assessor steckte Helmbrechts Schreiben in die Brieftasche und begab sich auf den Weg zum Dienst. Morgen war er hoch oben auf einer Hütte. Von dort konnte er erst einmal kurz, vorläufig, unverbindlich antworten. Hätte er doch Helmbrecht nie in die Sache hineingezogen! Und nie Marion gesagt, daß sie sich unmittelbar mit ihm in Verbindung setzen könne. Lieber Gott, schicke doch dem alten Esel einen recht verrückten Amerikaner, der wenigstens zwanzigtausend Mark bar hinlegt!
Als mittags der Zug ratterte und die Sonne schien, zeigte sich die Relativität von Stimmungen. Wichmanns Hoffnungen auf einen unerwartet guten Ausgang der Angelegenheit schwollen auf einmal an. Zwei Tage später, auf dem ersten Gipfel, versank die unangenehme Erinnerung schon unter den tiefen Talnebeln, und er war zufrieden mit sich, daß er am ersten Abend Helmbrecht mit einigen Zeilen gedankt hatte.
Damit war die Sache vorläufig fortgeschoben.
Als die Urlaubszeit um war und der brausende Zug einen gebräunten Touristen in die Mauern der Stadt zurücktrug, blieben die Gedanken doch noch bei allem Angenehmen. Wichmann zeigte seine helle Freude, als er Kasper an der Bahn vorfand. Der Freund nahm ihn gleich für den Abend in Beschlag und ergriff den Koffer, während Wichmann den Rucksack schulterte. Ein Telefongespräch verständigte die Geheimrätin, daß der Heimkehrer glücklich gelandet, zu Hause aber erst spät zu erwarten sei.
Frau Anna Maria im hellblauen Batist hatte ein opulentes Mahl mit einer Spätzle-Riesenschüssel zum Empfang gerüstet, die Drillinge jauchzten dem Onkel entgegen und bekrabbelten seine Beine und Schultern. Dieta erschien, mit Augen wie der Sommerhimmel, sie warf die Locken aus dem Gesicht und lachte nur, wenn sich die kleinen Fäuste von Hilde, Holde und Tilde, wie sie ihre Lieblinge selbständig getauft hatte, an ihrem Kleid festhielten.
»O nein, Okka, wie fabelhaft du aussiehst! Jetzt mußt du aber erzählen!«
»Ha ja, wir sind alle furchtbar neugierig, Herr Wichmann, mein Mann ganz besonders. Ischt des wahr, daß Sie eine neue Route gemacht haben?«
»Eine Variante, Frau Annemarie, auf einer alten Route. Aber es war ganz nett.«
»Ach, Sie haben einen Weg g’funde, der bequemer ischt als der alte?«
»Im Gegenteil, ich hab’ eine Nuance herausgefunden, die noch ein bißchen halsbrecherischer ist.«
»Das versteh’ ich net ganz. Wenn man auf dem alten Weg besser hinaufkommt, warum gehn Sie dann einen neuen unbequemen?«
»Man sucht den unbequemen, Frau Anna Maria! Warum denn einfach, wenn es auch kompliziert geht, das ist der Ur-Grundsatz von jedem Klettertouristen und jedem Beamten. Aber eigentlich war’s gar kein Verdienst, daß ich die Variante machte, sondern bloß Dummheit und Trotz.«
»Das ischt selten, daß ein Mann des einsieht. – Jetzt nehme Sie sich nur ordentlich von den Spätzle – ’s gibt schon noch eine zweite Schüssel. Wenn Sie meine Spätzle verschmähe, bin ich tief gekränkt.«
»Das tue ich Ihnen natürlich nicht an, Frau Annemarie.« Wichmann liebte es, den Namen zu variieren.
»Und Sie habe sich durchaus den Hals breche wolle?«
»Ich wollte nicht mehr zurück. Ehrlich gestanden, ich hatte mich einfach verstiegen, war ein Stück zu weit geradeaus gegangen im Kamin, statt rechts auszubiegen …«
»Hoch die Wichmann-Variante!« Kasper hob das Mostglas, und man stieß an.
»O du, fein, Okka, das ist tadellos, daß du das gemacht hast. So was möcht’ ich auch mal probieren!«
»Jetzt laßt aber unsern Oskar nur auch einmal essen, ihr neugieriges Weibergezücht. Er hat doch nur eine Zung und kann sie net teile zwischen verschiedenen Beschäftigungen.«
Der Hunger nach der langen Reise war ehrlich und wurde auf zuverlässige Art gestillt. Beim Most erzählte Wichmann seine Hüttenerlebnisse, er erzählte von Nachtlagern auf Bänken, Tischen, Strohsäcken, von Schnarchern, Witzbolden und Salontirolern. Dieta konnte nicht genug hören. Mitternacht war schon vorüber, als man sich endlich trennte.
Wichmann und Kasper begleiteten das junge Mädchen gemeinsam in ihr Studentinnenheim und bummelten durch die warme Augustnacht weiter, Wichmanns Behausung zu. Die Bäume des Parks rauschten leise, die Sterne leuchteten hell und kräftig. Kasper hatte von seinen drei Töchtern und ihren Streichen berichtet und von einer sehr vergnügten Karte des Fräulein Hüsch vom Tegernsee. Wichmann amüsierte sich über die Blicke, mit denen die wenigen Nachtpassanten seinen Rucksack musterten, Casparius schlug bei jeder zweiten Bank vor, den Koffer abzustellen. Es war immer wieder hübsch, ins dunkle Laub zu schauen und noch etwas von dem Sauerstoff der Luft zu atmen, den lebende Pflanzen ausströmen. Von der letzten Bank, auf der man sich niederließ, konnte man in die laternenerleuchtete Kreuderstraße hineinsehen.
»Da bischt also wieder, Oskar, eingefangen in unserem Räderwerk des Dienstes. Die Geheimrätin hat dir gewiß noch ein ›Betthupferle‹ hingestellt, einen Schokolad oder ein Gutsle oder so was, daß du die erschte Nacht süß entschlummerscht. Morge kommscht du dann wieder in unsre Ottostraße! Der Korts hat deine Vertretung ganz gut g’macht und net viel liege lasse. Du kannscht sanft anfange mit der Arbeit und dich gleich genügend für unsre neueschten Gerüchte interessiere.«
»Was gibt’s denn schon wieder?«
»Der Herr Bankdirektor Schomburg geht umher wie ein brüllender Löwe …«
»Ach, laß mich bloß zufrieden. Was hat er denn schon wieder unternommen, der zwickelnäsige Esel?«
»Am Samschtag war er beim Grevenhagen.«
»Woher weißt du denn das?«
»Ha, im Minischterium ischt er gewesen, des wird unsereins doch noch wissen dürfen. Mit meinem Talent, die Großen der Welt zur unrechten Zeit aufzusuchen, bin ich grad im Vorzimmer g’sesse, wie der Schomburg ’rauskommt. Der Grevenhagen hat mich dann ’reing’holt, aber ich schätze, daß irgendein Gemüsebeet verhagelt war. – Jedenfalls macht er jetzt alles anders, als ich’s hab’ haben wollen.«
»So, so.«
»Ja, ja.«
»Komm, gib mir den Koffer, Kasper, ich trag’ ihn selber heim.«
»Laß. Ich werd’ doch des Köfferle noch tragen können.«
Die Freunde erreichten das geheimrätliche Haus. Kasper ließ sich durchaus nicht überreden, mit hinaufzukommen und noch einen französischen ›Cognac‹ zu trinken.
»Nein, nein, Lieber, du brauchst jetzt den Schlaf! Auf Wiedersehe morgen! Ehrlich – mir tut’s im Minischterium gar nimmer g’falle ohne dich! Ich bin froh, daß du wieder da bischt! Servus!«
Er machte kehrt, Wichmann sah ihm noch nach, bis er um die Straßenecke verschwand. Dann schloß der Assessor die Haustür auf.
Auf der Treppe kam ihm schon Marthas flinker Schritt entgegen. Sie griff nach dem Koffer und führte den Assessor in sein gründlich gereinigtes und gelüftetes Zimmer. Auf dem kleinen Tisch stand ein Teller mit Honigplätzchen. Der Assessor sagte »Ah!« und bemerkte, daß er schon wieder essen konnte.
»Haben Sie sich diese Mühe gemacht, Martha, für mich zu backen? Das ist sehr freundlich von Ihnen. Die Plätzchen sind wirklich gut.«
»Darf ich noch einen Tee bringen? Oder sonst etwas?«
»Danke, danke, nein. Es ist allmählich Schlafenszeit.«
»Der Herr Assessor ist nach der langen Reise sicher sehr müde?«
»Es geht. Seit vier Uhr früh unterwegs. Aber morgen müssen wir wieder zum Dienst frisch sein.«
»Ja, der Herr Assessor ist immer so fleißig. Aber der Urlaub war hoffentlich schön?«
»Sehr schön.«
»Ich danke auch für die hübsche Karte. Aber auf diesem furchtbaren Berg ist der Herr Assessor doch nicht oben gewesen?«
»Freilich oben gewesen. Da geht ein ganz guter Weg hinauf.«
»Das wär’ nichts für mich. Ich ginge lieber an die See.«
»Wann machen Sie denn Urlaub?«
»Ach, ich weiß noch nicht. Wenn meine Cousine mich hier vertreten kann – aber die müssen jetzt daheim noch auf dem Feld helfen. Vielleicht zum Herbst.«
Wichmann aß das fünfte Plätzchen. Was wollte denn Martha noch? Sie war heute ungewohnt redselig.
»Will der Herr Assessor nicht wenigstens noch die Anzüge aus dem Koffer nehmen?«
»Ist nur ein einziger drin, Martha, den habe ich nachher schnell ausgepackt. Lassen Sie sich nicht aufhalten. Sie haben Ihren Schlaf auch nötig.«
»Ach, ich bin ausgeruht. Ich bin froh, daß der Herr Assessor wieder da ist. Es war langweilig in der großen Wohnung allein.«
»Na, von mir haben Sie ja sonst auch nicht viel.«
»Wenn man weiß, daß noch jemand da wohnt, das genügt schon. Es ist sonst so still hier – in der ganzen Straße überhaupt. Nicht?«
»Mir ist die Stille recht, Martha. Darum bin ich hierhergezogen.«
»Ja, es ist auch wieder schön, das ist wahr. Ich möchte auch nirgends anders mehr sein. Man hat seine Arbeit und ist zufrieden, und mehr will man auch nicht.«
Wichmann schaute das Mädchen jetzt aufmerksam an. Mehr will man auch nicht? Vielleicht stand hier ein Mensch, der doch mehr wollte oder einmal mehr gewollt hatte?
Martha hatte ein eigenartiges Gesicht. Sie war ein dunkler Typ, das schwarze Haar war sehr voll, und sie trug es altmodischer Weise lang, mit einem Knoten im Nacken. Ihre von Natur bräunliche, matte Haut brauchte keine besondere Pflege, um gut auszusehen. Auch ihre Hände waren feinporig und trotz der Arbeit des Gemüseputzens und Kartoffelschälens niemals rot. Sie hielt sich aufrecht und betrachtete die Menschen aus Augen, die das eigenartigste an ihr waren. Diese Augen lagen zurück und blieben meist halb geschlossen; die Wimpern waren lang und gaben dem Blick als Rahmen noch mehr Ausdruck. Martha sagte nie etwas Dummes, wenn sie vielleicht auch nie etwas besonders Kluges gesagt hatte. Trotz des langjährigen Dienstes bei der Geheimrätin hatte sie deren Gewohnheit, zu plaudern, nicht angenommen. Was wollte sie jetzt?
»Wenn Sie zufrieden sind, ist es ja gut«, meinte Wichmann vorsichtig. Er hatte mit der Weiblichkeit in der großen Stadt schon einige schwierige Erfahrungen gemacht und war sich bewußt, daß ein junger und gut aussehender Mann äußerst zurückhaltend bleiben mußte, sofern er nicht wünschte, einem Mädchen wirklich näher zu kommen. Das aber wünschte der Assessor in dem gegebenen Falle nicht. »Dann schlafen Sie sich mal schön aus, Martha.«
»Ach, mir ist oft gar nicht ums Schlafen. Des Tags hat man seine Arbeit, aber abends, da denkt man oft nach und hat so seine Gedanken …«
Was war denn nur mit dem Mädel? Er konnte sie nicht aus dem Zimmer hinauskriegen. Von zwanzig Honigplätzchen hatte er jetzt acht gegessen.
»Die Gedanken lassen Sie sein, Martha, und legen sich aufs Ohr. Das ist gesünder.«
»Wenn man’s so könnte. Ach, ich denke oft, ich werde wohl nicht allein meine Sorgen haben …«
»Sicher nicht, Martha.«
Wichmann hatte nun doch angefangen auszupacken, und Martha half ihm.
»Aber lassen Sie das, Martha. Sie sind müde genug. Gehen Sie zu Bett!«
»Ich bin nicht müde, ich habe ja heute Ausgang gehabt.« Martha machte sich an den Rucksack.
»Haben Sie einen Ausflug gemacht?«
»Nein. Wir sind ins Café gegangen und ins Kino, meine Freundin und ich. Ich habe ja meine Freundin drüben in der Kreuderstraße 3 – die Franziska. Erinnern Sie sich an Fanny?« Wichmann erinnerte sich wirklich. Fanny, diese blonde Katze, graziös und flink, kokett in den Formen, die der Dienst ihr gestattete, war ihm aufgefallen. Sie war sehr verschieden von Martha, aber vielleicht zog gerade diese Verschiedenheit die beiden Mädchen zueinander.
»Ganz recht, Herr Assessor, sie hilft beim Nachmittagsempfang mit. Sie ist eigentlich die Jungfer, ganz perfekt, aber beim Servieren springt sie mit ein, wenn jemand auf Urlaub ist. Sie hat eine schöne Stellung drüben, aber auch anstrengend.«
Wichmann überlegte wieder. Wollte Martha über das Haus Grevenhagen klatschen? Fanny war sicher eine gute Nachrichtenquelle.
»Ja, anstrengend, das glaube ich, bei der vielen Geselligkeit«, antwortete der Assessor, reserviert und doch nicht abweisend. Im Grunde wollte er ebenso gern etwas erfahren, wie Martha hoffte, etwas erzählen zu dürfen. War es nicht lächerlich, wie ein gut erzogenes Mädchen und ein gut erzogenes Mitglied des Ministeriums hier um den springenden Punkt herumredeten, nur weil sie sich beide schämten, das zu tun, was sie letzten Endes doch nicht lassen würden? Wichmann hegte keinen Zweifel mehr, daß Martha irgendeine Neuigkeit auf dem Herzen hatte, die sie noch aussprechen mußte, ehe sie schlafen ging, und er selbst wünschte diese Neuigkeit zu erfahren … Wünschte er das wirklich? Ja, er wünschte es. Aber weil keiner dem anderen gestehen wollte, mitteilungsbedürftig und neugierig zu sein, mußte um Mitternacht viel Zeit verschwendet werden, in der man den Erfordernissen der gesellschaftlichen Erziehung durch Redensarten formal Genüge tat.
»Die gnädige Frau drüben, die junge, ist sehr anspruchsvoll«, fing Martha wieder an.
»Kann ich mir denken.«
»Und Fanny ist froh, wenn sie einmal einen wirklich freien Sonntag hat. Sonst, bezahlt wird ja gut, und dazu kommen die hohen Trinkgelder.«
»Es hat je de Stellung ihren Vorteil und ihren Nachteil.«
»So ist’s, Herr Assessor. Wenn man älter wird, sieht man’s ein. Aber heute – nein – das war furchtbar.«
»Was denn?«
Der Rucksack war ausgepackt und alles an seinen Platz geräumt. Der schlaffe Sack lag beim leeren Koffer. Martha wollte beides zum Ausstauben mitnehmen. Wichmann hatte sich zur zweiten Hälfte seiner Honigplätzchen zurückgezogen.
»Ja, furchtbar, das muß man sagen. Die Fanny zitterte noch am ganzen Leibe.«
»Warum denn? Ist ihr gekündigt worden?«
»Nein, nein, was Sie denken, Herr Assessor. Es geht sie eigentlich gar nichts an, aber man regt sich doch auch auf – wenn man eben so lang bei den Herrschaften ist.«
»Was hat’s denn gegeben?«
»Sie wollte es mir erst gar nicht sagen. Ich hab’ gleich gemerkt, daß da was ist, und sie war noch ganz blaß, wie wir uns am Nachmittag trafen. Erst wollt’ sie’s nicht wahrhaben, aber im Kino hat sie geheult, und wie wir dann noch ein Glas Bier trinken gegangen sind …«
»Da hat sie Ihnen die Schauermär erzählt? Es wird ja gar so furchtbar nicht sein, Martha.«
»Ach, ich kann nicht schlafen, wenn ich daran denke. Wie so etwas nur möglich ist!«
Wichmann betrachtete die beiden letzten Plätzchen auf seinem Teller.
»Erzählen Sie, Martha, was Sie auf dem Herzen haben. Obwohl ich ja sonst nicht fürs Klatschen bin. Das wissen Sie.«
»Nein, wer wird denn ans Klatschen denken! Der Herr Assessor ist doch verschwiegen wie’s Grab. Sonst dürfte ich ja gar nichts sagen.«
Wichmann warf sich in den Lehnstuhl mit den Löwenköpfen. »Schießen Sie los, Martha! Sonst wird’s zu spät!«
»Ja – wo soll ich anfangen? Die Fanny hat so geweint, und beim Bier hat sie’s mir dann erzählt. – Herr Ministerialdirigent Grevenhagen ist am Sonnabend ganz verstört heimgekommen …«
»Woran war denn das zu erkennen?«
»Er hatte schon die Fleischgabel für den Fisch in der Hand – ganz durcheinander und noch blasser als sonst. Johann hat es gut gemerkt. Aber am Sonnabend geschah weiter nichts, da war die ganze Familie zum Gartenfest bei von Lincks eingeladen und kam erst spät nach Hause. Der Herr und die gnädige Frau schlafen ja durch eine Zwischentür getrennt. Am Sonntag morgen war es dann, nach dem Ausritt und nach dem zweiten Frühstück.«
»Hm?«
»Die Fanny half bei der gnädigen Frau oben im Ankleidezimmer, als der gnädige Herr auf einmal hereinkam. Die Fanny ist natürlich sofort gegangen, weil sie seinen Blick verstanden hat, und ist nebenan im Schlafzimmer geblieben …«
»… und hat gelauscht?«
»Aber nein, was denken der Herr Assessor, so etwas tut kein Mädchen, das auf sich hält. Die Herrschaften wußten ja, daß sie nebenan ist, aber sie dachten nicht, daß sie Französisch versteht, aber die Fanny hat schon viele erstklassige Stellungen gehabt, und zum Verstehen reicht’s schon bei ihr mit dem Französischen.«
»So.«
»Ja – und nun – der Frau Geheimrätin hab’ ich’s noch gar nicht gesagt die wird sich ja aufregen – daß das … nein … die Frau Grevenhagen hat doch furchtbare Schulden gemacht bei einem Herrn Schomburg, das ist ein Direktor von irgend so einer Bank – und die Wechsel waren schon fällig.«
»Ach, du lieber Himmel.«
»Ja, da erschreckt sich der Herr Assessor auch, nicht? Es ist kaum auszudenken. Der Herr Grevenhagen muß jetzt alles bezahlen.«
»Wenn er das will und kann, ist es ja in Ordnung.«
»Können wohl – er muß reich sein – aber immerhin – er war sehr böse.«
»So.«
»Ja. Schimpfen tut so ein Herr natürlich nie. Aber die Fanny erzählt, der gnä’ Herr und die gnä’ Frau haben nur alle paar Minuten ein Wort zueinander gesagt – aber das hat dann gesessen wie ein Messerstich. Es war schrecklich. Eine halbe Stunde ist es so gegangen und in der ganzen Zeit keine zwanzig Worte gesagt – die Stimmen klangen so, als ob die gnädige Frau im Sessel sitze und der gnädige Herr ziemlich weit von ihr entfernt bei der Tür stehe – und dann hat der gnä’ Herr die Fanny gerufen, weil der gnä’ Frau nicht gut sei, und die Fanny hat Kölnischwasser gebracht und einen starken Wein, denn die gnä’ Frau war halb ohnmächtig, und ihr Puls war kaum zu spüren. Aber der gnä’ Herr ist leise hinausgegangen, und das Mittagessen hat die gnä’ Frau im Bett eingenommen. Aber wie wird es jetzt drüben aussehen? Nein, man kann es nicht glauben.«
»Regen Sie sich nicht auf, Martha, die Angelegenheit ist gar nicht so erschütternd. Ein paar hunderttausend Mark, das ist für solche Leute nicht mehr als ein paar hundert Mark für Sie – bitter, wenn man sie verliert – aber durchaus zu ertragen. Diese Sache wird rasch beigelegt sein.«
»Glauben Sie, Herr Assessor? Aber die Fanny hat gesagt, es war ganz furchtbar.«
»Das kommt einem im Augenblick so vor. Aber nein, nein, deshalb brauchen sich weder Fanny noch Sie graue Haare wachsen zu lassen. Wäre schade um ihr jugendliches Aussehen!«
»Ach, der Herr Assessor spottet. Aber ich will jetzt gehen, es ist schon zu spät.«
»Gute Nacht, Martha.«
»Gute Nacht, Herr Assessor. Wünsche, recht wohl zu ruhen.«
Das Mädchen ging.
Wichmann schaute auf seinen leer gegessenen Teller.
So weit war es also schon. Schomburg bekam sein Geld. Er bekam es – wußte der Himmel, ob sich noch andere Gläubiger meldeten und ob Grevenhagen sie alle befriedigen konnte. Mußte Wichmann nicht Helmbrecht warnen? Aber zwei Monate Frist waren nun einmal ausgemacht. Und er, Wichmann, konnte jetzt nicht noch die Hunde auf Grevenhagen hetzen.
Nein, das konnte er nicht.
Fünfzehntausend Mark waren dann freilich ein kleiner Teilbetrag gewesen, und Schomburg hatte sich nicht damit abgefunden.
Weiber, Weiber … nein. Wichmann beschloß, nicht ans Heiraten zu denken. Übel war es, wenn über die Sache gesprochen wurde. Aber wie dem Mädchen und der Frau Geheimrat Schweigen gebieten? Das war vergebliches Bemühen. Sie schwiegen so wenig wie die Herren Beamten.
Wichmann schlief trotz der Nachricht, die seine Gedanken und Gefühle stark beschäftigte, sehr bald ein. Körper und Nerven waren erholt.
Im Dienst verliefen die drei ersten Tage ruhig. Der Assessor bemerkte wohl, daß bei Erwähnung des Namens Grevenhagen immer ein Augengeblinker und verlegenes Lächeln entstand, aber er kümmerte sich nicht darum. Als er sich bei dem Ministerialdirigenten vom Urlaub zurückgemeldet hatte, war er verbindlich und kurz, wie immer, empfangen worden. Von der Wirkung privater Angelegenheiten war Grevenhagen äußerlich nichts anzumerken.
So kam der Donnerstag, an dem der Himmel trübe war und Wichmann sich mit wiedereinsetzender Arbeitslust in seine Tätigkeit stürzte. Die Neueingänge auf dem Aktenbock waren schon erledigt. Wichmann hatte sich Material zur Vorbereitung der Verordnung zusammengeholt, die demnächst erlassen werden mußte, und feilte an dem Text. Es war viel zu bedenken, wenn man den Herren Parlamentariern keinen Angriffspunkt geben, die Praxis befriedigen und vor Grevenhagens Sachwissen standhalten wollte. Das Wort »hinsichtlich« war zu vermeiden.
Wichmann hatte das Klopfen kaum gehört, da tat sich die Tür auch schon auf, und Kaspers treuherziges Gesicht erschien. Die rundlichen Wangen waren rot angelaufen, der Freund schlug gegen seine sonstige Gewohnheit die Tür heftig hinter sich zu, ließ sich mit ausgestreckten Beinen auf einen der beiden vorhandenen Stühle fallen und warf Wichmann ein Zeitungsblatt über den Verordnungstext zu.
»Da … jetzt haben wir den Salat.«
»Was ist denn los?«
»Lies nur.«
»Ich kann doch nicht die ganze Zeitung lesen. Du mußt schon so gütig sein und mir einen Wink geben, welcher Erguß der Journaille dein Seelenleben derangiert, daß du hier eindringst wie Kimbern und Teutonen. – Halt, laß mir meinen Verordnungstext liegen. Es genügt, wenn du die Zeitung wieder in deine zitternden Finger nimmst. Wer hat sich denn verlobt? Schildhauf mit der Hüsch oder der Baier oder der Korts?«
»Schweig mit deinem Lästermaul, Wichmann, das Spotten wird dir gleich vergehen.«
»Was ist das überhaupt für ein albernes Käseblatt? Schämst du dich nicht, so was zu kaufen?«
»Ich bin froh, daß ich noch ein Stück davon ergattert habe. Jetzt ischt es schon ausverkauft …«
Wichmann schüttelte den Kopf.
»Du sitzt natürlich wieder in deiner Mönchszelle«, tadelte Kasper, »und ahnst die Wogen der Welt nicht, die dreckschäumend über uns gehen! Weischt du net, daß des Blättle draußen am Zeitungsstand auf ’m Königsplatz verkauft worde ischt! Die haben ein Geschäft gemacht! Die sind saniert für ein halbes Jahr! Ich seh’ immer noch, wie sich der Borowski bei der Lektüre die Lippen schleckt!«
»Wie heißt das Ding? ›Nachrichtenblatt‹? Na, ist das nicht die elende Klatschjauche? Warum faßt du das überhaupt an?«
»Das wirst du gleich sehen. Wenn Dreck auf meinem Weg liegt, muß ich durch, auch auf die Gefahr hin, daß es nachher Schuh zum Putzen gibt. Da – lies. Ich mag’s nimmer angucke.«
»›Aus der guten Gesellschaft‹?«
»Jawohl.«
»›In diesem Zusammenhang wird … ‹ In was für einem Zusammenhang?«
»Ein paar Sätze vorher.«
»… hat die Statistik des akademischen Nachwuchses und seiner Herkunft gezeigt, daß immer noch ein großer Teil der Studentenschaft aus Akademikerfamilien stammt. Da in diesen Kreisen die Vermögen vielfach durch die Inflation vernichtet sind, bleiben jetzt auch oder gerade für sie die Studentenbeihilfen, in welcher Form sie immer gewährt werden mögen, von erheblicher Bedeutung. Versiegt irgendeine derartige Quelle, so ist die berufliche Laufbahn begabter Studenten immer auf das bedauerlichste gefährdet.
In diesem Zusammenhang wird auch viel über die angeblichen Schwierigkeiten eines angeblich im Ausland gelegenen Gutes gesprochen. Die kultivierte Lebensführung läßt sich in seltenen Fällen aus dem laufenden Einkommen allein bestreiten, das Vermögen spielt seine Rolle als traditioneller Kulturträger und wird rein geschäftlich gesehen immer die Möglichkeit des Kredites zur Überbrückung zeitweiser Ausfälle eröffnen. Schwankungen der Konjunktur, auch wenn sie vorausgesehen wurden, können hier allerdings eine verderbliche Rolle spielen, und der ›Run‹ ist für den Privatmann nicht weniger ruinös, als er bei Ausbruch von Krisen immer für die Banken gewesen ist. Es ist dabei für Wirtschaft und Gesellschaft ohne Zweifel wichtig, daß heute der Beamte in ihrem Aufbau im Vordringen ist und mit seinem gesicherten, wenn auch nicht allzu hohen Einkommen ein festes Gerüst abgibt, sofern die Ehrenhaftigkeit seiner Lebensführung mit den Begriffen, die man sich darüber zu machen pflegt, übereinstimmt und das dürfte ja nur in wenigen Fällen nicht zutreffen, die dann um so mehr und auch berechtigtes Aufsehen erregen.‹«
»Und was soll der ganze Quatsch?«
»Willst du leugnen, Freund, daß du kapiert hascht? Madame Grevenhagen hat die Geschäftsführung eines Fonds für Studentenhilfe – Madame Grevenhagen stammt von einem polnischen Gut, obgleich auch das schon bezweifelt wird – Madame Grevenhagens Gatte ischt Beamter, sein Lebensstandard geht weit über sein Beamteneinkommen hinaus. Aber lies nur weiter. Es kommt noch besser.«
»›Der Fall Emmerich, der nun entschieden ist mit einem Vergleich auf der Basis von 60 : 1, hat die Diskussion über die Gütertrennung im Ehestand und die möglichen Folgen für die Gläubiger wieder ins Rollen gebracht. Nicht weniger interessant sind die Folgen dieser Rechtskonstruktion für die beteiligten Eheleute selbst. Der Ehemann kann sich – wenn wir einmal den Fall setzen wollen – vor der Situation sehen, daß weder Gattin noch Bank ihm Auskunft über die Vermögensverhältnisse der Frau geben, andererseits Gläubiger auftauchen, die Schuldtitel auf den Namen der Frau der Rechtlichkeit des Ehemannes präsentieren. Es wird sich sofort der Zweifel erheben, ob der Betreffende tatsächlich von nichts gewußt habe und wie weit er moralisch verpflichtet ist einzuspringen.‹«
»Reizend.«
»Ja, mein Lieber. Stell dir den Boschhofer und den Nischan vor, wie die das zusammen gelesen haben und wie dem Boschhofer sein Bauch vor Freude gehopst ischt!«
»Kann man nichts machen gegen eine solche Schweinerei?«
»Wozu hascht du Jura studiert, mein Freund? Mit Beleidigungsprozeß kommt da nix zustand. Den Redakteur erschieße – zahlt sich auch net aus. Du bischt hilflos gegen die Eberzähne und kannscht dich nur auf die Verleumdungsarie zurückziehe. ›Und der Arme muß verzagen – den Verleumdung hat geschlagen!‹«
»Da nimm dein Dreckblatt wieder. Ich mache meine Verordnung fertig.«
»Auf Wiedersehen.« Casparius klopfte Wichmann, der sich über die Arbeit beugte, seufzend auf die Schulter und verließ das Zimmer.
»Der Grevenhagen tut mir leid«, hatte er noch im Hinausgehen gesagt.
Wichmann spürte den eigenen heißen Kopf. Dieser Hundsfottartikel war natürlich das Signal dafür, daß sich alles, was an Gläubigern der Marion Grevenhagen vorhanden war, auf den Gatten stürzte. Der Zweifel an seiner Ehrenhaftigkeit, der Spott über seine mangelnde Orientierung waren eine Gemeinheit. Wer hatte diesen Artikel veranlaßt? Wie sie jetzt gelaufen waren, die Herren Mitarbeiter, um noch ein Stück von diesem Schundblatt zu bekommen! Wen hatte wohl Boschhofer geschickt, es besorgen zu lassen? Oder hatte Nischan ihm gleich eines mitgebracht?
Ahnte Grevenhagen schon etwas von der Sache? Hoffentlich nicht. Er konnte ja doch nichts tun, als den Angriff an sich ablaufen lassen und die Folgen abwarten. Das Thema für die ›Stille Klause‹ stand jedenfalls fest.
Als Wichmann des Abends nach Hause kam und gebürstet, gekämmt im besseren Rock erschien, um mit der Geheimrätin unter dem Ölporträt des alten Geheimrats Krautwickel zu speisen, sah er auf einem Nebentisch das ›Nachrichtenblatt‹ liegen und verschluckte sich beim ersten Bissen.
»Ach, Herr Doktor Wichmann, was sagen Sie nur zu diesem entsetzlichen Skandal! Daß man so etwas erleben muß in unserer Kreuderstraße! Bei dieser Familie! Mich traf fast der Schlag, als heute beim Tee der Frau Rohrbach schon alles davon sprach! Ich hatte ja einiges unter der Hand gehört, was mich tief erschütterte …«
»… von Martha?«
»Ach … hat sie mit Ihnen auch darüber gesprochen? Ich kann mich noch gar nicht fassen. Es ist unbegreiflich. Wie werden die alten Exzellenzen darunter leiden! Was sagt man denn im Ministerium dazu?«
»Da werden so ein paar Anwürfe in einer wenig angesehenen Zeitung wohl unbeachtet bleiben. Grevenhagens Ehrenhaftigkeit ist über jeden Zweifel erhaben.«
»Das denken Sie doch auch? Nicht wahr? Aber diese Sache mit Schomburg und diese entsetzliche Szene – hat Ihnen Martha das auch erzählt? Frau Grevenhagen hat ihrem Gatten doch jede weitere Auskunft über ihre finanziellen Verhältnisse verweigert. Was will er machen? Die Bank ist zur Diskretion verpflichtet. Er kann sich überhaupt nicht orientieren.«
»Ich nehme an, daß er der Mann dazu ist, doch zu erfahren, was er wissen will.«
»Ja, aber wie? Er kann seine Frau doch nicht prügeln oder würgen. Scheiden lassen dauert lang – um Gottes willen, was ist denn los?«
Auch Wichmann war aufgesprungen. Ein lauter Ruf oder Schrei einer menschlichen Stimme war von der anderen Straßenseite her ins Zimmer gedrungen. Martha stürzte aufgeregt, mit aufgerissenen Augen herein. »Frau Geheimrat! Um Gottes willen! Sie bringen sich drüben um!«
Die beiden Frauen liefen in Wichmanns Zimmer an die geöffneten Fenster. Martha rang die Hände.
»Die junge Frau hat laut geschrien – sie hat Worte gerufen – habe nichts verstehen können – jetzt ist es wieder still.«
Wie zu allen Tagen breitete der Ahornbaum sein Laub über die eiserne Pforte. Rosenduft zog durch den Abend. Das eine sichtbare Fenster der Gartenvilla war durch den Vorhang gegen außen abgeblendet. Im Zimmer schien Licht zu brennen, wie ein heller Schein verriet.
»Mein Gott, mein Gott, Herr Wichmann, was werden wir noch erleben müssen! Was haben Sie denn gehört, Martha?«
»Ich will doch gerade dem Herrn Assessor das Zimmer für die Nacht fertigmachen – lasse die Fenster noch auf, wie er’s gern hat und bin an der Couch – da höre ich einen Schrei – ja, die Tür hatte ich auch offengelassen, deshalb wird es die Frau Geheimrat auch gehört haben – und es muß drüben ein Fenster offen gewesen sein oder vielleicht nur angelehnt – und ich horche sofort, und da wird drüben noch etwas laut gerufen – ein paar Worte – es war die Stimme der jungen Frau – und dann ist es gleich wieder ganz still gewesen. Aber an dem Fenster, das man drüben sehen kann, hat sich nichts gerührt.«
»Es ist ja grauenvoll – sehen Sie, unsere Nachbarn sind auch alle an den Fenstern – ein solch entsetzlicher Skandal! Ich werde heute nacht kein Auge zutun. Was wird denn nur geschehen sein!«
»Eine eheliche Auseinandersetzung, gnädige Frau, ist sicher nicht so schlimm. Die junge Frau Grevenhagen bleibt meist sehr ruhig, doch ich glaube, wenn ihr Temperament erst ins Schwingen kommt, kann sie auch einmal sehr heftig werden. Wir dürfen aber in Frieden schlafen, ohne uns Sorgen zu machen, davon bin ich überzeugt.«
»Es ist eine Wohltat, Ihre besonnene Stimme zu hören, Herr Doktor. Es scheint nun auch wirklich wieder Ruhe eingekehrt zu sein. Was muß das für eine Szene gewesen sein. Mein Herz klopft noch wie ein Hammer. Aber kommen Sie – die Krautwickel und die Kartoffeln werden kalt.«
Man begab sich wieder zu Tisch.
»Ich würde auf Martha einwirken, gnädige Frau, damit sie sich möglichst wenig an dem Klatsch über die Kreuderstraße 3 beteiligt und auch ihre Freundin Fanny warnt. Die Mädchen wissen ja gar nicht, was sie anrichten und wie sie sich selber womöglich noch Unannehmlichkeiten zuziehen können.«
Wichmann nahm sich die zweite Krautrolle. Essen mußte man schließlich.
»Aber habe ich Ihnen nicht immer gesagt, Herr Doktor, diese Heirat war ein Unglück?! Die alten Exzellenzen tun mir maßlos leid! In dem Artikel ist ausgedrückt, daß vielleicht noch viel mehr Verpflichtungen bestehen als die gegenüber Schomburg – und denken Sie, ein paar hunderttausend Mark Vermögen von Vater und Großvater auf den Tisch legen für die Schulden von solch einem Weibsstück! Es ist unerhört!«
»Es kommt darauf an, gnädige Frau, welchen Bruchteil des Vermögens der Betrag darstellt.«
»Ja, reich sind die Grevenhagen, Herr Doktor, aber solche Schulden sind kein Pappenstiel. Nein, wenn das mein Mann noch erlebt hätte! Wenn das nur nicht noch ein ganz großes Unglück gibt!«
Wichmann spürte die Schauer, die ihm die Haut zusammenzogen.
»Und wer wird noch alles in die Sache verwickelt sein? Wer wird dieser Person Geld geliehen haben?«
Der Zuhörer spürte die Augen der Geheimrätin und dachte an den Abend, an dem er um Ermäßigung der Miete und häufigere Mahlzeiten im Hause gebeten hatte. Er hatte damals von einem Schulden machenden Verwandten erzählt.
»Um diese Frage brauchen wir uns ja glücklicherweise nicht den Kopf zu zerbrechen, gnädige Frau.«
»Glücklicherweise, ja! Zu dem Studentenfonds habe ich fünfzig Mark gegeben, obwohl mir’s in dem Augenblick nicht leicht fiel – Frau Grevenhagen war mit ein paar Damen zum Tee bei mir – Sie erinnern sich, ich erzählte davon – wenn sie die Stiftung veruntreut hat, das wäre unerhört!«
»Es braucht nicht jede infame Anspielung der Wahrheit zu entsprechen, Frau Geheimrat! Ich bin überzeugt, daß die Angelegenheiten der Stiftung in Ordnung sind.«
»Na wissen Sie – wenn jemand mit dem Betrügen schon anfängt … Nein – nein – aber nehmen Sie doch mehr Süßspeise, Herr Assessor. Ein junger Mann wie Sie muß essen!«
Wichmann war nun doch der Appetit vergangen.
Er verabschiedete sich bald, um den weiteren Feststellungen, wie entsetzlich, unerhört und furchtbar das alles sei, zu entgehen. Er nahm gegen seine Gewohnheit ein abendliches Bad, um sich selbst zu beruhigen, und schlüpfte unter die Daunen. Er war nicht mehr an das Fenster getreten und hatte nicht hinausgesehen. In der Luft um ihn lag eine schwüle Bedrohung. Der treuherzige Kasper mit seinem Zorn, die witzelnden Kollegen, Marthas Bericht und die erregte Geheimrätin waren wie fahles Wetterleuchten vor aufziehenden Wolken. Wichmanns Gedanken vermieden peinlich den Punkt, an dem er sich hätte eingestehen müssen, daß der Ministerialdirigent Grevenhagen unter den Gläubigern seiner Frau auch den Assessor Wichmann finden konnte.