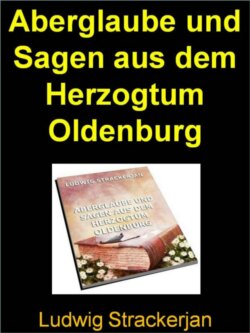Читать книгу Aberglaube und Sagen aus dem Herzogtum Oldenburg - 991 Seiten - Ludwig Strackerjan - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 4
Оглавление78.
In Oldenburg glaubte man früher fest, daß der Herzog
Peter Friedrich Ludwig (gest. 1829) um jeden Brand,
den er erreichen könne, herumfahre und einen Spruch
murmele, welcher den Brand ersticke. Sein Sohn und
Nachfolger Paul Friedrich August (gest. 1853) besaß
gleichfalls die Gabe, obschon im geringeren Grade.
Auch Geistlichen legt man die Gabe des Brandbesprechens
bei.
79.
Gegen Blutungen:
a.
Johannes der Evangelist
taufte unsern Herrn Jesum Christ
am Flusse Jordan,
worauf das Blut stille stand.
b.
Johannes, du Evangelist,
der du den Herrn Jesum Christ
getaufet am Jordan,
wo dies Blut blieb stille steh'n. Vater unser
(Münsterld.)
c.
Jesus Christ kam zum Jordan, da Johannes lagerte,
um sich daselbst taufen zu lassen, und sprach: Jordan
stehe still! Also gebe ich dir Blut auf, still zu stehen.
J.N.G.d.V., d.S.u.d.h.G. (Goldschmidt, Volksmedizin
S. 57).
d.
Jesus und Johannes gingen über das Meer, Jesus
schlug mit seinem Mantel auf das Meer, und es stand
still. So möge auch dieses Blut nun stille stehen. Drei
Vater unser (Saterld.).
e.
Jesus, stromet Wind und Meer,
das das Blut gestillet wehr,
das es nicht eckt (schwärt),
und auch nicht steckt
und auch nicht kellt (schmerzt),
und auch nicht zwellt (schwillt).
(Handschriftl. aus dem Saterlande.)
f.
Blut stehe still um Christi willen, des Sohnes Gottes,
zur ewigen Seligkeit, Amen. (Ammerld.). Soll auch
gegen Natternbiß helfen.
g.
Im Namen Jesu. Christus und Johannes gingen über
eine hohe steinerne Brücke. Sie stechen ihn in den
Rucken (2 mal), sie stechen ihn bis an die Rippen,
und dies stillet solches Blut. Kreuz über die Wunde
machen.
h.
Jesus und Maria gingen über eine Brücke, das Wasser
ging vorrücke, das Wasser soll gehen, das Blut stille
stehen. Kreuz über die Wunde machen.
i.
Moses ging durch das rote Meer, schlug mit dem Stab
in die Flut, die Flut die stund. So do du, Blod
(Münsterld.).
k.
Bei stark blutenden Wunden:
Jesus ging mit seiner Mutter an d i e See. Er
pflückte eine Rute an d i e See, schlug mit der Rute in
d i e See, stille stand d i e See und das Blut ging
nicht mehr. (Das »die« ist stark zu betonen.) Dabei
streicht der Segnende kreuzweise mit dem Finger über
die Wunde (Schweiburg).
80.
Gegen den Brand:
a.
Ich segne dich loße Brand
mit die göttliche milde Hand,
das es nicht eckt,
und auch nicht steckt,
und auch nicht kellt,
und auch nicht zwellt.
b.
Du böser Brand!
Ich will dich segnen
mit Gottes milder Hand,
das nicht eckt,
und auch nicht steckt,
und auch nicht kellt,
und auch nicht zwellt.
Gegen Brandwunden: Kalt ist die Hand (oder der
Teil, der verbrannt ist), kalt ist das Wasser, kalt
ist der Sand, kalt ist der Brand, das walte Gott
Vater usw. (Goldschmidt, Volksmedizin S. 58).
Soll auch gegen Feuersbrunst helfen.
Gegen die Rose: Rote Rose, weiße Rose, Blatterrose!
Du sollst vergehen! Das Evangelium wird dir
gepredigt, der Psalter wird dir gesungen, die
Glocken werden dir geklungen. Im Namen usw.
(Goldschmidt, Volksmedizin S. 57).
Gegen Blutstockung des Viehes: Moses schlug mit
seiner Rute in das rote Meer. So wie sich das
Wasser teilte, teile sich das Blut in diesem Vieh
(Saterld.).
81.
Gegen Verrenkungen: Petrus und Maria ritten zusammen
auf ein Pferd und ritten über eine Brücke, da vertritt
das Pferd den einen Fuß. Petrus sprang herunter
und bat zu Gott den Vater, daß er möchte geben, daß
alle Litt (Glieder) bei Litt, Sehnen bei Sehnen, Aders
bei Aders, Knochen bei Knochen – – – und dasselbige
begehre ich hier auch (Handschriftl. aus dem
Saterld.).
Gegen Leibschmerzen der Tiere:
a.
Liebes Tier, du bist verfangen, Christus hat gehangen.
Dabei legt man die Hände in Kreuzform auf
das Rückgrat des kranken Tieres.
b.
Kreatur du bist verfangen
von Water oder Wind,
dann kommen dir zu Hilfe
die hl. Maria und ihr Gotteskind. Im Namen des
Vaters usw. Ein Vater unser. Drei Kreuze über den
Rücken des Tieres machen.
c.
Beim Verfangen der Schweine sagt man in den
Marschen:
Mein Schweinchen hast du dich verfangen, Jesus
ist ans Kreuz gehangen. (Der Besitzer des Schweines
darf um diesen Segen nicht wissen, darf nachher
auch nicht dafür danken.)
Gegen Schlangenbiß:
a.
Christus und Petrus, die beiden gingen über Land.
Was fanden sie da? Addern und Schlangen und
Ützen. Und was taten sie da? Pußen. Im Namen
des Vaters usw. Drei Vater unser.
b.
Du böse Adder, du liegst dahier im Sand mit deinen
9 Jungen, und ich segne dich, daß du nicht
mehr schwellen und nicht mehr kellen und nicht
mehr stechen kannst (drei Kreuze machen). – Ich
sah einst, wie ein Schäferhund von einer Kreuzotter
gebissen wurde. Die Wunde schwoll faustdick an.
Der Schäfer segnete die Stelle, murmelte dabei
Worte, die ich nicht verstand, und bald ging die
Schwellung zurück und der Hund war gerettet,
nach Meinung des Schäfers infolge des Segnens
(Altenoythe).
Gegen das kalte Fieber ist aus den Marschen folgender
Spruch eingesandt:
»Unsere Alte hat das Kalte, holt der Teufel die
Alte nicht, holt er auch das Kalte nicht,« mit
dem Beifügen, daß der Spruch wirklich in Anwendung
komme.
Gegen Kopfweh: Im Namen Jesu! Moses schlug
mit seiner heiligen Rute in das Meer, das Wasser
zerteilte sich, und so sollen sich diese Schmerzen
im Kopfe zerteilen. Drei Kreuze machen.
Gegen Wunden durch Metalle: Im Namen Jesu! Ich
beschwöre alle Iser und Stahl, Kopper, Messing
und Metaal, daß diese keinen Schaden tun an
deinem Fleisch und Blut. Kreuze um die verletzte
Stelle machen.
Gegen Verstauchungen: Eine Frau heilte den verstauchten
Fuß eines Tieres durch Gebet und
kreuzweises Drücken. Das Gebet lautete: Der
Herr Jesus ritt mit seinem Esel über die Brücke.
Auf der Brücke verstauchte sich der Esel den
Fuß. Der Herr Jesus stieg ab und heilte den Fuß.
Durch jene Kraft wolle der Herr Jesus bewirken,
daß dies Tier nicht mehr lahme und hinke
(Bösel).
Bienensegen:
a.
Ihr Bienen und Mörs, wo kommt ihr her? Kommt
ihr aus einer Hürbe oder aus dem Paradies? Ich
will euch beschwören, ihr sollt euch setzen an Büsche
und Gras, an Tacken und Teuger (Zweige), ihr
sollt tragen Honig und Wachs, das in allen Kirchen
wird gebraucht. Drei Vater unser (Friesoythe).
b.
Imme-Mauer (Mutter) sette di, Gott däi Heer verlette
di, dräg Hönnig und Waß, dat brennt so kloar
vör Gottes Altoar. Dies ist 3 mal zu sprechen.
(Friesoythe) (146).
Im Amte Cloppenburg lebte vor Jahren ein Besprecher,
der zur Zeit des Mondbruches (wenn der Mond
voll war), großen Zulauf hatte. Er schärfte dem Kranken
ein, daß er fest an die Kraft des Besprechens
glauben müsse, segnete ihn dann unter Segensprüchen,
lief fort, sprang durch's Fenster und kam durchs
Fenster wieder herein. So verfuhr er dreimal: beim
Aufgang des Mondes, um Mitternacht und kurz vor
Sonnenaufgang. – Ein Verwandter dieses Heilkünstlers
betete bei Kranken, bediente sich aber dabei zugleich
eines in die Augen fallenden äußeren Mittels,
nämlich Erde aus einem neuen Grabe auf dem Kirchhof.
– Wo Frauen die Kunst ausübten, bestand das
Besprechen oder Beten oder Segnen gewöhnlich
darin, daß die Beterin die rechte Hand auf die kranke
Stelle legte und betete, oder daß sie, nachdem sie die
kranke Stelle berührt hatte, hinausging und draußen
betend auf und ab wandelte.
In Oldenburg erzählt man, es habe jemand einer
alten Frau, die arg am Fieber litt, ein Stückchen Pa-
pier in einem kleinen Beutelchen gegeben, sie solle
dasselbe in dem Beutelchen ein Jahr lang am Halse
tragen und dann wegwerfen, aber niemals nachsehen,
was auf dem Papiere stehe. Die Alte, heißt es, trug
das Beutelchen eine Zeit lang und wurde gesund.
Nach etwa einem halben Jahre glaubte sie sicher zu
sein, legte das Beutelchen ab, öffnete das Papier und
las jenen Spruch. Aber in demselben Augenblicke
wurde sie von einem heftigen Fieberfrost befallen und
soll die Krankheit auch nicht wieder los geworden
sein.
Die Oldenb. luth. Kirchenordnung von 1573 mußte
die Küster mit Absetzung bedrohen, »so sie noch mit
gottlosen Teufelssagen oder Arzney umbgingen und
wie auf etlichen Dörfern geschehe, St. Johannesevangelium
schreiben, den Leuten um die Hälse hingen
gegen allerley Krankheit und Zauberey.« Man ließ
nämlich das Johannesevangelium hübsch sauber auf
Papier schreiben, brachte es heimlich unter die Altardecke
einer katholischen Kirche, wartete, bis der Priester
3 Messen darüber gelesen hatte, steckte es in
einen Federkiel oder in eine ausgehöhlte Haselnuß,
verkittete die Öffnung mit Lack oder Wachs oder ließ
solche in Kapseln oder Silber fassen und hing sie um
den Hals. (Schauenburg a.a.O. IV, 121.)
82.
Wenn man Seitenstechen hat, macht man mit Speichel
ein Kreuz auf den Stiefel, dann hört der Schmerz auf
(Münsterland). – Blutungen werden dadurch gestillt,
daß man das Blut auf kreuzweise gelegte Strohhalme
fallen läßt, während ein Kundiger den rechten Spruch
dazu spricht. – Wenn man Eiter von einem Geschwür
auf einen Kreuzweg legt, so vergeht das Geschwür. –
Glockenschmiere wird äußerlich gegen Hämorrhoiden
gebraucht (Oldenbg.). – Wasser, welches am ersten
Ostermorgen vor Sonnenaufgang unter Stillschweigen
aus einem fließenden Strome geschöpft wird, hilft
gegen Ausschlag und Augenübel; es hält sich jahrelang,
ohne zu verderben (Oldenburg). – Am Charfreitage
in fließendem Wasser gebadet, vertreibt die Krätze.
– Nasenbluten stillt man, indem man 2 Strohhalme
kreuzweise übereinander legt, drei Tropfen Blut
darauf fallen läßt und dabei gewisse Worte spricht
(Bösel). – Warzen an den Händen werden durch Besprechen
und kreuzweises Berühren mit den Händen
entfernt (Lindern). Wird eine Kuh krank, so werden
über den ganzen Rücken Kreuze gemacht, angefangen
beim Nacken; beim letzten Kreuz wird die Kuh wieder
gesund (Dinklage). 1611 wird aus Hude berichtet,
daß »eine Frau 3 Halme aus dem Dache gezogen, ein
Kreuz daraus gemacht und unter die Karne gelegt,
damit sie ihre Butter wieder kriege.« (Schauenburg
a.a.O. IV, 124.) Wenn in den Stall eines gefallenen
Tieres ein neues wieder hinein soll, muß man diesem
ein weißes Kreuz an die Stirn machen, es rückwärts in
den Stall ziehen und sprechen: Glück herein, Unglück
heraus!
B. Sympathie.
83.
Bei der Anwendung der Sympathie zur Heilung von
Krankheiten handelt es sich meist um die doppelte
Tätigkeit, zwischen der Krankheit und einem anderen
Gegenstand die nötige Verbindung herzustellen und
alsdann diesen Gegenstand auf irgend eine Weise auf
die Seite zu schaffen oder völlig zu vernichten. Die
Krankheit erscheint dabei als ein Ding für sich, mitunter
fast wie etwas Körperliches, das man aus den
Kranken heraus- und an eine andere Stelle hineinbringen
kann; in den meisten Fällen aber wird man doch
nur an die sympathetische Verbindung zu denken
haben, welche ja in derselben Weise wirkt, als wenn
die Krankheit selbst fortgebracht oder vernichtet
würde. Die Herstellung der Verbindung geschieht namentlich
dadurch, daß man den Namen der Krankheit
auf ein Papier schreibt, die Krankheit abschreibt (87,
90, 94, 100, 101, 107), das kranke Glied mit einem
Bande umbindet, in einen Faden so viel Knoten
knüpft, als man Warzen hat oder Krankheitsanfälle
erfahren hat, den leidenden Teil mit einer Totenhand
bestreicht usw. Was hernach mit dem Papier, dem
Bande, dem Faden, der Totenhand geschieht, das ge-
schieht auch mit der Krankheit.1
Fußnoten
1 Wenn in der Folge oft vom Fieber die Rede ist, so
hat man meist an das kalte Fieber zu denken, das früher
die Marschbewohner stark heimsuchte, auch auf
der Geest nicht unbekannt war, wohin es durchweg
durch Hollandsgänger verschleppt wurde.
84.
Eine besonders feierliche Art, dem Kranken seine
Krankheit abzunehmen, d.h. die Verbindung der
Krankheit mit einer Schnur oder einem Faden herzustellen,
ist das V e r m e s s e n , das gegen langwierige
Krankheiten vielfach angewendet wird. Das folgende
Verfahren stammt aus Dötlingen. An einem
Dienstag oder Freitag Abend nach Sonnenuntergang
wird der Kranke mit einer Schnur vermessen, zuerst
vom Scheitel bis zur Zehe, dann von Fingerspitzen zu
Fingerspitzen der ausgestreckten Arme. Dies wird so
lange wiederholt, bis sich die Längen ausgeglichen
haben. Kommt es zu einer solchen Ausgleichung
nicht, so ist die Krankheit unheilbar, wird jene aber
erreicht, so steckt nun gewissermaßen die Krankheit
in der Schnur und kann auf verschiedene Weise, z.B.
durch Faulen, mit der Schnur vernichtet werden.
Vgl. 86, 100, 101.
85. Übertragung der Krankheit auf andere
Menschen.
Wenn man Warzen hat, so mache man eine bluten,
lasse das Blut auf einen Lappen tropfen, wickle in den
Lappen ein Geldstück und trage ihn auf einen Kreuzweg.
Wer das Päckchen aufnimmt, bekommt die Warzen
(Großenkn.). – Wenn man Fieber hat und im
Schweiße liegt, nimmt man ein Stück Geld zu sich ins
Bett und wirft es nachher auf die Straße. Wer das
Geld zu sich steckt, bekommt das Fieber (Oldenbg.).
– Warzen zu vertreiben, macht man so viel
Knoten in einen Faden, als Warzen zu vertreiben
sind, und legt den Faden unter einen Stein. Tritt dann
jemand auf den Stein, so bekommt er die Warzen, der
andere wird frei (Oldenbg.). Oder er vergräbt den
Faden in die Erde und spricht den Namen dessen, dem
er die Warzen an seiner Statt wünscht, aus, hält aber
vor- und nachher unverbrüchliches Stillschweigen
über die Sache (Oldenbg.). – Hat jemand ein Geschwür,
so bringe er von dem ersten Eiter, der heraus
kommt, etwas auf ein Stückchen Brot und gebe dies
fremden Hühnern. Alsdann bekommt er selbst kein
Geschwür wieder, dagegen bekommt es der Eigentümer
der Hühner (Damme). – Wenn zwei Reiter auf
einem Pferde sitzen, so rufe man ihnen nach: »Twee
up een Pärd, nehmt mi mine dree (veer, fief usw.)
Waarten mit!« so verschwinden die Warzen (Ovelg.)
86. Übertragung von Krankheiten auf Tiere.
Wenn man das Fieber hat, nimmt man einen Napf mit
süßer Milch, setzt ihn einem Hunde vor und spricht:
Pros't Hund,
du krank und ick gesund!
Wenn der Hund nun von der Milch getrunken hat,
trinkt man selbst, und so muß dreimal gewechselt
werden. Dann hat der Hund das Fieber und der
Mensch ist frei (Butjad.). – Man nimmt ein Butterbrot,
beißt ab, läßt dann einen Hund abbeißen, und so
fort, bis das Butterbrot verzehrt ist (Holle). – Man
nimmt einen Mund voll Butterbrot, zerkaut es fein
und gibt es einem Hunde (Holle). – Eine Bäuerin in
Abbehausen erzählte ihrem Prediger, sie habe ein
ganzes Jahr am Fieber gelitten und keine Befreiung
finden können. Endlich habe man ihr geraten, einem
Hunde und einer Katze von ihrem Essen zu geben.
Das habe sie getan und das Fieber sei auf die Tiere
übergegangen. Aber als sie die kranken Tiere immer
vor sich gesehen, habe sie es ungeschehen gewünscht.
Da sei das Fieber von den Tieren wieder zu ihr gekommen.
– Am einfachsten ist es, einen Hund oder
eine Katze mit ins Bett zu nehmen; das Fieber geht
dann auf sie über.
87.
Schwindsüchtigen hängt man einen Stieglitz oder eine
Lachtaube in das Zimmer, damit der Vogel die
Krankheit auf sich ableite (Oldenbg.). – Wer das
wilde Feuer (den Gürtel-Rotlauf) hat, gehe dreimal
um einen Eichbaum und spreche:
»Eikenbom, ick klage di,
dat wilde Für, dat plaget mi,
ick wull, dat dei erste Vaegel, dei
dar aewer flog, dat mit in dei Lucht (Luft) nöhm'«
(Saterld.).
In Friesoythe heißt der Spruch also:
Aiken Boom, ick klage di,
dat wilde Für dat ploaget mi,
Ick wull, dat use Herrgott göf,
dei erste Voagel, dei daröaver flög,
dat den dat wilde Für bekleef.
Dabei dreimal um einen alten Eichbaum gehen; in
Barßel will man, daß dies vor Sonnenaufgang geschehe.
– Eier, mit denen man Abschnitte von sämtlichen
Nägeln des Kranken gemischt hat, werden Hühnern
oder wilden Vögeln zur Atzung hingesetzt; die
Krankheit geht alsdann auf die Vögel, die davon
essen, über. (Goldschmidt, Volksmedizin S. 63). –
Um das Fieber los zu werden, muß man es dem Aal
verschreiben und das Papier ins Wasser werfen.
Wenn ein Aal nun das Papier verschlingt, ist man geheilt
(Ovelg.). – Einem Fieberkranken wurde eine
Wallnuß, in welche man ohne sein Wissen eine lebende
Spinne eingeschlossen, gegeben, damit er sie auf
der Herzgrube trage (Dedesd.). – In Butjadingen ließ
man Fieberkranke Zucker in Spinngewebe gewickelt
langsam aufsaugen oder man strich zerhackte Spinnen
auf Brot und gab dieses den Kranken zu essen.
88. Übertragung von Krankheiten auf Pflanzen.
Lahme müssen vor Sonnenaufgang schweigend durch
einen gespaltenen Eichbaum kriechen (Ovelg.). – Um
den Bruchschaden eines Kindes zu heilen, spaltet man
den Stamm einer jungen Eiche so weit, daß das Kind
hindurch gesteckt werden kann. Einer hält den Spalt
offen, ein anderer langt das Kind hindurch, ein dritter
nimmt es in Empfang. Alles muß aber stillschweigend
geschehen. Schließlich wird der Baum verbunden,
und wenn er fortwächst, so heilt der Bruch des Kindes.
Der langsameren oder schnelleren Heilung des
Baumes entspricht auch die des Kindes. Nicht immer
werden grade drei mitwirkende Personen verlangt.
Andererseits kommen auch Schärfungen der Vorschrift
vor: der Zauber muß am Johannisabend vollführt
werden, die mitwirkenden Personen müssen alle
Johann heißen (was hier zu Lande keine große
Schwierigkeit hat), das Kind muß dreimal durch den
Spalt gezogen werden. – Auf dem Wall in Wildeshausen
wurde bislang ein gespaltener Eichbaum gezeigt,
durch dessen Spalt ein Kind gezogen war, das einen
schweren Leistenbruch hatte. Das Kind war dennoch
gestorben. – Die englische Krankheit wird in ähnlicher
Weise geheilt, wenn man das Kind durch einen
gespaltenen Weidenbaum steckt, und der Baum wie-
der zusammenwächst.
89.
Um Zahnweh zu vertreiben, geht man morgens vor
Sonne zu einem Baume, löst an der Seite, wo die
Sonne aufgeht, ein Stück Rinde durch einen oberen
Querschnitt von einem halben Zoll und zwei von diesem
nach unten parallel laufende Längsschnitte von
etwa fünf Zoll Länge so weit ab, daß es nach unten
gebogen werden kann. Dann schneidet man von dem
bloßgelegten Holze einen Splitter ab, stochert mit diesem
an dem »Wehzahn«, bis Blut an ihm bemerklich
ist, und fügt ihn dann in seine alte Stelle wieder ein.
Endlich deckt man die Rinde wieder auf die Blöße
und bindet sie mit einem Bindfaden fest, so daß alles
wieder zusammenwachsen kann. Fällt ein Holzsplitterchen
weg oder bricht die Rinde ab, so ist der Versuch
mißlungen. Auch darf bei der ganzen Prozedur
kein Wort gesprochen, noch darf sie von einem fremden
Auge beobachtet werden (Strückhsn.). – Gegen
Warzen: man schneide vor Sonnenaufgang aus einer
Weide ein Stückchen Rinde, bestreiche damit die
Warzen und lege es sofort wieder an seine Stelle
(Jever). – Nimm einen Wollfaden von der Wolle eines
einjährigen Lammes und mache so viel Knoten hinein,
als du Warzen hast. Diesen Faden lege bei abnehmendem
Monde in einen hohlen Baum, gehe dann so
viel Male um den hohlen Baum, als du Warzen hast,
und sie werden bald verschwinden (Friesoythe). –
Gegen Zahnweh: man stochere mit einem Strohhalm
an dem kranken Zahn, bis Blut kommt, fülle den
Halm mit diesem Blute an, bohre ein Loch in einen
Baum, lege den Halm hinein und schlage das Loch
mit einem Pflocke zu (Münsterld.). – »Ein Mann in
der Gemeinde Essen hatte einen Sohn, der Wunden
am Bein hatte, die stets eiterten. Da das Übel nicht
weichen wollte, trotzdem verschiedene Ärzte herangezogen
waren, ging er zu einem Wunderdoktor in der
Gemeinde Löningen. Dieser verordnete: Nimm Eiter
aus der Wunde, streiche denselben auf Leinen und
suche einen Baum, welcher bis zu 20 Fuß astfrei ist.
Unter dem ersten Ast bohre ein Loch, darin stecke das
Leinen und verklebe das Loch. Dies mußt du tun zur
Zeit des Vollmondes; auf dem Hin- und Rückwege
darf dir niemand begegnen, darf kein Hahn krähen,
der Bohrer darf nicht gefunden, nicht geschenkt, nicht
gestohlen, sondern muß vererbt sein. Ich habe den
Knaben gekannt, er war später ein guter Jäger, aber
hinkte.« – Fieberkranke bohren ein Loch in einen
Baum, hauchen dreimal hinein und verschließen dann
das Loch mit einem Pflocke (allgem.). Als jemand,
der sein Fieber mit einem Nagel in einen Baum verschlossen
hatte, darüber von einem Bekannten verspottet
wurde, ging er heimlich zu dem Baume und
zog den Nagel wieder heraus. Es dauerte nur kurze
Zeit, so befiel das Fieber den Spötter (Vechta).
90.
Fieberkranke schreiben auf einen Zettel folgende
Worte:
Bom, ick klag di,
dat Feber plagt mi,
Gott gäw, dat 't von mi geit,
un di besleit!
und kleben diesen Zettel an einen Baum (Oldenbg.)
Oder man geht schlichtweg an einen Erlenbusch und
redet ihn an: »Ellernbusk, ick klage di« usw. (Hasbergen).
– Gegen das Fieber: man geht des Morgens vor
Sonnenaufgang gegen die Sonne, spricht die drei
höchsten Namen und macht in den Zweig eines Weidenbaums
so viel Knoten, als man Fiebertage gehabt
hat, oder (Schönemoor) beim Eintagsfieber macht
man einen, beim Dreitagsfieber drei Knoten. Weder
auf dem Hinnoch auf dem Rückwege darf natürlich
gesprochen werden. – So oft man das kalte Fieber gehabt
hat, so viel Gerstenkörner reiht man auf einen
Faden und vergräbt diesen vor Sonnenaufgang und
ungesehen, fern von den eigenen Gründen auf öffentlichem
Wege. Sowie die Körner aufschwellen, ist das
Fieber weg (Visbek). – Der Fieberkranke schüttelt
eine Hand voll Buchweizen zwischen den Händen
und streut ihn dann aus; kommt der Buchweizen auf,
so verschwindet das Fieber (Ammerld.).
91.
Übertragung von Krankheiten auf den M o n d . »Ich
habe einmal ein Überbein durch Sympathie weggeschafft,
indem ich es bei zunehmendem Monde unter
dem Spruche: ›Im Namen des Vaters, des Sohnes und
des heiligen Geistes‹ dreimal kreuzweise mit der
Hand bestrich und dann eine Geberde machte, als
wenn ich es ergriffe und an den Mond schleuderte.
Dies tat ich drei Abende hinter einander, hernach ist
es verschwunden (Oldenbg.).« (Hier sehen wir ein
förmliches Wegwerfen der Krankheit an den Mond,
der um so besser sie an- und in sich aufnimmt, weil er
der zunehmende Mond ist; für die Sympathie im engeren
Sinne hätte der abnehmende Mond besser gepaßt,
damit die Krankheit abnehme wie der Mond.) – Um
Warzen zu vertreiben, stellt man sich bei zunehmendem
Mond so, daß man seinen eigenen Schatten nicht
sieht, hält die warzige Hand gegen den Mond und
streicht mit der anderen Hand darüber hin nach dem
Mond zu. Einige sprechen dazu auch: »Mond, befreie
mich von diesem Ungeziefer,« andere:
Wat ick ankiek, dat winnt,
war ick oewerstriek, dat verswinnt.
In letzterem Falle wirkt die Sympathie zum Gegenteil.
Aus Kneheim bei Cloppenburg wird berichtet: Man
bestreicht bei Neumond die Warzen mit Erde und
spricht dabei: Glück und Segen, neuer Mond. Alsdann
wirst man die Erde, die man noch in der Hand
hat, nach dem Mond hin.
92.
Man schafft die Krankheit in die E r d e , damit sie
dort eingeschlossen und gefangen sei. Geschwüre
heilt man, wenn man von dem Eiter in die Erde vergräbt.
– Gegen Fieber: geh nach Sonnenuntergang
oder vor Sonnenaufgang zu einem Maulwurfshaufen,
zieh' ein Kreuz davor, mach' mit der Hand ein kleines
Loch in den Haufen, puste dreimal in das Loch und
mach' es dann wieder zu, so bist du das Fieber los
(Schönemoor). – Fieberkranke stechen einen Soden
aus dem Rasen, heben ihn heraus und lassen ihr Wasser
in die Lücke, dann legen sie den Soden wieder an
seine Stelle (Wiefelst.). – Warzen reibt man mit
Speck und vergräbt diesen bei abnehmendem Monde
auf einem Kreuzweg. – Man schneidet so viel Knoten
aus Strohhalmen, als Warzen vorhanden und vergräbt
die Knoten. – »Als ich als kleiner Knabe einstmals an
der Gelbsucht litt, mußte ich eines Abends einen Dukaten
(also ein gelbes Geldstück) in eine Schale mit
Wasser legen, welche vor dem Fenster gleich an meiner
Schlafstelle stand. Morgens vor Sonnenaufgang
wurde ich geweckt und angekleidet, nahm den Dukaten
aus der Schale und ging mit meiner Mutter in den
Garten der Sonne entgegen. Im Garten mußte ich den
Dukaten verscharren. Am folgenden Morgen wieder
vor Sonnenaufgang gingen wir abermals in den Garten
und ich holte den Dukaten wieder heraus. Bei
allen diesen Handlungen durfte nichts gesprochen
werden, und meine Mutter hatte mich im voraus von
allem unterrichtet« (Oldenbg.). – Ein Mädchen von
12-13 Jahren hatte den Veitstanz. Da nahm die Mutter
eine ganz weiße Erde und vergrub diese in der
Erde zwischen Kirche und Kirchturm. Das Kind war
nun vollständig geheilt. Die Erde hatte die Krankheit
mit in den Kirchhof genommen und würde dies für
immer getan haben, wenn sie nicht »gestört« wäre.
Aber als der Prediger starb, wurde an dieser Stelle
sein Grab gemacht, und so war der Zauber gebrochen.
Das Mädchen wurde wieder krank und starb auch an
der Krankheit. (Stedingen; in welcher Weise die
weiße Erde die Krankheit in sich aufgenommen, erhellt
nicht.)
93.
Man übergibt die Krankheit f l i e ß e n d e m W a s -
s e r , das sie hinwegführt. Bruchschaden der Kinder
heilt man, wenn man sie bei Vollmond mit fließendem
Wasser wäscht. – Der Fieberkranke geht stillschweigend
an ein fließendes Wasser (wo Ebbe und
Flut sind, zur Ebbezeit), macht eine Bewegung mit
den Händen stromabwärts, als ob er dem Strome
etwas mitgäbe, und spricht: »Im Namen Gottes« usw.
(Brake). – Der Fieberkranke geht nach Sonnenuntergang
stillschweigend zu einem fließenden Wasser,
schöpft dreimal mit der hohlen Hand gegen den Strom
und trinkt, was er gefaßt hat. Dabei muß man sprechen:
Grund, ick belaw di,
dat Feber dat plagt mi,
Gott gäw, dat mi't vergeit
un di besleit;
oder: »Prost Grund! Gott gäw, dat du dat Feber
kriggst un ick wär gesund.« Beide Male folgt das »Im
Namen Gottes des Vaters« usw. (Brake). – Man
schlage soviel Knoten in einen Faden, als man Warzen
hat und werfe den Faden in fließendes Wasser,
und die Warzen vergehen.
94.
Der Fieberkranke nimmt ein Stück Brot, ißt es zur
Hälfte auf und wirft den Rest in fließendes Wasser
(Brake). – So oft jemand das Fieber gehabt hat, so
viel Knoten macht er in einen Faden, trägt diesen
stillschweigend an ein fließendes Wasser und wirft
ihn hinein (Dedesd.). – Wer seine Warzen vertreiben
will, schneidet in einen Hollunderstock so viel Kerben,
als er Warzen hat, trägt ihn morgens, nüchtern
und ohne gesprochen zu haben, an ein fließendes
Wasser und wirft ihn hinein (Rast.). – Der Fieberkranke
läßt sich von einem Kundigen das Fieber auf
ein Stückchen Papier abschreiben und trägt dies Papier
an einer Schnur während des nächsten Anfalls
und drei Tage nachher auf der Herzgrube (sieben
Tage um den Hals). Dann wirft er es, ohne es vorher
geöffnet zu haben und ohne umzusehen, rücklings in
ein fließendes Wasser. Ein Mann, der einmal den Rat
gab und das Fieber abschrieb, behauptete ausnahmsweise,
es komme gar nicht darauf an, ob der Kranke
an das Mittel glaube oder nicht, »und in der Tat«,
sagte der Patient, »half das Mittel, obschon ich nicht
daran glaubte.« (Oldenbg.).
95.
Flechten treibt man in die L u f t . Man streut
Flockasche, leichte flockige Asche von weißem oder
grauem Torf, auf das leidende Glied, bläst sie fort und
spricht:
De Flockasch un de Flechten,
de flogen woll aewer dat wille Meer,
de Flockasch de keem wedder,
de Flechten nimmermehr.
(Schönemoor). – »Als ich ein etwa zehnjähriger
Knabe war, litt meine Schwester an Flechten. Um sie
zu heilen, gab mir meine Tante folgende Weisung: Du
sammelst vom Feuerherde neun Kügelchen
Flockasche, nimmst davon drei, gibst deiner Schwester
am nächsten Morgen einen Wink, dir zu folgen,
und gehst mit ihr gegen Sonnenaufgang etwa 10 Minuten
Weges fort, bis euch kein Mensch mehr beobachten
kann. Dann lässest du deine Schwester so niederknieen,
daß sie dahin sieht, wo die Sonne aufgeht,
nimmst eins der Aschkügelchen, legst es auf die
Flechten und bläsest es weg gegen Aufgang der
Sonne. Dann sprichst du dreimal: ›Im Namen Gottes
des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes.‹
Ebenso machst du es mit dem zweiten und dritten Kügelchen.
Am folgenden Tage verfährst du in gleicher
Weise mit den zweiten drei Kügelchen und am dritten
mit den letzten. Du darfst aber weder vornoch nachher
mit irgend jemanden über diese Sache sprechen, auch
mit deiner Schwester nicht, und dieser darfst du nur
sagen, daß sie genau tun müsse, was du ihr durch Zeichen
andeuten würdest, und ja zu niemanden sprechen
dürfe. Und an allen drei Morgen dürft ihr nichts vorher
genießen und kein Wörtchen sprechen, nicht eher
als bis ihr wieder zu Hause seid. Verseht ihr etwas, so
wird die Krankheit nicht vertrieben oder kommt doch
wieder, und vielleicht schlimmer, als sie gewesen ist«
(Jade).
96.
Handelte es sich bisher um die bloße Fortschaffung
der Krankheit, so folgt nunmehr eine nicht minder
große Anzahl von Mitteln, die Krankheit in einem andern
Gegenstande zu vernichten. Zunächst geschieht
dies dadurch, daß man den Gegenstand in der Erde
verfaulen läßt.
Um Warzen zu vertreiben, reibt man sie vor Sonnenaufgang
mit einem Stück Speck oder Kalbfleisch
und vergräbt den Speck unter dem Schweineblock,
das Fleisch schlichtweg in die Erde; sobald Speck
oder Fleisch verfault ist, sind auch die Warzen fort.
Statt des Fleisches nimmt man auch Hülsen (Innenseite)
von großen Bohnen (Oldenbg). – In einen wollenen
(rohen flächsenen) Faden macht man so viel Knoten,
als man Warzen hat und vergräbt den Faden bei
abnehmendem Mond (Ovelg.) unter einem Tropfenfall,
einem Schweinetrog, einer Mauer, an der Ostseite
eines Baumes (Jeverld.); verfault der Faden, so vergehen
auch die Warzen. Übersieht man Warzen und
macht zu wenig Knoten, so bleiben so viel Warzen
als Knoten zu wenig sind. – Die Schnur, mit welcher
ein Kranker vermessen ist (84), wird mit etwas Salz
unter einen Stein gelegt (Dötlgn.). Die Mitteilung fügt
freilich nicht hinzu, daß sie dort verfaulen solle; es ist
daher auch möglich, daß die Krankheit auf denjenigen
übergehen soll, der auf den Stein tritt (85).
97.
Nichts kann gewisser zum Untergang, zur Verwesung
bestimmt sein als ein menschlicher Leichnam, daher
ist auch kaum ein Mittel, Feindliches zu zerstören,
wirksamer, als wenn man dies Feindliche mit einem
Leichnam in Verbindung setzt. Geschwüre, Ausschlag,
Auswüchse, Warzen, Gicht u. dergl. werden
vertrieben, wenn man den kranken Teil mit der Hand
(mit der linken Hand) einer Leiche bestreicht. Einige
wollen, das Bestreichen müsse kreuzweise geschehen.
Strenges Schweigen auf dem Wege zur Leiche, bei
der Leiche und auf dem Rückwege wird von anderen
zur Bedingung gemacht. – Während der Tote in seinen
Sarg gelegt wird, streicht man mit der Leichenhand
über die Warzen und spricht:
Waarte ful aff
as de Dode in sin Graff.
(Damme). – Ein noch lebender Herr erzählte, er habe
als Junge viele Warzen gehabt, da sei seine Großmutter
mit ihm zum Nachbarhause gegangen, worin eine
Leiche gestanden, er habe die Leiche berühren müssen
und von da an wären nach und nach die Warzen
verschwunden. – Man bestreiche das Gesicht einer
Leiche (der Leiche eines unschuldigen Kindes) mit
der Hand und dann mit derselben Hand ein krankes
Glied, so geht der Schaden fort (Lastrup). – Muttermale
verschwinden, wenn eine Leichenhand darüber
gezogen wird. Dies hat in der Dunkelheit zu geschehen
(Zetel).
98.
Wenn man irgend einen Teil eines schadhaften Gliedes,
etwa den Schorf von einer Wunde, eiter- oder
blutgetränkte Lappen, schweißbenetzte Kleider, ein
Stückchen Holz, das mit dem leidenden Teile in Berührung
gewesen ist, in einen Sarg legt, so vergeht die
Krankheit. (Großenkneten). – Bettnässer können sich
von ihrer Schwäche heilen, wenn sie den Urin in ein
frisch gegrabenes Grab lassen oder ein Glas mit Urin
in ein Grab oder einen Sarg legen (Oldenb., Friesische
Wede.) – So oft ein Kranker das Fieber gehabt,
so viel Warzen jemand hat, so viel Knoten werden in
einen Faden gemacht, der Faden wird alsdann um die
Hand einer Leiche gebunden oder in einen Sarg gelegt
(Marsch). – Wanzen oder »Kläwlüs« wird man los,
wenn man eine in einen Sarg legt (Brake). – Wenn jemand
Erbläuse hat, d.h. Läuse, die ihm von einer anderen
nachher verstorbenen Person zugekommen sind,
so kann er sich ihrer nicht anders entledigen, als wenn
er einige davon einer Leiche mit in's Grab gibt. Daß
man sie in den Sarg lege, pflegen aber die Angehörigen
des Toten nicht zu leiden, daher muß man sie bei
der Beerdigung heimlich in die Gruft zu bringen suchen.
– Mit den Kerzen, die vor der Beerdigung auf
einem Sarge gestanden haben, heilt man Geschwüre
(Oldenbg.) – Vielleicht gehört hierher auch, daß
Ringe von Sargschrauben oder von eisernen Rosetten,
die auf dem Kirchhofe ausgeworfen sind, gut zu tragen
sind gegen Gicht und Rheumatismus. – Hat man
ein offenes Bein oder sonst eine Wunde, so muß man
einen Sargnagel auf dem Kirchhof suchen, damit die
wunde Stelle bestreichen und bei nächster Gelegenheit
den Nagel zu einer Leiche in den Sarg werfen,
dann verschwindet das Übel von da an (Großenkneten).
– Knochen aus dem Beinhaus oder vom Kirchhof
müssen verbrannt und die Rückstände unter die
Speisen gemischt solchen gereicht werden, welche an
Ausschlag oder Geschwüren leiden. Der Kranke darf
aber nicht darum wissen (Molbergen). – Auch genügt
es, das Leiden auf einen Zettel zu schreiben und dieses
in einen Sarg zu legen, wenn er hinausgetragen
wird.
99.
Gern bringt man die zersetzende Kraft der Leiche mit
der reinigenden des Wassers in Verbindung. Warzen,
Ausschlag, Geschwüre, kranke Augen bestreicht man
mit dem Morgentau von Leichensteinen. – Warzen
wäscht man auf einem Leichensteine und spricht:
Doden, Doden in dat Graff,
nimm mi mine Waarten aff. –
Wenn es regnet, gehe man drei Abende hinter einander
auf den Kirchhof und benetze die Warzen mit dem
Wasser, das sich auf einem Leichensteine gesammelt
hat. Auf dem Wege hin und zurück muß man schweigen.
Nach drei Wochen sind die Warzen verschwunden
(Delmenh.). – Man wäscht die Warzen mit fließendem
Wasser in demselben Augenblicke, in welchem
eine Leiche über dasselbe gefahren wird (Lastrup).
– Während zur Beerdigung geläutet wird, oder
während der Zug um die Kirche geht – beides pflegt
zusammen zu treffen – wäscht man die Warzen mit
»striekend (fließendem) Wasser« und spricht dazu
einen der folgenden Sprüche:
»Sett man de Liken in dat Graff,
wask ick mi mine Waarten aff.«
»Se leggt den Doden in dat Graff,
ick wask mi all de Waarten aff.«
»Se bringt de Liken woll in dat Graff,
nu wask ick mi de Waarten aff.«
»Se lüdet den Doden int Graff,
ick wask mine Waarten aff. (Rastede).«
In Butjadingen heißt es: Wenn zur Beerdigung die
Glocken anfangen zu läuten, soll man sich an ein Grabenufer
setzen, dreimal die mit Warzen bedeckten
Hände mit Wasser begießen und dabei sagen: Es
walte Gott der Vater, Sohn und h. Geist. Nach einiger
Zeit verschwinden die Warzen. Anderswo sagt man
wieder:
Se lüdt den Doden in dat Graf,
Ik waske mine Hand in striekend Water af.
(Schweiburg).
100.
Ferner bedient man sich der verzehrenden und dörrenden
Hitze, um die Krankheit zu zerstören. Ein Faden
mit so viel Knoten, als man Warzen hat, wird ins
Feuer geworfen. – Wer die Gelbsucht hat, läßt sich
messen (84), faßt den gebrauchten Faden zu einem
Kranze, spuckt dreimal hindurch und wirft den Faden
ins Feuer (Schönemoor). – Der Fieberkranke schreibt
auf einen Zettel:
Fieber, bleib aus,
N.N. ist nicht zu Haus,
steckt diesen in einen Torfsoden und läßt das Ganze
verbrennen. (Butjadgn.) Vgl. 90. – Um den Kopfausschlag
der Kinder zu heilen, knüpft man unter gewissen
Förmlichkeiten ein rotseidenes Band um den Hals
des Kindes, spricht einen Segen, nimmt dann das
Band wieder ab und hängt es an den Kesselhaken
(Lutten). – Einem kranken Pferde schneidet man mit
einem Messer unter dem einen Hufe ein Stück Nasen
ab, holt es heraus, und legt es auf den Rahmen des
Herdmantels. Sobald der Rasen zerbröckelt, ist die
Krankheit verschwunden (Abbehsn).
101.
Andere Mittel, die Krankheit in dem Gegenstande,
welcher ihre Stelle vertritt, zu vernichten. Ein Fieberkranker
in Oldenburg mußte einen beschriebenen Zettel
aufessen. – Die Schnur, mit welcher ein Kranker
gemessen ist, wird in einen Hollunderstrauch gehängt,
wo sie verfaulen muß (Dötlg.) – Warzen reibt man
mit einer schwarzen Erdschnecke und spießt diese auf
einen Stock, den Stock steckt man in die Erde. Ist die
Schnecke verfault, so sind die Warzen vergangen (Oldenbg.)
– Man teilt einen Apfel in drei Teile, reibt mit
dem einen die Warzen und wirft ihn dann fort; sobald
das Stückchen verfault ist, sind die Warzen verschwunden.
– Wer an Zahnweh leidet, bringe mit
einem Nagel das Zahnfleisch an der schmerzenden
Stelle zum Bluten, berühre den Zahn dreimal mit dem
Nagel und schlage diesen in einen Baum. Sobald der
Nagel verrostet ist, hat sich auch das Übel verloren.
Damit es rasch verschwinde, nimmt man einen bereits
stark angerosteten Nagel (Münsterld). – Der Fieberkranke
legt den Zettel, auf welchem das Fieber abgeschrieben
ist, ohne ihn zu öffnen, in seinen Schuh, wo
derselbe solange bleibt, bis er ganz und gar zerfetzt
ist (Jever).
102.
Andere sympathetische Kuren. Der bekannte Wunderdoktor
St. im Ksp. Dötlingen gab dem Hilfe suchenden
Kranken ein Stückchen Holz, mit welchem der
kranke Teil berührt oder geprickelt werden mußte, bis
Blut an dem Hölzchen war. Dann steckte der Doktor
das Holz zu sich, die Krankheit verschwand, und
blieb solange weg, als der Doktor das Hölzchen bei
sich trug. Die im Hölzchen steckende Krankheit
wurde anscheinend durch die im Doktor steckende
Heilkraft bezwungen, so lange die Berührung dauerte.
Ein Arbeiter, der den Wunderdoktor gebraucht hatte,
erzählte etwas anders: »Beim Holzfällen im Stühe erhielt
ich einen starken Axthieb ins Bein, und das Blut
wollte sich garnicht stillen lassen. Wider meinen Willen
brachte man mich zu St. Dieser schnitt ein Zweigendchen
von einer Haselstaude ab, fuhr damit über
die Wunde und ging damit in die Stube. Dann kam er
wieder und steckte mir das Stückchen Holz eingewikkelt
in die Tasche: ich solle es nicht eher wieder von
mir lassen, als bis die Wunde geheilt sei. Das Bluten
hörte sogleich auf. Nach einigen Tagen aber bekam
ich fürchterliche Schmerzen, und als ich nun nach
dem Stückchen Holz sah, war es verschwunden Ich
konnte die Schmerzen zuletzt nicht mehr aushalten
und ließ mich zu St. fahren. Erst schalt St. tüchtig und
wollte nichts wieder mit mir zu tun haben. Endlich
aber nach langen Bitten wiederholte er die Kur, blieb
diesmal aber länger allein. Nun hörten die Schmerzen
auf, und die Wunde heilte bald.«
103.
Wenn ein Kind wegen englischer Krankheit nicht
gehen (»laufen«) kann, muß man es Johannimorgen
ganz nackt in den Garten legen und Leinsaat über
dasselbe wegsäen. Wenn die Leinsaat zu »laufen« anfängt,
fängt auch das Kind an (Oldenbg.). – Wenn ein
Gichtbrüchiger im Bette liegt, setzt man von seinem
Urin auf das Feuer. Sobald der Urin kocht, fängt der
Kranke an zu schwitzen, und die Gicht verliert verliert
sich (Oldenbg.). – Wenn die Kühe nicht rindern
wollen, gebe man ihnen gepulverte Schalen von
Eiern, aus welchen Küken gekommen sind (Rast.), ein
Stück von dem schmutzigen Hemde einer Frau, einen
Bovist, genannt Hirschbrunst oder Bullenkraut. –
Eine Abkochung von Hollunderrinde wirkt als Laxanz,
wenn die Rinde von oben nach unten geschabt
ist, wenn aber von unten nach oben, als Brechmittel.
– Schweißige Hände werden durch das Tragen
eines Frosches geheilt (Schönemoor). – Gelbsucht
wird geheilt, wenn der Kranke in einen Topf mit Teer
sieht.
104.
Wunden von Hundebissen heilt man durch Auflegen
von Hundehaaren. – Wenn man von einem tollen
Hunde gebissen ist, nehme man die Leber des Hundes,
lasse sie verkohlen, pulverisiere sie und nehme
das Pulver auf Butterbrod ein (Hoya). – Eine Kohle
von einem abgebrannten Hause, äußerlich gerieben
oder als Pulver aufgestreut oder innerlich eingenommen,
ist gut gegen Brandwunden und gegen das wilde
Feuer. – Auch soll eine solche Kohle gut einzunehmen
sein gegen Fieber (Jever). – Sieht man im Frühjahr
die erste Schwalbe, so muß man stillstehen und
die Erde unter dem rechten Fuße durchsuchen, alsdann
findet man eine Kohle; wer sie nicht gleich findet,
muß nur tiefer suchen, sie liegt dann eben tiefer.
Wenn man von dieser Kohle im Fieberfrost ein wenig
einnimmt, geht das Fieber weg (Wiefelst). – Gegen
Seitenstechen hilft Stäkkoorn, semina cardui Mariae;
so viel Jahre der Patient hat, so viel Körner muß er
nehmen (Goldtschmidt, a.a.O., S. 111). – Wenn jemanden
der Zapfen in der Kehle entzündet ist, so sagt
man: »De Huk is em dalschaten.« Man kann den
»Huk« wieder emporbringen, wenn man ein Haar aus
dem Kopfe zieht und das richtige trifft, denn nur eins
entspricht dem Huk. Andere sprechen von drei Haa-
ren.
105.
Mit abnehmendem Monde ist die Heilung mancher
Krankheiten leichter. So muß man gegen Würmer den
Kindern zu dieser Zeit eingeben. Gegen Fieber hilft
es, wenn man sich bei abnehmendem Monde an ein
fließendes Wasser setzt, mit einem Löffel aus letzterem
schöpft und trinkt, so viel man kann. – Vielleicht
ist dies Mittel eins mit dem folgenden, in welchem die
Sympathie nicht mehr erkennbar ist. Dasselbe hilft
nicht bei allen Leuten, bei solchen aber, für die es
paßt, hilft es auch ganz und sicher. Der Fieberkranke
trinkt, wenn der Frost sich einstellt, einen Löffel voll
fließenden Wassers, kommt es wieder, drei, kommt es
nochmals, fünf, dann abwärts fünf, drei, einen. Soweit
kommt der Kranke aber selten mit dem Einnehmen,
das Fieber bleibt meist früher weg (Holle).
C. Verschiedenes.
106.
Abergläubisches. Eine Frau, die Zwillinge geboren
hat, besitzt die Fähigkeit ein Sehnen- oder Segensband
zu binden; das Umbinden des kranken Gliedes
mit diesem Bande und ein Segensspruch üben vereint
die heilende Kraft. Meist ist übrigens das Sehnenband
kein Band, sondern ein Faden, bald von Wolle, bald
von Flachs und dann roh. Verrenkte und geschwollene
Glieder werden so sicher geheilt. »Ich hatte mir den
Fuß verstaucht, und da dies im Dorfe bekannt geworden
war, kam eine Nachbarin schweigend in mein
Zimmer, zog mir schweigend den Strumpf aus und
band unter Murmeln einen Faden unter dem Knie
kreuzweise um das Bein. Dann erst sagte sie guten
Tag und fing mit den Anwesenden ein Gespräch an.
Die Verrenkung sollte nun in so viel Zeit, als sie bereits
gedauert hatte, wieder verschwinden«
(Abbehs.). – Nasenbluten hört auf, wenn man einen
wollenen Faden um den linken kleinen Finger bindet.
– Gegen Veitstanz hilft das Trinken einer Abkochung
eines blaugefärbten und dann gekochten Stükkes
Garn (Zetel). – Wer das kalte Fieber hat, muß
eine Kanne Milch trinken, in welcher 3 große Spinnen
gekocht sind (Friesische Wede). – Freitags soll man
die Nägel beschneiden, dann bekommt man kein
Zahnweh. – Gegen Heiserkeit bindet man einen linken
getragenen Strumpf um den Hals und trägt ihn die
Nacht durch (Oldenbg).
107.
Warzen vergehen, wenn sie mit gestohlenem Speck
gerieben werden (Holle, Rast.). Der Speck muß
abends gestohlen werden, und man nimmt ihn – wohl
um keiner Anzeige ausgesetzt zu sein – am liebsten in
einem befreundeten Hause (Holle). – Auch gegen Fieber
hilft gestohlener Speck (Wiefelst.) – Ein Sackband,
in der Mühle gestohlen, hilft gegen Halsweh. –
Gegen den »Tramin« (Krämpfe) der Kinder gibt man
diesen Abschabsel von einem Donnerkeil und von
Erbsilber (Schönemoor). Oder man nimmt das naßgeschwitzte
Hemd des Kindes, verbrennt es und gibt die
Asche demselben zu trinken (Lutten). – In Jeverland
gehen manche Fieberkranke nach Sengwarden zu
einem bestimmten Grabe, pflücken früh morgens vor
Sonne ein bischen Gras von demselben und verzehren
es. – Wenn der Fieberkranke an dem Tage, an welchem
das Fieber kommen soll, von unbekannter Hand
an die Tür oder den Alkoven geschrieben findet:
Fieber bleib aus,
N.N. ist nicht zu Haus,
so bleibt das Fieber weg (Zetel).
Vgl. 100.
108.
Warzen zu vertreiben, bestreicht man sie mit Blut von
Warzen eines andern; Blut von eigenen erzeugt mehr
Warzen (Oldenbg). – Eine Stige, d.h. ein Gerstenkorn
am Auge, bestreicht man mit einem Trauringe (Oldenb).
– Eine junge Frau litt am Stige. Eine alte Bettlerin,
welche in das Haus kam, sah das Übel, spuckte
rasch auf das kranke Augenlid und ermahnte dann die
junge Frau, ja den Speichel an seiner Stelle trocknen
zu lassen, so werde die Stige verschwinden, sonst
aber kämen ihrer zwanzig (Oldenbg. – Sommersprossen
vertreibt man, wenn man Johannimorgen vor Sonnenaufgang
das Gesicht mit Froschlaich wäscht (Ganderk.).
– Ein Pferd befreit man von Bauchgrimmen,
wenn man auf eine in der Johanninacht geschnittene
Weide den Hut hängt, welchen man bei der letzten
Kommunion getragen hat, ihn so dreimal um das
Pferd herum trägt, segnet und spricht: »Lief, Lief,
stüre di« (Lastrup). – Wenn ein Schwein sich verfangen
hat, muß man dreimal um dasselbe herumgehen,
es in den Schwanz kneifen und einen Segen sprechen
(Brake). – »Ein Schaf litt an der sogenannten Drehkrankheit.
Der Besitzer holte aus einem Birkenbaum
ein Hexennest (nestartig verschlungene oder verwachsene
Zweige der Birke), legte es auf den Boden und
zog das Schaf darüber hin und her. Ich stand dabei,
kann aber nicht sagen, ob das Tier wieder gesund geworden,
weil ich gleich darauf den Ort verließ.« (Großenkneten.)
109.
Abergläubisches oder falsche Wissenschaft. Blut von
einem Hingerichteten getrunken hilft gegen Epilepsie
und (Ovelg.) gegen Fieber. Man muß es womöglich
frisch trinken und dann so lange laufen, als man kann
(Wildeshsn.). – Im Jahre 1497 ist in Oldenburg eine
Frau festgesetzt, weil sie einem Knecht zur Beseitigung
des kalten Fiebers einen Zaubertrank: Krug Bier
mit 3 des Nachts vom Galgen geschnittenen Spänen,
gegeben hatte. (Jahrbuch f. die Geschichte Oldenburgs,
1906, 15. Band S. 59.) – Ein anderes Mittel
gegen Epilepsie ist das Blut einer schwangeren Eselin;
man versendet es in Leinewand eingetrocknet und
zieht es nachher mit etwas Wein oder dgl. wieder heraus
(Oldenbg.). – Oder man schießt eine trächtige
Häsin, nimmt die ungeborenen Jungen heraus, verbrennt
sie zu Pulver und gibt dies den Kranken ein
(Stedgn.) – Oder man setzt einen lebendigen Igel oder
Maulwurf in einem sonst leeren Topfe auf's Feuer, bis
er verkohlt ist, und gibt dem Kranken die pulverisierte
Kohle ein. – Fast scheint es, als ob man in diesen
Mitteln das animalische Leben gesammelt einfangen
und in den kranken Körper überleiten wollte.
110.
Wenn Vieh an inneren Entzündungen leidet und alle
anderen Mittel versagen, werden mit Wasser verdünnte
menschliche Exkremente eingegeben (Rast.). – Äußerliche
Entzündungen von Menschen und Tieren, namentlich
wenn das Hinzutreten des kalten Brandes
befürchtet wird, heilt man durch Auflegen menschlicher
Exkremente. Dies Medikament heißt: Vergolden
Pflaster. – Gegen Verstopfung hilft Kot von einem
Wallach oder einem ganz jungen Hengste. Der ausgepreßte
Saft von Schafkot (Schapslorbeeren) oder Hundekot
(witten Enzian) wird mit heißem Bier oder mit
Branntwein als schweißtreibendes Mittel angewandt.
(Goldschmidt, a.a.O. S. 67.) – Gegen Krämpfe wird
Kindern das Weiße vom Hühnerkot, mit ein wenig
Wasser durch Leinewand geseiht, eingegeben, und
zwar zuerst ein Portion, dann jedesmal eine Portion
mehr bis zu neun, und so wieder abwärts (Holle). –
Märzenschnee, in einem Becken aufgelöst und aufbewahrt,
ist ein gutes Mittel für kranke Augen.
111.
Krankem Vieh gibt man drei Menschenhaare in Mehlballen
ein (Rast.). – Beim Wurmschlag oder Verfangen
der Kühe erhalten dieselben Warmbier, in welchem
der Kadaver oder das Gerippe eines Iltis abgekocht
ist (Brake). – Wenn eine Kuh blaue oder dünne
Milch gibt, soll man sie in einen Sack pissen lassen
und dann den Sack so lange peitschen, bis nichts
mehr darin ist (Langförden). – Wenn eine Kuh im
Vormagen verstopft ist, werden derselben zwei oder
drei Frösche durch den Hals in den Vormagen geschoben;
sie sollen mit ihrem zähen Leben die Verstopfung
aufwühlen (Rast.). – Oder man gibt ihnen
mit derselben Absicht einige lebendige Käfer ein
(Rast.). – Oder man gibt ihnen einen Hering mit Teer
ein (Holle). – Ist eine Kuh krank, so muß man die
Fäsken des Stalles mit Flachsgarn umwinden in Form
eines Kranzes. Darauf kettet man die Kuh los und
treibt sie mit dem Stock an, durch die umwundenen
Fäsken zu gehen. Tut sie das bereitwillig, so ist sie
bald geheilt (Löningen). – Ist ein Stuck Vieh an einer
Wundkrankheit erkrankt (z.B. Maul- und Klauenseuche),
so nimmt man etwas von der Wunde und vergräbt
es an einem Freitagmorgen vor Sonnenaufgang
auf einem Kreuzwege. – Herrscht in einem Hause eine
Seuche unter dem Vieh, so nimmt man etwas von
einem krepierten Tier, wickelt es in ein Totenlaken
(Laken, worauf oder worunter ein toter Mensch gelegen)
und legt dies draußen hin. Nimmt jemand das
Totenlaken mit, so ist man die Krankheit los und der
Besitzer des Totenlakens hat sie in seinem Hause.
Vgl. 85. (Amt Wildeshausen). (Es geht aus dieser
Mitteilung hervor, daß, wie man eine Krankheit wegbringen,
man sie auch auf demselben Wege erhalten
kann, möglicherweise durch schlechte Menschen. Es
wird behauptet, daß Menschen, die anderen feindlich
gesinnt sind, auf deren Gehöft gehen und dort vor der
Stalltür oder im Stalle selbst ein Stück von einem krepierten
Vieh vergraben.) (Wildeshausen.) – Gegen
Rheumatismus und Gicht gibt man dreizehn Regenwürmer
in Branntwein und schluckt das ganze hinunter
(Edewecht). – Gegen Harnbeschwerden nimmt
man sieben Holzwürmer in Milch gekocht (Oldenbg.).
– Bei Frostschäden muß man zerquetschte
Regenwürmer auf die wundigen Stellen legen. –
Zahnschmerzen kann der beseitigen, der einen Maulwurf
in der Hand sterben ließ. Eine solche Hand behält
2 Jahre lang die Heilkraft. (Stammt aus der Gegend
von Ankum.) – Gegen Blasenleiden nimmt man
Urin von einem verschnittenen Schwein (Borgswien)
oder eigenen Urin. Letzterer hilft auch gegen das Bettnässen.
(Goldschmidt, a.a.O.) – Eine Pracherlus –
eine Laus von einem Bettler – in einen hohlen Zahn
gesteckt hilft gegen Zahnweh (Goldschmidt, S.
124). – Warzen vergehen, wenn man das Wasser,
welches dem Vieh beim Saufen wieder aus dem
Maule läuft, über die Hand rinnen laßt (Holle). –
Gegen Gelbsucht dienen 7 lebendige Läuse auf Butterbrot
gegessen (Zetel). – Eine getrocknete Fuchszunge
auf dem Herzen getragen, schützt gegen Gesichtsrose
(Butjadgn.).
112.
Das Bestreichen mit Eschenholz soll Blutungen stillen
(Saterld.). – Zur Heilung von Schlangenbissen genießt
man Bier, in welchem Eschenlaub gekocht ist
(Rast.). Überhaupt ist die Esche den Schlangen zuwider,
daher umpflanzt man die in der Nähe von Holzungen
und Mooren stehenden Häuser mit Eschen,
denn der Bereich dieser Bäume und ihres Laubfalles
wird von den Schlangen gemieden (Rast.). – Kastanien
in der Tasche sind gut gegen Rückenschmerzen
(Jever). – Um Geschwüre zu vertreiben, muß man sogenanntes
»Endholz«, die knollenartigen Auswüchse
an Obst- und anderen Bäumen, in der Tasche tragen
(Cloppenburg). – Wenn die Hühner (infolge Kalkmangels)
Windeier legen (Eier ohne Schale), muß
man eines derselben in ein Tobbenloch stecken und
der Übelstand hört auf (Lastrup). – Osternmorgen
nüchtern von den Äpfeln essen, die Palmsonntag auf
Palmstöcken in der Kirche gewesen sind, hilft gegen
Krankheiten (Münsterland). – Muskatnüsse in der Tasche
sind gut gegen Geschwüre (Ovelg.). – Ein Besen
von Birkenreis mit ins Bett genommen ist gut gegen
Wadenkrämpfe (Oldenbg.). – Gegen Rheumatismus
bindet man eine Schnur, auf welche Flaschenkörke
gereiht sind, um das Bein (Oldenbg.). – Einem von
der Epilepsie Befallenen legt man ein schwarzseidenes
Tuch auf den Mund (Hooksiel). – Ein kluger
Mann wurde zu einer Kuh gerufen, welche krank am
Boden lag, keine Milch gab und schon seit mehreren
Tagen nicht gefressen hatte. Der Mann besah die Kuh
und sagte, er wisse nicht, was ihr fehle, ihr seien jawohl
die Hungerzähne zu lang gewachsen, ob nicht
eine Zange da sei. Die Zange wurde gebracht, der
Mann stieß damit der Kuh ins Maul an die Zähne, bis
ein wenig Blut daran kam; so, nun werde die Kuh
wohl wieder gesund werden. Und so geschah es in
kürzester Frist (Ganderkesee).
»Uns gingen früher oft die Kälber ein. Als wir einst
wieder ein Loch gruben, um ein verendetes Kalb zu
verscharren, kam ein Taler zum Vorschein mit der
Jahreszahl 1597 und der lateinischen Umschrift: Tue
recht und scheue niemand. Diesen Taler habe ich
sorgfältig aufbewahrt, und ist uns seitdem nie wieder
ein Kalb gestorben (Lutten).«
IV. Erforschung des Verborgenen.
113.
Die Fähigkeit, verborgene Dinge an das Licht zu ziehen,
ist teils eine Kunst, welche nur von besonders
Eingeweihten gekannt und geübt wird, teils beruht sie
auf der Anwendung allgemein verbreiteter oder doch
eine besondere Kunst nicht bedingender Mittel. Die
kunstmäßige Erforschung des Verborgenen befaßt
hauptsächlich das Vorhersagen der Zukunft und die
Nachweisung gestohlener Gegenstände. Jenes heißt
w i c k e n und wird meist von Frauen, W i c k e r -
s c h e n , betrieben, die zum Teil weither und von
Leuten aufgesucht werden, denen man dergleichen
nicht zutrauen sollte. Ihre Mittel sind hauptsächlich
das Kartenschlagen und das Deuten des Kaffeesatzes.
Die Regeln, wie Karten und Kaffeesatz auszulegen
sind, werden vermutlich wechseln und großenteils
willkürlich sein, da die Wickersche selbst an ihre
Kunst wohl nur in den seltensten Fällen glaubt.
Neben diesen Wickerschen schreibt man namentlich
den Zigeunern, welche die Zukunft in den Sternen und
in der Hand lesen, die Kunst des Wahrsagens zu,
doch ist dies gegenwärtig mehr ein theoretischer Satz,
da die Zigeuner selten geworden sind und kaum noch
in ihrer früheren Eigentümlichkeit auftreten. Die
Wahrsagungen der Wickerschen und Zigeuner sind in
den Augen der Gläubigen untrüglich, und keine irdische
Macht ist im Stande, dem wirklichen Gange der
Dinge eine andere Richtung zu geben.
Fast überall gilt der Satz: Wahrsagen sollen nur
»ungeborene« Mädchen können, d.h. Mädchen, die
durch Operation vorzeitig auf die Welt gekommen
sind.