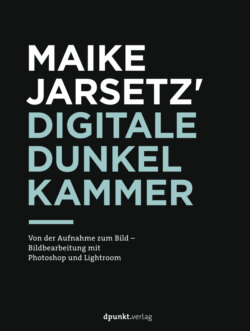Читать книгу Maike Jarsetz' digitale Dunkelkammer - Maike Jarsetz - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3Ein bisschen Technik
ОглавлениеWenn man sich mit den Raffinessen der Bildentwicklung auseinandersetzen möchte, darf ein profundes Wissen um Bildformate, Farbräume und Farbtiefe nicht fehlen.
Am Anfang steht die Auswahl der Bildqualität in der Kamera. Jeder ambitionierte Fotograf bevorzugt hier das Raw-Format gegenüber dem Standard-JPEG.
Mit dem Raw-Format nutzen Sie die Daten, die unmittelbar auf den Kamerachip belichtet worden sind. Diese werden in einem Format gespeichert, das jeder Kamerahersteller anders angelegt hat. Das fotografierte Bild liegt also nicht in einem austauschbaren Standardformat vor – deshalb sprechen wir von den rohen (»raw«) Kameradaten. Diese Rohdaten in ein Standardformat umzuwandeln war früher ausschließlich Aufgabe der Kamerasoftware. Dabei ging es in erster Linie darum, aus reinen Lichtinformationen Farben zu entwickeln: Der Kamerachip an sich ist nicht farbempfindlich. Um Farbinformationen einzufangen, wird mit kleinen Farbfiltern vor dem Sensor gearbeitet, die nur jeweils die roten, grünen und blauen Farbanteile durchlassen und speichern. Die jeweiligen Helligkeitsinformationen für Rot, Grün und Blau werden dann in der resultierenden JPEG-Datei in separate Farbkanäle gespeichert, die sich zum Farbbild kombinieren. Da der Chip sein Speichervolumen quasi drittelt – in vielen Chips werden die Farbfilter über ein sogenanntes Mosaikraster angeordnet –, wird nicht das gesamte Speicherpotenzial der Kamera genutzt. Bei der Umwandlung in Farbinformationen werden die fehlenden Informationen für die einzelnen Farben aus den anderen Kanälen und den nebenliegenden Pixeln errechnet (interpoliert). Bei diesem Rechenprozess wurden – und werden immer noch im Falle von JPEG-Fotografie – die Einstellungen der Kamera, wie Weißabgleich und Schärfe, aber auch individuelle Kontrast- und Farbeinstellungen, mit einberechnet.
Auch das JPEG-Format resultiert also aus der Raw-Datei. Wenn wir direkt die Raw-Daten der Kamera nutzen, übernehmen wir die Aufgaben der Kamerasoftware und müssen ebenfalls über einen Konvertierungsprozess das Farbbild entwickeln. (Trotzdem haben Sie es optisch auch bei Raw-Daten immer mit einem Farbbild zu tun, da zu einem Raw-Bild auch immer ein farbiges Vorschaubild mitgespeichert wird.)
Genau darin liegt unsere Chance und der überragende Vorteil der Raw-Daten: Bei der Entwicklung der Farbkanäle in der vollen Auflösung haben wir Zugriff auf unzählige Belichtungs-, Farb- und Kontrasteinstellungen, die das Bild in dem Moment beeinflussen, in dem seine Farben gerade erst entstehen. Anders als bei einem bereits in der Kamera gespeicherten Bild korrigieren wir bei dieser Art der Bildbearbeitung keine Farbinformationen, sondern lassen sie erst entstehen. Darin besteht ein entscheidendes Qualitätsmerkmal, denn eine Korrektur von JPEG-Daten bringt immer auch einen Qualitätsverlust mit sich, die Entwicklung von Raw-Daten nicht. Und das liegt nicht nur an dem eben erläuterten Entwicklungspotenzial der Raw-Daten, sondern auch an ihrer zusätzlich deutlich höheren Farbtiefe von 12–16 Bit gegenüber einer 8-Bit-Farbtiefe der JPEG-Datei.
Abb. 1.15: Mit der Entwicklung von Raw-Daten übernehmen wir Aufgaben, die sonst der Kamerasoftware bei der Speicherung von JPEGs zufallen.
Farbtiefe Um sich die Wichtigkeit der Farbtiefe vor Augen zu führen, reicht ein einfaches Rechenbeispiel: Bei 8 Bit Farbtiefe kann jedes Bildpixel pro Farbkanal 256 (28) unterschiedliche Werte darstellen. Multipliziert man die drei Farbkanäle miteinander, erhält man zwar das recht stattliche Tonwertpotenzial von 16,7 Millionen darstellbarer Farben, aber das ist nichts gegen die in der Natur vorkommende deutlich größere Bandbreite oder die kaum vorstellbare Größenordnung, wenn stattdessen die 3 Kanäle eines 16-Bit-Bildes mit jeweils rund 65.000 (216) möglichen Tonwertabstufungen miteinander multipliziert werden.
Nun sind die meisten Medien, auf denen wir Bilder ausgeben und betrachten – ob digital oder gedruckt –, größtenteils noch auf 8 Bit beschränkt und man könnte sich fragen, welchen Vorteil die höhere Farbtiefe bietet, wenn man sie nicht sehen kann.
Nun, der wahre Vorteil zeigt sich in der noch ausstehenden Bildentwicklung: Feine Tonwertabstufungen in Hauttönen, hellen Lichtern oder tiefen Schatten neigen bei einer 8-Bit-Bearbeitung zu sichtbaren Tonwertabrissen. Bei 16-Bit-Bildern besteht diese Gefahr nicht annähernd so stark, da auch größere Eingriffe in Farbe, Belichtung oder Kontrast beim Interpolationsprozess aus den 16-Bit-Informationen errechnet werden können. So haben wir bei der Entwicklung von über- oder unterbelichteten Bereichen durchaus noch einen Spielraum von drei und mehr Blenden, um noch Details daraus zu rekonstruieren. Um sich den Vorteil der höheren Farbtiefe vor Augen zu führen, können Sie ein kleines Experiment durchführen. Öffnen Sie ein 16-Bit-Bild, speichern Sie eine Kopie, und wandeln Sie diese in ein 8-Bit-Bild um. Beide Bilder bearbeiten Sie danach mit der gleichen Korrektur, zum Beispiel einer starken Kontrastkorrektur mit der Gradationskurve. Auf dem Histogramm erkennen Sie, wie die Tonwerte auseinandergezogen werden. Klicken Sie auf jeden Fall auf das kleine Warndreieck im Histogramm, um die Histogrammdaten aus dem aktuellen Bild zu laden.
Abb. 1.16: Die Unterschiede im Bearbeitungspotenzial eines 8-Bit-Bildes gegenüber einem 16-Bit-Bild sind schnell im Histogramm sichtbar: Das Histogramm eines 8-Bit-Bildes zeigt nach starken Korrekturen deutliche Tonwertabrisse, bei 16-Bit-Bildern dagegen kann man die Zwischentöne aufgrund der höheren Farbtiefe komplett rekonstruieren.
Im Histogramm des 8-Bit-Bildes sind deutliche Tonwertabrisse zu erkennen; das 16-Bit-Bild hingegen kann die Zwischentöne aufgrund seiner höheren Farbtiefe komplett rekonstruieren.
Abb. 1.17: Feine Nuancen drohen in 8-Bit-Bildern bei zu starken Korrekturen auszubrechen. Deshalb ist das Raw-Format für alle wesentlichen Korrekturen vorzuziehen.
Farbräume Nach der Raw-Entwicklung müssen wir eine weitere Aufgabe der Kamerasoftware übernehmen, nämlich die Entscheidung über den Farbraum. In der Kamera stellen Sie vor der Aufnahme einen Farbraum ein – Sie können wählen zwischen sRGB und Adobe RGB. Diese Einstellung hat aber nur Auswirkungen auf die JPEG-Aufnahmen, nicht auf die Raw-Daten.
Abb. 1.18: Die zwei Standardfarbräume sRGB und Adobe RGB, schematisch dargestellt im ColorSync-Dienstprogramm. Adobe RGB hat einen sichtbar größeren Farbumfang. Trotzdem gilt sRGB als der Standardfarbraum für die Bildschirmbetrachtung und Online-Produktion.
Wie ich schon beschrieben habe, entstehen die Bildfarben während der Raw-Entwicklung erst. Sie werden aus Anteilen der Primärfarben Rot, Grün und Blau zusammengesetzt und in den entsprechenden drei Farbkanälen gespeichert. Eine Bildfarbe wird also in drei Farbwerten festgelegt; welche Aufgabe hat dabei die Angabe des Farbraumes? Ich möchte mich am Anfang dieses Buches auf eine ganz einfache Erklärung beschränken – dieses komplexe Thema greifen wir zu einem späteren Zeitpunkt noch mal auf. Erinnern Sie sich an den Tuschkasten aus Ihrer Schulzeit: Auch dieser bestand aus 8, 12 oder 24 Grundfarben, aus denen alle anderen Farbtöne zusammengemischt wurden. Wenn Sie und Ihr Banknachbar nun versucht haben, exakt die gleiche Mischfarbe zu erzeugen, ist das mit Sicherheit nicht gelungen. Und das lag nicht nur an der ungenauen Mischung der Farbanteile, am schwankenden Wasseranteil oder am eventuell nicht ganz sauberen Pinsel – schon die Grundfarben unterschieden sich von Hersteller zu Hersteller, auch wenn die Farben die gleiche Bezeichnung hatten. Übertragen auf die Farbräume bedeutet das: Auch gleiche Farbwerte können in unterschiedlichen Farbräumen in anderen Mischfarben resultieren.
Ein technischer Farbraum beschreibt den Umfang der Farben, die ein Gerät wiedergeben kann. Dabei sind die Kamerafarbräume wie sRGB oder Adobe RGB festgelegte Standards, die es ermöglichen, Bilder zwischen Geräten auszutauschen und die Farben dabei konsistent darzustellen. Adobe RGB ist dabei der Farbraum mit dem größeren Farbumfang. Er kann von den meisten Kameras, vielen professionellen Druckern und mittlerweile auch von einigen wenigen hochwertigeren Monitoren dargestellt werden. sRGB ist dagegen ein deutlich kleinerer Farbraum, der für die Darstellung im Internet entwickelt wurde. Er stellt eine Art kleinsten gemeinsamen Nenner dar, der gewährleisten soll, dass die im Internet gezeigten Farben auf den unterschiedlichen Endgeräten der Nutzer oder Kunden einigermaßen konsistent angezeigt werden.
Daraus hat sich sRGB auch als Standardfarbraum für alle Online-Dienstleistungen etabliert. Wenn Sie Ihre Bilder nach der Raw-Entwicklung also für ein Online-Fotolabor oder die Webpräsentation speichern wollen, ist sRGB der richtige Farbraum. Wenn Sie wissen, dass Ihr Bild auf professionellem Wege weiterbearbeitet wird, können Sie den größeren Farbraum Adobe RGB wählen.
Bildformate Neben den Speicherformaten der Kamera stehen nach der Entwicklung und dem Bearbeitungsprozess in Photoshop noch unterschiedlichste Speicherformate zur Verfügung. Aber nur wenige davon sind für die Speicherung von Bilddaten geeignet. Die wesentlichen Speicherformate stehen nach dem Raw-Entwicklungsprozess in Lightroom oder Camera Raw zur Verfügung.
JPEG Das JPEG ist das Standardformat für eine komprimierte Bilddatei. Die Komprimierung dient dabei zur Reduzierung der Dateigröße. Damit ist das JPEG das ideale Format für Bilder, die wenig Speicherbedarf haben sollen, weil sie zum Beispiel per E-Mail verschickt oder online hochgeladen werden sollen. Die Komprimierung führt allerdings auch zu Qualitätsverlusten, die auf den ersten Blick vielleicht nicht zu erkennen sind, sich aber addieren, wenn man ein JPEG erneut speichert und damit komprimiert. Deshalb gilt: »Never jpeg a JPEG« – ein JPEG ist damit nicht das richtige Speicherformat für Bilder, die noch weiterbearbeitet werden sollen.
Abb. 1.19: Das höhere Entwicklungspotenzial einer Raw-Datei ermöglicht es, auch scheinbar verloren gegangene Details einer überbelichteten Datei noch zu rekonstruieren.
TIFF Das TIFF-Format ist ein weiteres Standardformat, das von vielen Programmen geöffnet werden kann. Ein TIFF ist standardmäßig nicht komprimiert, hat aber durchaus verschiedenste Komprimierungsoptionen, von denen die sogenannte LZW-Komprimierung quasi verlustfrei ist. Anders als ein JPEG kann ein TIFF nicht nur mit 8 Bit, sondern auch mit 16 Bit Farbtiefe gespeichert werden. Damit ist ein TIFF das ideale Archivierungsformat. Es kann aber auch gut als Bearbeitungsformat genutzt werden, da es beim Speichern keine Komprimierungsverluste hat und zusätzlich die Ebenentechnik von Photoshop unterstützt, mit der Korrekturen gespeichert werden, ohne dass das Original verloren geht. Ein TIFF ist das klassische Autauschformat für Layout und Design sowie in der professionellen Druckproduktion.
PSD Das PSD ist das Photoshop-eigene Speicherformat und unterstützt alle in Photoshop vorhandenen Bearbeitungsmöglichkeiten, die über die reinen Bildpixel hinausgehen, wie Transparenzen, Smart-Objekte, 3D-Elemente, Pfade, Vektorinformationen, Text etc. Das Photoshop-Format ist auch das ideale Austauschformat für das Layoutprogramm InDesign. Für Fotografen eignet es sich für Bilder, die in jedem Fall noch in Photoshop bearbeitet und dann in einem anderen Format weitergegeben werden sollen.
DNG Mit DNG speichern Sie Ihre Bilder weiterhin im Raw-Format, aber mit zwei Vorteilen gegenüber der originalen Raw-Datei: Die Entwicklungseinstellungen werden in der DNG-Datei gespeichert (diese können damit jederzeit bearbeitet oder wieder zurückgesetzt werden) und zusätzlich ist DNG ein gutes Austauschformat zwischen Lightroom und Photoshop, aber auch anderen Raw-Konvertern. DNG ist damit das ideale Speicherformat für entwickelte Raw-Daten.
Abb. 1.20: Nach der Raw-Konvertierung in Lightroom oder Camera Raw wird das Bild in einem Standardformat gespeichert bzw. exportiert. Hierbei werden auch die technischen Parameter festgelegt, wie Größe, Farbraum oder Farbtiefe.