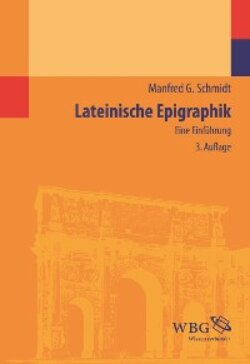Читать книгу Lateinische Epigraphik - Manfred G. Schmidt - Страница 10
|5| II. Zur Geschichte der lateinischen Epigraphik
ОглавлениеAntike und Mittelalter
Das Interesse an lateinischen Inschriften als philologischer oder historischer Quelle ist bereits in der antiken Literatur zu greifen – Beispiele finden wir etwa bei Livius mit den dort zitierten, gesetzlichen Bestimmungen des Jahres 186 v. Chr. (39, 18), die eine Teilnahme am Bacchanalien-Kult restriktiv reglementierten. Im Vergleich zu diesem noch heute auf einer Bronzetafel erhaltenen Senatsbeschluß (CIL I2 581 cf. Index ad n.; s. unten S. 32) zeigen die wörtlichen Übereinstimmungen im Livianischen Werk, daß der Historiker aus dokumentarischem, wohl inschriftlichem Material geschöpft hat: Und wie sollte es auch anders sein, wo doch die Inschrift in der Antike neben der Schriftrolle (und dem Papyrus in Ägypten) die gängigste Form schriftlicher Aufzeichnung war. Systematische Sammlungen inschriftlicher Zeugnisse in der Form von beschriebenen Holz- und Wachstäfelchen (tabulae ceratae) gab es insofern, als vor allem juristisch oder wirtschaftlich relevante Dokumente (Rechnungen, Pacht- und Kaufverträge und dergleichen) private wie öffentliche Archive füllten. Für politischadministrative Entscheidungen konnten die Magistrate der Stadt Rom auf die Beschlüsse und Gesetze im Senatsarchiv zurückgreifen (R. J. A. Talbert, The Senate of Imperial Rome, Princeton 1984, 303ff.). Auch führt z.B. der regelmäßige Hinweis der Militärdiplome auf ihre öffentlich ausgehängte Urschrift in Rom zu einer inschriftlichen Sammelpublikation: Die Abschrift der einzelnen, den Soldaten nach ihrer ehrenhaften Entlassung ausgehändigten Diplome folgt dem Wortlaut jener großen Bronzetafeln, die in Rom an genau bezeichneter Stelle veröffentlicht waren. Meist verweisen die Militärdiplome auf den Aushang einer Bronze, “die in Rom an der Mauer hinter dem Tempel des vergöttlichten Augustus bei der (Statue der) Minerva angebracht” war (zu den Militärdiplomen vgl. unten, S. 38f.). Inschriften wurden im alten Rom freilich nicht um ihrer selbst Willen gesammelt. So hatte der epigraphische Charakter für diese Sammlungen keinerlei Signifikanz.
Erst mit dem erwachenden Interesse des Abendlands an seiner antiken Tradition wird das epigraphische Zeugnis auch selbst Gegenstand wissenschaftlicher Erforschung. Man entdeckt neben den literarischen Texten, die ja durch Spätantike und Mittelalter handschriflich weiter tradiert wurden, die Inschrift als Teil eines Puzzles antiker Geschichte und Lebenswelt, das, bewahrt in den Ruinen antiker Stätten oder als Spolie an mittelalterlichen und neuzeitlichen Gebäuden verbaut, bei der Suche nach seinem ursprünglichen Kontext wissenschaftliche Aufmerksamkeit erregt. Gerade in Zeiten bewußter Rezeption der Antike wurde daher nicht nur der literarischen Tradition antiker Autoren nachgespürt, sondern es wurden auch Inschriften gesammelt und ediert:
|6|Aus karolingischer Zeit ist eine Abschrift der ersten uns bekannten Kompilation lateinischer und griechischer Inschriften im Codex Einsidlensis (9. Jh.) erhalten, jedoch noch nicht in systematischer Ordnung, sondern an den Ortsbeschreibungen orientiert, wie sie die im Codex vereinigten, verschiedenen Berichte aus Rom, Pavia und ein sog. ‘Regionator’, ein Itinerar zur Stadt Rom, boten (so L. Sensi). Das Interesse an den Inschriften des paganen Altertums bleibt zunächst aber gering; selbst Ausnahmen wie jene um 1140 verfaßte Schrift über die ‘Mirabilia urbis Romae’ zeigen fast ausschließliches Interesse an den Monumenten und kaum an deren Inschriften. Nur die christlichen Inschriften erfreuen sich auch im frühen Mittelalter eigener Tradition – in berühmten Handschriften des 9. und 10. Jh. wie der Sylloge Centulensis oder dem Corpus Laureshamense veterum syllogarum. In der Zeit des Humanismus und der Renaissance bemühte sich die gelehrte Welt dann um ein neues Verständnis der inschriftlichen Tradition: Antike Inschriften wurden abgeschrieben und in handschriftlichen Corpora zusammengefaßt.
Das 15. und 16. Jahrhundert
Erste epigraphische Sammlungen verdanken wir berühmten Männern wie Poggio Bracciolini (1380–1459), dem Sekretär der päpstlichen Kurie, der im Jahre 1429 eine systematisch geordnete Syllogē (Sammlung) von antiken Inschriften vorlegt; er hatte sich eine Kopie des Einsidlensis angefertigt und die dort verzeichneten Inschriften mit der Sammlung von Inschriften, die er selbst gesehen und abgeschrieben hatte, verbunden. Allerdings blieb das epigraphische Interesse Poggios hinter seinem philologischen Engagement für die literarische Tradition der Antike weit zurück.
Sammlertätigkeit in einem weiteren geographischen Raum und rechtschaffenes, ja penibles Bemühen um die epigraphische Hinterlassenschaft der Antike verbinden sich in dieser Zeit mit dem Namen Ciriaco d’ Ancona (um 1391–1455). Einer Kaufmannsfamilie entstammend, nahm dieser auf ausgedehnten Reisen in Italien, Griechenland und der Levante in großem Umfang griechische und lateinische Inschriften auf. Die von ihm geübte Praxis, eine genaue Beschreibung des Monuments zu geben, den Text der Inschriften sorgfältig zu kopieren und den jeweiligen Fundort gewissenhaft zu verzeichnen, nimmt bereits wesentliche Elemente der erst in der Folgezeit entwickelten epigraphischen Methode vorweg und trug ihm den Titel eines ‘Begründers der Inschriftenforschung’ ein.
Giovanni Giocondo oder Ioannes Iucundus (um 1434–1515) war einer der typischen Universalgelehrten der Renaissance, Philologe und Theologe zugleich, Antiquar, Architekt und Ingenieur, der eine für seine Zeit mustergültige Sylloge vor allem stadtrömischer Inschriften vorlegte; aber auch Zeugnisse aus Dalmatien, Hispanien, Gallien und Griechenland finden sich bei ihm, so daß seine Sammlung nicht zuletzt wegen ihrer Reichhaltigkeit und ihres Umfangs von Späteren gern benutzt wurde.
Pirro Ligorio (1513–1583), jenem neapolitanischen Architekt, der als Nachfolger Michelangelos mit der Bauaufsicht der Basilica von St. Peter beauftragt worden war, blieb es schließlich vorbehalten, Monumente, Münzen und Inschriften der Antike erstmals in einer umfassenden, allerdings noch handschriftlichen Enzyklopädie zu beschreiben. In mehr als 40 Bänden, die sich größtenteils in den Archiven von Turin und Neapel befinden, suchte Ligorio die römische Welt zu erfassen – “a labour of love”, wie |7|man sein Schaffen charakterisiert hat (H. Burns). Ligorios heftige Leidenschaft blieb nicht ohne Folgen: Komplette Neuerfindungen und Interpolationen antiker Inschriften stehen in seinem Werk neben Echtem und haben damit auch den Wert der späteren, auf Ligorio aufbauenden Sammlungen gemindert. So ist sein Name in der Epigraphik zum Synonym für den Fälscher schlechthin geworden. In der Kunstgeschichte bemüht man sich heute, seine unbestrittenen antiquarischen Verdienste wieder stärker zu betonen, und auch einzelne, von ihm überlieferte, epigraphische Zeugnisse, die vorher in Verdacht gekommen waren, Fälschungen zu sein, ließen sich als echt erweisen.
Die vielfachen Bemühungen der gelehrten Welt des 15. und 16. Jahrhunderts fördern die Kenntnis der antiken Inschriften erheblich. Auf der reichen Ernte dieser Zeit basieren jedenfalls die jetzt entstehenden Druckwerke wie die eines Martinus Smetius (gest. 1578), dessen umfassende Sammlung erst nach seinem Tode von Justus Lipsius im Jahre 1588 herausgegeben wurde. Seine allgemein hoch eingeschätzte Zuverlässigkeit, sein Bemühen um Autopsie der Inschriften, schließlich die erstmals von ihm nicht nach geographischen, sondern nach inhaltlichen Kriterien vorgenommene Ordnung und der Schlüssel zum Ganzen, die Indizes, sichern ihm einen Ehrenplatz in der Geschichte der Epigraphik.
Gruter und die gedruckten Corpora
Wenig später findet die epigraphische Forschung zu Beginn des 17. Jahrhunderts mit der Heidelberger Sammlung von Jan Gruter (1560–1627) einen Höhepunkt: Kein geringerer als der berühmte Philologe Joseph J. Scaliger hatte dieses erstmals im Jahre 1602/03 erschienene ‘Corpus absolutissimum’ angeregt und mitgestaltet, das eine Sylloge aller damals bekannten Inschriften des Imperium Romanum bieten wollte; Scaliger selbst hat sich dann der Mühe unterzogen, die von Gruter gesammelten 12.000 Inschriften nach dem Vorbild von Martin Smetius durch ausführliche Indizes zu erschließen (vgl. A. Grafton, Lias 2, 1975, 109ff.). So wurde der ‘Gruter’ zum Wegbereiter des modernen Inschriftencorpus und blieb bis zum Erscheinen des CIL zitierwürdiges Standardwerk.
Das folgende Jahrhundert war einer Vertiefung dieser altertumswissenschaftlichen Disziplin günstig: Die Skepsis des 18. Jahrhunderts gegenüber der literarischen Tradition, der ihren Ausdruck im sog. Pyrrhonismus fand, förderte maßgeblich die antiquarische Forschung und damit auch die Epigraphik; denn die Betonung des Quellenwerts unmittelbarer Zeugnisse wie der Münzen und Inschriften brachte eine rechte Belebung der epigraphischen Forschung – allerdings nicht immer zum Guten: In einer Vielzahl von Editionen wurde manche unzulänglich abgeschriebene Inschrift immer wieder aufs neue kopiert, bisweilen aufs Geratewohl korrigiert, und mancher modernen Fälschung ein fester Platz in den Corpora zugewiesen. So standen in den beiden Jahrhunderten nach Gruter Gutes neben Schlechtem oder Zweifelhaftem, vieles verborgen in handschriftlichen Lokalgeschichten, anderes publiziert in wenig verbreiteten Drucken oder versteckt in halbwissenschaftlichen Sammelpublikationen, in denen so gern ein bunter Strauß aus numismatischen, epigraphischen und archäologischen Zeugnissen zu ‘Antiquitates’ gebunden wurde.
Ein Versuch, diese ‘Gemengelage’ in einen ‘Novus thesaurus veterum inscriptionum’ überführen zu wollen, mußte nachgerade scheitern, wenn |8|nicht jeder einzelne Gewährsmann erst auf seine Zuverlässigkeit überprüft wurde, die verschiedenen Abschriften bis auf ihre Quelle – im Idealfalle bis auf die antike Inschrift selbst – zurückverfolgt wurden. Diese Arbeit zu leisten, war Lodovico Antonio Muratori (1672–1750), der berühmte Bibliothekar aus Modena, freilich nicht im Stande: Sein ‘Novus thesaurus’ (4 vol., 1739–42), war nur ein Teil seines immensen antiquarischen ‘Gesamtkunstwerks’, das im wesentlichen unkritisches Sammeln zum Inhalt hatte. Das Verdikt über Muratoris Inschriftencorpus ist wohl am schärfsten von Wilhelm Henzen formuliert worden, einem der drei Begründer des CIL und Weggenosse Mommsens, der in einer Besprechung von Mommsens ‘Inscriptiones regni Neapolitani Latinae’ schreibt, “… so glaube ich fast behaupten zu können, dass vollkommen genau keine einzige Inschrift wiedergegeben ist. Mit demselben Leichtsinn endlich, mit dem Muratori falsche Steine aufnimmt, verwirft er anderer Seits echte” (s. unten S. 13f.).
Mit Gaetano Marini (1742–1815), dem ersten Kustos der Vatikanischen Bibliothek, tritt aber auch ein methodischer Wegbereiter der Epigraphik auf den Plan, der mit seinem historisch-kritischen Werk über die Akten der Arvalbrüder die Grundlagen für ein neues Verständnis der Disziplin legt, die, von seinem Schüler Bartolomeo Borghesi (1781–1860) weiterentwickelt, eine neue Ära der Epigraphik einläuten.
Das Corpus Inscriptionum Latinarum
Allerdings waren von Marini und Borghesi keine umfassenden Corpora vorgelegt worden; und Gruters Sammlung genügte nicht mehr den strengen Kriterien einer modernen textkritischen Ausgabe, wie sie Theodor Mommsen (1817–1903) forderte, der spätere Herausgeber des ‘Corpus Inscriptionum Latinarum’ (CIL): “ Gruteri et Scaligeri leges etsi multis nominibus laudandae tamen hodie non amplius sufficiunt” (Inscriptiones regni Neapolitani Latinae, Leipzig 1852, p. XVI). Zudem waren die Corpora des 18. Jahrhunderts, nicht nur wegen ihrer methodischen Mängel, sondern auch angesichts der stetig wachsenden Fülle des epigraphischen Materials, weitgehend überholt, so daß die ‘Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften’ schon 1815 den Plan faßte, erst die griechischen (CIG), dann auch die lateinischen Inschriften (CIL) in umfassenden Sammlungen zu veröffentlichen.
Das Projekt eines französischen ‘Recueil général des inscriptions latines’ war zu Anfang des Jahrhunderts gescheitert, und auch Mommsens Plan eines ‘Corpus’ hatte zunächst allerhand Widerstände zu gewärtigen. Er gedenkt dieser schweren Zeit in der Praefatio des neunten (und zehnten) Bandes des CIL, bedrückt und triumphierend zugleich: “Nam ex tenebris lux facta est et desperationem successus excepit.” Im Jahre 1853 wurde das ‘Corpus Inscriptionum Latinarum’ schließlich aus der Taufe gehoben – ein Jahr nach dem Erscheinen der ‘Inscriptiones regni Neapolitani’ Mommsens, die gewissermaßen als Pilotprojekt für ein künftiges, übergreifendes Corpus gedacht waren. Mommsen hat die Arbeiten am Inschriftenwerk bis zu seinem Tode (1903) nie aus den Augen verloren und war so über fünfzig Jahre der Garant für den Fortschritt an diesem monumentalen Vorhaben der Berliner Akademie, das von vielen Kollegen mitgetragen wurde: Eugen Bormann, Hermann Dessau und Wilhelm Henzen als Vertreter des römischen ‘Istituto di corrispondenza archeologica’ (unter preußischer Leitung), |9|Otto Hirschfeld, Emil Hübner und Christian Hülsen, – um nur die Namen derjenigen zu nennen, die als Autoren an mehreren Bänden mitgearbeitet hatten. Schon damals konnte die Redaktion des ‘Corpus’ auf die Zusammenarbeit mit Epigraphikern aus Italien, Frankreich, Spanien, Großbritannien und vielen anderen Ländern nicht verzichten. Von Anfang an stand Gian Battista de Rossi mit Mommsen und Henzen in engem Schulterschluß; aber auch René Cagnat, der Begründer der bis heute fortgeführten Jahresberichte zur Epigraphik, der ‘Année épigraphique’, Alfred Merlin u. v.a. hatten ihren nicht gering zu schätzenden Anteil an der Vollendung des Werkes – soweit freilich “… ein solches Werk, welches fortgesetzt Nachträge erheischt, vollendet sein kann” (Adolf von Harnack). Bis zum Ersten Weltkrieg war der größte Teil der damals bekannten Inschriften publiziert; auch heute noch, 150 Jahre nach seiner Gründung, wird das Projekt in ungebrochener Vitalität fortgeführt (vgl. unten S. 133ff.).
Bibl. Hinweise
Literarisch überlieferte Inschriften: A. Stein, Römische Inschriften, hier 14f. zur Auseinandersetzung um den Bacchanalienkult; vgl. auch Calabi Limentani, Epigrafia Latina 34f. – Archive: La mémoire perdue. À la recherche des archives oubliées, publiques et privées, de la Roma antique, Paris 1994. La mémoire perdue. Recherches sur l’administration romaine, ebda. 1998. – Zur literarischen Tradition vgl. nur H. Hunger al. (ed.), Die Textüberlieferung der antiken Literatur und der Bibel, München 19882; M. Steinmann, in: F. Graf (ed.), Einleitung in die lateinische Philologie, Stuttgart – Leipzig 1997, 74ff. – Zum Codex Einsidlensis vgl. G. Walser, Die Einsiedler Inschriftensammlung und der Pilgerführer durch Rom (Codex Einsidlensis 326), Stuttgart 1987. Die verschiedenen Enstehungsstufen des Codex untersucht L. Sensi, in: Epigrafia romana in area adriatica. Actes de la IXe rencontre franco-italienne sur l’épigraphie du monde romain, Macerata 1998, 453–469. – Die ‘Mirabilia’ bei H. Jordan, Topographie der Stadt Rom im Alterthum 2, Berlin 1871, 605–613 (Ausgabe); zum Autor H. Bloch, in: Deutsches Archiv f. Erforsch. d. Mittelalters 40, 1984, 55ff. Die Geschichte der Ausgrabungen in Rom bei R. Lanciani, Storia degli scavi di Roma e notizie intorno le collezioni romane di Antichità I–VI (1000–1878), Rom 1989–2000 (Nachdruck). Christliche Inschriften: Zur frühen Tradition christlicher Itinerare, die Inschriften aus Basiliken und Martyrergrüften zitieren, vgl. I. B. de Rossi – A. Silvagni, Inscriptiones Christianae Urbis Romae, Rom 1915, II 1, LXIV-LXVI; die ältesten Inschriftensammlungen: A. Silvagni, in: Diss. Pont. Acc. Arch. 15, 1921, 181–239 und zusammenfassend ders., ICVR n. s. I, Rom 1922, p. XVII–XXVIII; zur Tradition der Damasus-Epigramme A. Ferrua (ed.), Epigrammata Damasiana, Città del Vaticano 1942, 14ff. Zum ‘Corpus Laureshamense’ (9. Jh.) siehe C.V. Franklin, in: J. Hamese (ed.), Roma magistra mundi … Mélanges L.E. Boyle, Louvain-La-Neuve 1998, II 975–990. – Zu frühen Sammlungen von Epigraphica: grundlegend E. Ziebarth, De antiquissimis inscriptionum syllogis, in: EE IX (1913), 187–332; Calabi Limentani, Epigrafia latina 58ff. 453ff. 519ff.; vgl. auch E. Hübner, in: Handbuch d. klass. Altertums-Wissenschaft, München 18922, I 632ff. Zusammenfassend M.G. Schmidt, DNP 15/1, 2001, 54ff. s. v. Lateinische Inschriften; siehe die Forschungsberichte von R. Gordon, JRS 93, 2003, 217ff.; A.E. Cooley – St. Mitchell – B. Salway, JRS 97, 2007, 176ff. – Zu den epigraphischen Manuskripten des Vatikan vgl. vor allem die zahlreichen, in der Zeitschrift ‘Epigraphica’ erschienenen Beiträge von M. Buonocore, aufgelistet im Guide n. 1159, siehe auch n. 1160; zuletzt M. Buonocore, Epigraphica 65, 2003, 215ff.; ders., in: Miscell. Bibl. Apost. Vat. XIV, Città del Vaticano 2007, 119ff. – Vgl. darüber hinaus zu Poggio: A. Petrucci, in: Dizionario Biografico degli Italiani XIII, Rom 1971, |10|640ff.; I. Kajanto, Poggio Bracciolini and Classicism. A Study in Early Italian Humanism, Helsinki 1987; “Cyriacus von Ancona als Begründer der Inschriftenforschung” nach E. Ziebarth, Neue Jbb. f. d. Klass. Altertum 9, 1902, 214–226; vgl. den Kongreß-Band G. Paci (ed.), Ciriaco d’Ancona e la cultura antiquaria dell’Umanesimo. Atti del convegno Ancona 1992, Reggio Emilia 1998. – Zu Giocondo zuletzt mit weiterer Literatur H. Solin, in: G. Dummer – K. Sallmann (ed.), De studiis classicis inde a Petrarca ad Melanchthonem in multis partibus Europae florentibus, Rom 1997, 127–135. – Das Dictum über Ligorio bei H. Burns, in: R. W. Gaston (ed.), Pirro Ligorio. Artist and Antiquarian, Florenz 1988, 19–92; Ligorio aus heutiger kunstgeschichtlicher Sicht mit positivem Gesamturteil: A. Schreurs, Antikenbild und Kunstanschauungen des neapolitanischen Malers, Architekten und Antiquars Pirro Ligorio (1513–1583), Köln 2000; aus epigraphischer Perspektive, jedoch zu positiv, H. Solin, in: R. Günther – St. Rebenich (ed.), E fontibus haurire, Paderborn al. 1994, 335–351. – M. Smetius wird gewürdigt von J. Verbogen, Human. Lovan. 34, 1985, 255–272. – Zur Gruters Werk vgl. nur Calabi Limentani, Epigrafia Latina 49. 118 und sonst; zu G. Marini ebda. 75. 92. 100 (Lit. 456); ein interessanter Einblick in die Arbeit Marinis mit seinem ‘Gruter’ bei M. Buonocore, Epigraphica 57, 1995, 191ff. – Zu B. Borghesi vgl. Calabi Limentani, Epigrafia Latina 67f.; A. Donati (ed.), Bartolomeo Borghesi – scienza e libertà. Colloquio internazionale AIEGL, Bologna 1982. – Zu den antiquarischen Studien des 16.–18. Jh. und dem sog. Pyrrhonismus vgl. A. Momigliano, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 13, 1950, 285–315. – Die Situation der Epigraphik nach Gruter beschreibt eindringlich W. Henzen, Die Lateinische Epigraphik und ihre gegenwärtigen Zustände. Theodor Mommsen’s Inscriptiones Regni Neapolitani Latinae, Allg. Monatsschrift für Wiss. u. Lit. 1853, 157–184 (Zitat S. 163). – Die internationale Zusammenarbeit von Theodor Mommsen mit anderen Gelehrten, insbesondere mit G.B. de Rossi, beleuchtet die jetzt edierte italienische Korrespondenz Mommsens aus den Beständen der Biblioteca Apostolica Vaticana: M. Buonocore (ed.), Theodor Mommsen e gli studi sul mundo antico. Dalle sue lettere conservate nella Biblioteca Apostolica Vaticana, Napoli 2003. – Zum Plan einer französischen Sammlung zu Beginn des 19. Jh. s. J. Scheid, in: A. Donati (ed.), Bartolomeo Borghesi (wie oben), 337–353. Die französische Epigraphik seit 1888 bis auf unsere Tage in den geographisch geordneten Beiträgen in: Actes du colloque international du centenaire de l’Année épigraphique (Paris 19–21 octobre 1988), Paris 1990. – Zur Geschichte des ‘Corpus Inscriptionum Latinarum’ vgl. meine Darstellung in: Schmidt, Corpus, 8ff. – mit einem Ausblick auf die künftigen Editionsvorhaben dieser Reihe bis zum Jahre 2030 (den Stand der Arbeiten nach dem Zweiten Weltkrieg referiert V. Weber, Klio 41, 1963, 282ff.). – Ausführlichere Darstellungen aus unterschiedlichem Blickwinkel, die allerdings nicht über die Zeit Mommsens hinausführen, finden sich in: J.P. Waltzing, Le recueil général des inscriptions latines (Corpus Inscriptionum Latinarum) et l’épigraphie depuis 50 ans, Louvain 1892; A. von Harnack, Geschichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 3 Bde., Berlin 1900; L. Wickert, Theodor Mommsen. Eine Biographie, 4 Bde., Frankfurt/M. 1959–1980; zur Arbeit am Corpus vgl. auch S. Rebenich, Theodor Mommsen – eine Biographie, München 2002, bes. 80ff. 135ff.