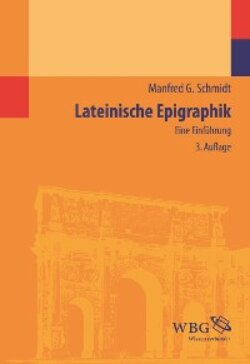Читать книгу Lateinische Epigraphik - Manfred G. Schmidt - Страница 12
2. Das Handwerk des Epigraphikers
ОглавлениеAutopsie der Inschriften
Für die kritische Edition ist verbindlich geblieben, was bereits Theodor Mommsen im 19. Jahrhundert zur ersten Forderung epigraphischer Forschung erhoben hatte: Sie setzt, sofern dies noch möglich ist, die Autopsie der Denkmäler voraus. Mit Hilfe der Methoden des Epigraphikers ist eine umfassende Dokumentation zu erstellen, auf deren Grundlage erst eine Textsammlung erarbeitet werden kann. Sie umfaßt die Ermittlung des grösseren archäologischen Zusammenhangs und die Berücksichtigung des epigraphischen Environments in den Grenzen städtischer und provinzialer Kultur ebenso wie die Aufnahme und Dokumentation des Monuments und des Schriftzeugnisses. Während der weitere Kontext jeweils verschieden ist und sich somit einer verallgemeinernden Betrachtung entzieht, ist im Zusammenhang einer Einführung der epigraphische Befund selbst Gegenstand der Betrachtung (zu den Inschriftträgern s. unten, Kap. IV. Inschriftenklassen; im übrigen s. di Stefano Manzella, Mestiere bes. 79ff.).
Handwerkliche Techniken
Zur Sicherung des epigraphischen Befundes bedient sich der Epigraphiker verschiedener Dokumentationstechniken, um eine umfassende und verläßliche Basis für die Wiedergewinnung und schriftliche Niederlegung der meist nur fragmentarisch erhaltenen Texte zu gewinnen. Je minutiöser die Vorarbeiten am Fundort und dem Original selbst, um so einfacher später die Konstituierung des Textes, die dann meist ohne eine erneute Revision des Inschriftträgers auskommen muß. Der Epigraphiker wird also, um ein genaues Bild von der Inschrift und ihrem Träger zu gewinnen, eine detailgetreue Zeichnung anfertigen, ergänzt um Angaben zu Material und Maßen sowie Notizen zu jenen Seiten des Monuments, die zwar keine Schrift aufweisen, aber vielleicht über dessen Zweck, die ursprüngliche Aufstellung, eine eventuelle Wiederverwendung, Beschädigung oder auch dessen Reparatur Aufschluß geben können. In den seltensten Fällen ist dies eine Pause – eine Durchzeichnung auf dünnem Seidenpapier oder auf Folie, wie sie sich für alle nicht vertieften oder erhabenen Inschriften empfiehlt (z.B. gemalte Buchstaben oder Intarsien von Metallbuchstaben in Marmor oder Erz, Mosaiken), denn die Zeugnisse sind oftmals viel zu groß, um auf diese Weise erfaßt werden zu können. Es ist vielmehr die freie Handzeichnung, die erst nach vielen Versuchen so recht gelingen will, zugleich den Blick für das entscheidende Detail schärft. Sie ist aber auch subjektiv verfremdet, |17|denn die korrekte Kopie einer Inschrift setzt professionelles Vorverständnis voraus. Insofern scheint Gaetano Marinis Wort, “nur der könne eine Inschrift richtig abschreiben, welcher sie zu verstehen im Stande sei, und der sie verstehen, der sie auch abschreiben könne”, ein Dilemma epigraphischer Heuristik zu beschreiben (Marini zitiert bei W. Henzen, Allg. Monatsschrift f. Wissenschaft u. Lit. 1853, 159).
Eine originalgetreue Kopie der Inschrift gewinnt man mit Techniken wie der genannten Pause oder der Durchreibung mit einem weichem Bleistift oder Graphitstaub auf Papier.
Abklatsch/ectypum
Ein wirklich authentisches, dreidimensionales Abbild einer Inschrift gibt einzig das Cliché, d.h. ein Gipsabguß oder ein Abklatsch (engl. squeeze, span./ital. calco, franz. estampage, lat. ectypum), der besser aus Papier denn aus Latex hergestellt wird, denn die Gummimasse härtet bei längerer Lagerung aus und wird dadurch brüchig. Ein Gipsabguß wird von Epigraphikern heute seltener angefertigt, denn die Prozedur ist aufwendig und langwierig, ihr Ergebnis äußerst fragil und die so gewonnene Replik für die massenhafte Lagerung wenig geeignet. Der Papierabklatsch hingegen hat sich als das verläßlichste Kopierverfahren behaupten können – und dies trotz der Konkurrenz der Fotografie. Denn es ist für die Konstituierung des Textes von unschätzbarem Wert, wenn die Inschrift in Kopie ‘mitgenommen’ werden kann, ein Abbild in Originalgröße für die Anpassung von Fragmenten, für die Lesung von schwierigen Passagen im Streiflicht zur Verfügung steht. Dabei ist die Herstellung eines Papierabklatsches (ectypum chartaceum) denkbar einfach: Nach der Reinigung des Inschriftsteins, dem Ablösen von Verkrustungen, Moos oder Flechten, wird ein Blatt ungeleimtes Papier gewässert und auf dem Inschriftfeld glatt und sauber aufgebracht. Kräftige, gleichmäßige Schläge mit einer federnden Bürste lassen die feuchte Papiermasse in die Vertiefungen der Oberfläche eindringen und erzeugen ein Negativ der Inschrift, das nach dem Trocknen abgezogen wird. Das so gewonnene ‘Spiegelbild’, mit seitenverkehrter Schrift und erhabenen Buchstaben, kann dann im schrägen Streiflicht, das die Konturen der Buchstaben besonders deutlich hervortreten läßt, gelesen oder fotografiert werden und bietet eine Wiedergabe der Inschrift, die oftmals aufschlußreicher ist als der Befund am Original (vgl. Abb. 8.17.33).
Materialbestimmung
Dies gilt allerdings nur für die Schrift, nicht für den Inschriftträger und dessen Material, das ebenso vielfältige Hinweise auf die Zeitstellung, die Funktion der Inschrift und ihre Herkunft geben kann (vgl. das Beispiel von Traditionsbindung und der Verwendung einheimischen Steines in Sagunt bei G. Alföldy, in: Die römische Gesellschaft. Ausgewählte Beiträge, Stuttgart 1986, 239–284).
Im Rom der republikanischen Zeit waren Tuffstein (lapis tophaceus), Peperin oder Travertin die Steinsorten, in welche Inschriften geschnitten wurden. Abgesehen davon, daß das vulkanische Gestein aus der Nähe stammte und somit einfach zu beschaffen war, sind diese relativ weichen Sorten leicht zu bearbeiten (zur Datierung von Inschriften auf Travertin vgl. A.E. Gordon, Latin Epigraphy 6 mit Lit.). Zur stärkeren Hervorhebung der Inschriften auf diesem porösen Material wurden die Buchstaben mit schwarzer oder roter Farbe (minium) ausgemalt – ein Usus, der auch später auf dem seit spätrepublikanisch-augusteischer Zeit bevorzugten |18|Marmor fortgesetzt wurde. Marmor war auch in den kaiserzeitlichen Provinzen das für repräsentative Bauten besonders gern verwendete Material. Ansonsten wurden Stelen, Tafeln und Altäre vor allem aus Kalkstein (lapis calcarius) gefertigt, daneben auch aus Sandstein (lapis arenarius), wie in der Provinz Germania superior, und selbst aus dem körnigen, nur schlecht zu bearbeitenden Granit (lapis granatus), wie in Zentralspanien – je nach den lokalen Vorkommen. Das Material kann also u.U. auch zur Bestimmung der Herkunft eines Inschriftsteins ohne sonstige Angaben zu seiner Provenienz herangezogen werden – ja sogar zur Datierung. Um ein Beispiel zu nennen: Es fällt auf, daß viele Meilensteine aus der Provinz Noricum (Österreich) in Severischer Zeit aus Schaidberger Marmor geschnitten wurden; offensichtlich hat man also für eine kurze Zeit dieses Vorkommen genutzt, denn frühere wie spätere miliaria der Provinz sind aus ganz anderem Stein. So kann selbst eine anepigraphe, also unbeschriftete, norische Meilensäule aus Schaidberger Marmor mit einiger Sicherheit in Severische Zeit datiert werden – und damit auch die Nutzung des öffentlichen Fahrwegs (via publica), an dem sie stand (zu den norischen Meilensteinen vgl. G. Winkler, Die römischen Straßen und Meilensteine in Noricum – Österreich, Stuttgart 1985).
Bibl. Hinweise
Allgemein zum Handwerk des Epigraphikers: di Stefano Manzella, Mestiere, bes. 29ff. zu den Kopiertechniken; grundlegend E. Hübner, Über mechanische Copiien von Inschriften, Berlin 1881; ältere Lit. bei Meyer, Einführung 104ff.; eine umfangreiche Sammlung von Papierabklatschen bei Gordon, Album; vgl. meine Beispielsammlung von Ectypa: Schmidt, Spiegelbilder; P. Kragelund, Anal. Rom. Inst. Dan. 29, 2003, 155–173. – Material: N. Herz – M. Waelkens, Classical Marble. Geochemistry, Technology, Trade, Dordrecht 1988; M. Maischberger, Marmor in Rom. Anlieferung, Lager- und Werkplätze in der Kaiserzeit, Wiesbaden 1997; Y. Maniatis al. (ed.), The Study of Marble and Other Stones Used in Antiquity, London 1995; vgl. die Steinbruchinschriften und weitere Lit. bei M. Christol – T. Drew-Bear, Epigraphica 53, 1991, 113–174 (Marmor von Dokimeion); zum afrikanischen Marmor F. Rakob, Simitthus I: Die Steinbrüche und die antike Stadt, Mainz 1993.