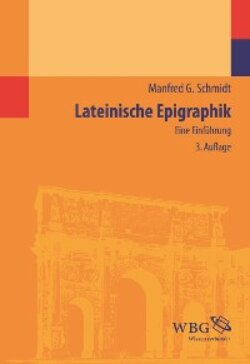Читать книгу Lateinische Epigraphik - Manfred G. Schmidt - Страница 8
Оглавление|VII|Vorwort
Als mich Gregor Weber als Herausgeber der Reihe altertumswissenschaftlicher Einführungen fragte, ob ich eine Einführung in die lateinische Epigraphik schreiben wolle, habe ich spontan zugesagt. Nach über dreißig Jahren war Ernst Meyers verdienstvolles Büchlein (Darmstadt 1973; 3. unveränd. Aufl. 1991) nicht mehr auf dem aktuellen Forschungsstand; und ihm fehlte ein wichtiges Element einer Einführung: die exemplarische Präsentation von Inschriften mit Foto oder Zeichnung, im Originaltext mit Übersetzung und kurzem Kommentar.
Freilich mußte in der hier vorgelegten, knappen Darstellung des Gegenstands das Beispiel weniger Inschriften genügen, wobei die Beschränkung auf ca. dreißig Abbildungen dazu zwang, verschiedene Themen gegebenenfalls an einer Inschrift abzuhandeln.
Neben den textkritischen Standardeditionen habe ich deshalb immer auch Auswahlsammlungen zitiert, die durch Kommentar oder Übersetzung gerade dem Neuling willkommene Hilfestellung geben können. An erster Stelle sind hier Leonhard Schumachers Römische Inschriften zu nennen, eine mit sicherer Hand ausgewählte und schnörkellos kommentierte Sammlung von fast 300 lateinischen Inschriften, die das Spektrum der im Rahmen dieser Einführung gegebenen exempla erweitert.
Der bibliographische Nachweis von Inschriften wurde ansonsten auf die Angabe der verbindlichen Edition im Corpus (CIL) oder den Verweis auf die Année épigraphique (AE) beschränkt, während der Leser sich mit Hilfe des Index über Korrekturen und Neulesungen im Corpus selbst und über die Publikation in älteren Auswahlsammlungen informieren kann. Die über das Corpus hinausführenden, neueren Arbeiten zu den Inschriften werden zudem im Guide de l’épigraphiste (= Guide) nachgewiesen (Aktualisierungen hierzu im Internet unter: www.antiquite.ens.fr/publications/guide_en.html). Ein Beispiel:
Zur Inschrift CIL IX 2855 (s. unten S. 57 und 84) gibt der Index einen Verweis auf CIL V 1066*, 3 sowie auf Dessaus Sammlung der Inscriptiones Latinae Selectae, ILS 5501. Der Guide wiederum nennt in seiner systematischen Bibliographie unter CIL IX die neuere Forschung zur Regio quarta Italiens und speziell zu Histonium – in diesem Falle unter der Nr. 691 Marco Buonocores Ergänzungen in: Supplementa Italica n. s. 2, Rom 1983, 97–144. Damit ist die ältere wie die neuere epigraphische Forschung zu dieser Inschrift aus Histonium aufgeschlossen (zur kombinierten Benutzung von CIL und Index, AE und Guide vgl. im übrigen unten S. 132f.).
Zu danken habe ich dem ‘Deutschen Archäologischen Institut’ in Rom, namentlich Frau Dr. Sylvia Diebner, die freundlicherweise Aufnahmen aus dem Fotoarchiv zur Publikation freigegeben hat; ebenso Dr. Hans-Georg Kolbe, dem ehemaligen wissenschaftlichen Direktor daselbst, den Freunden |VIII|Dott. Marco Buonocore (Scriptor Latinus an der ‘Biblioteca Apostolica Vaticana’) und Dr. Armin U. Stylow (Leiter des ‘Centro CIL II2’, Univ. Alcalá de Henares), auf deren Aufnahmen aus Italien, Afrika und Spanien ich zurückgreifen konnte.
Ein ganz herzlicher Dank geht an die Kollegen vom Corpus Inscriptionum Latinarum (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften), allen voran Marcus Dohnicht und Dr. Andreas Faßbender, – nicht nur für ihre vielfältigen Hinweise und Korrekturen, sondern auch für die editorische Betreuung des Buches.
Prof. Dr. Gregor Weber bin ich besonders verpflichtet – er hat diese Einführung angeregt und die sukzessiv eingehenden Manuskriptsendungen trotz vielfältiger Verpflichtungen jederzeit gern gelesen und kommentiert. Dr. Harald Baulig, dem Verlagslektor für die Altertumswissenschaften, danke ich für sein Verständnis im Umgang mit ‘viel beschäftigten’ – sprich: säumigen – Autoren. Und schließlich gibt es immer ein last not least:
Meiner Frau Estrella Velasco Servert sage ich meinen allerherzlichsten Dank dafür, mit wachem Interesse und kritischem Blick verschiedene Fassungen geduldig gelesen und sachkundig korrigiert zu haben.
| Berlin, im Juni 2004 | Manfred G. Schmidt |
Vorwort zur zweiten Auflage:
Die positive Aufnahme des Buches, die nun eine zweite Auflage notwendig macht, hat mich darin bestärkt, an der Systematik desselben nichts zu verändern. Wenn vereinzelt angeregt wurde, doch ein Kapitel dem Militär zu widmen oder detaillierter die verschiedenen Posten der senatorischen oder ritterlichen Laufbahn darzustellen, so lehrt ein Blick auf neuere, umfängliche Handbücher und Einführungen, daß in der Fokussierung auf die eigentliche Disziplin mehr Gewinn liegt:
Dies ist kein Handbuch der römischen Verwaltungsgeschichte, auch keine Geschichte der Legionen Roms oder gar eine römische Sozialgeschichte. Diese Einführung orientiert sich streng an ihrem Thema – an der lateinischen Epigraphik, die naturgemäß in alle Bereiche römischer Kultur und Lebenswelt führt. Für die vertiefende Arbeit zu einzelnen Themen sei hier nochmals auf die reichen Literaturangaben hingewiesen. Ich habe daher im wesentlichen die bibliographischen Angaben aktualisiert und nebenbei kleinere Ergänzungen eingefügt.
Für Hinweise und Hilfe bei der Drucklegung bin ich wieder meinem Kollegen Marcus Dohnicht (CIL) verpflichtet. Auch diese zweite Auflage widme ich meinen Töchtern, die jetzt schon mit mehr Verständnis dem Buch folgen können.
| Berlin, im Oktober 2010 | Manfred G. Schmidt |