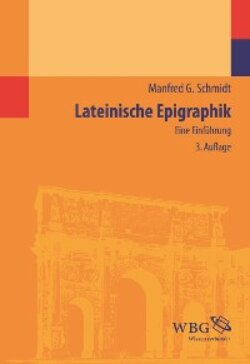Читать книгу Lateinische Epigraphik - Manfred G. Schmidt - Страница 9
|1| I. Einleitung
ОглавлениеArbeitsfeld und Zeitraum
Lateinische Inschriften sind für die allseitige Erforschung römischer Lebenswelt und Geschichte von unschätzbarem Quellenwert. Als unmittelbare Hinterlassenschaft der Antike, als ‘sprechende’ Zeugnisse einer vergangenen Kultur, die das Bild Europas nachhaltig geprägt hat, geben Inschriften verläßliche Orientierung im Trümmerfeld archäologischer Überreste und weisen den Monumenten oftmals erst ihren ‘Sitz im Leben’ an. Seit dem frühen Rom, in bedeutender Zahl aber erst in Augusteischer Zeit und in der Folge dann die ganze Kaiserzeit hindurch bis ins 6. Jh. n. Chr., begleiten lateinische Inschriften die tausendjährige Geschichte Roms, ihrer Provinzen, ihrer Menschen und spiegeln als allgegenwärtiges Medium alle Facetten gesellschaftlicher Kommunikation wider. Ob gemeißelte Grabinschrift aus Nordafrika oder gemalte Inhaltsangabe auf spanischen Amphoren, ob Besitzerinschrift auf römischem Sklavenhalsband, obszönes Graffito an den Häuserwänden Pompejis oder Straßenbauinschrift an syrischem Fels – so vielfältig wie Form und Material des Inschriftträgers sind auch die Texte selbst, die uns aus allen Teilen des Imperium Romanum und auf ganz unterschiedlichen Inschriftträgern erhalten sind.
Gegenstand der lateinischen Inschriftenkunde oder der Epigraphik (von griech. γράφειν “auf-, einschreiben”) sind alle originären lateinischen Schriftzeugnisse aus römischer Zeit, die uns auf dauerhaftem Material überliefert sind. Ja, sogar Inschriften auf nicht beständigen Materialien, etwa tabulae ceratae oder mit Tinte beschriebene Holztäfelchen, zählen dazu (s.u.S. 76f.), auch solche auf Gemmen und Ringen, während die Münzlegenden und die schriftliche Hinterlassenschaft auf Papyri oder Pergament eigenen Disziplinen vorbehalten sind.
Letzteres, das Pergament, ist als Beschreibstoff, der seit dem 4. Jh. n. Chr. für die literarische Überlieferung gebräuchlich wurde, Träger der gesondert zu behandelnden Buchkultur. Freilich haben auch Inschriften auf Bronze oder Stein Zeugnisse ‘literarischen’ Ranges bewahrt:
Inschriften ‘literarischen’ Ranges
Man denke nur an die ‘Königin der lateinischen Inschriften’ (Th. Mommsen), den Tatenbericht des Augustus (Res gestae divi Augusti), die Rede des Kaisers Claudius im Senat (CIL XIII 1668; zu beiden Zeugnissen s.u.S. 37), die Grabrede eines Witwers aus Augusteischer Zeit, die sog. ‘Laudatio Turiae’ (CIL VI 41062), oder man denke an dichterische Zeugnisse wie den Wechselgesang zwischen Praetextatus und seiner Frau Paulina in jambischen Senaren (CIL VI 1779 cf. Index ad n.) und das ‘Carmen de obitu Probi’ des Hl. Ambrosius (ICVR n. s. 4219b). Sie alle stehen der literarischen Überlieferung in nichts nach; und gerade die inschriftlich erhaltenen juristischen Texte zeigen, daß die Buchüberlieferung von Gesetzestexten aus späterer Zeit wie der ‘Codex Theodosianus’ (438 n. Chr.) eine epigraphische Vorgeschichte hat.
|2|Epigraphic habit
Der genauere Zeitraum des epigraphic habit in der römischen Welt, der Herausbildung und des Bestehens einer epigraphischen Kultur lateinischer Sprache, läßt sich nur regional genauer und damit unterschiedlich fassen – je nach Ausbreitung und Dauer römischer Herrschaft: Die zeitlich weiteste Ausdehnung ergibt sich durch die Eckdaten der frühesten Zeugnisse Roms und seiner Umgebung im ausgehenden 7. und beginnenden 6. Jh. v. Chr., als man schon eine eigenständige lateinische Schrift und Sprache von etruskischen und umbro-sabellischen Texten scheiden konnte, bis zum Anfang des 8. Jh. n. Chr. im westlichsten Teil des Imperium Romanum, wo das Jahr 711 n. Chr. das Datum der arabischen Eroberung Spaniens markiert und somit das Ende auch der genuin ‘römischen’ Epigraphik, – wiewohl diese im Westgotischen und Mozarabischen ihre unmittelbaren Nachfolger findet. So sind Anfang und Ende der lateinischen Epigraphik kaum durch eine scharfe Grenze zu markieren.
Romanisierung
Und der Epigraphiker sollte sich stets in Erinnerung rufen, daß selbst noch in der Kaiserzeit, der Zeit weitgehender Romanisierung auch entlegener Landstriche in den Provinzen und der Hochblüte lateinischer Epigraphik, immer auch andere Kulturen mit eigener Sprache (sog. Sub- und Adstratsprachen) existiert haben, beginnend mit den Zeugnissen der Etrusker und der Griechen, deren Schrift und Sprache sich in Süditalien und im Osten des Mittelmeerraumes weiter behaupten konnte, bis hin zu den Kulturen der Peripherie mit ihren unterschiedlichen Blütezeiten: Die Iberer, die Phönizier mit ihren Schriftzeugnissen, auf der anderen Seite das Aramäische, Syrische usw. Das Nebeneinander der Sprachen dokumentieren sinnfällig die bi- oder trilinguen Inschriften, die oft den gleichen Text in zwei oder drei Sprachen bieten. Berühmte Beispiele sind etwa die Werbeinschrift eines Steinmetzen von vielleicht karthagischer Abstammung in Latein und Griechisch (Di Stefano Manzella, Mestiere 126, Foto 42; Calabi Limentani, Epigrafia latina 16f. Taf. 1 mit Kommentar), eine Weihung an Aesculapius mit lateinischem, griechischem und punischem Text aus republikanischer Zeit (CIL I2 2226 cf. Index ad n.) und eine späte bilingue Grabinschrift aus Tunesien (Henchir Brígita) (CIL VIII 793 = H. Donner, Kanaanäische und aramäische Inschriften 1. Texte, 1966, 26f. Kommentar II, 1968, 139 n. 142). Aber nicht nur das Nebeneinander, sondern auch die Durchdringung der Kulturen, vor allem die Adaption an das Römische, findet ihren Ausdruck in den Inschriften: Sei es nun die Integration fremder Namen im römischen Namensystem, die lateinische Schreibung von Texten anderer Sprachen (z.B. unten S. 49 mit Abb. 12), die Übernahme von Formeln und Wendungen in lateinischen Inschriften nach dem Vorbild anderer Kulturen (vgl. z.B. Häusle, Denkmal 22 Anm. 56), – oder, als ein Beispiel gesellschaftlichen Wandels: die Verschränkung indigener und römischer Ämter – etwa bei den Oberbeamten in Städten punischer Tradition, den sufetes, die gleichzeitig das römische Priesteramt eines flamen ausübten (z.B. IRT 321–323).
Epigraphik und Altertumswissenschaften
Die epigraphische Zunft, die sich das Sammeln, Lesen, Klassifizieren und Deuten dieser Inschriften, sodann ihre Edition und Kommentierung zur Aufgabe gemacht hat und die geographisch oder systematisch gegliederten Textsammlungen durch Indizes und Konkordanzen erschließt, ist angesichts des disparaten Quellenmaterials immer darauf angewiesen, ihre |3|Techniken im Dienste der jeweiligen altertumswissenschaftlichen Fragestellung und unter Berücksichtigung der Methoden jener Disziplinen zur Anwendung zu bringen. Über den Epigraphiker sagt daher treffend Ernest Badian: “In a sense, he stands at the centre of ancient studies” (in: G. Susini, The Roman Stonecutter, Oxford 1973, vii). Epigraphik kann also nur im Zusammenwirken verschiedener Disziplinen sinnvoll betrieben werden und stellt damit ein altertumswissenschaftliches Forschungsanliegen im umfassenden Sinne dar. Denn in jedem Falle bedarf sie der Archäologie und der historischen Topographie zur Beurteilung des Inschriftträgers und seines Grabungszusammenhangs (sofern ein solcher noch festzustellen ist), der Paläographie zur Klassifizierung und Datierung der Schrift, der Philologie zur Textkonstituierung und Einordnung in einen literarischen Kontext, je nach besonderer Problematik der Onomastik, der Sprachwissenschaft usw.
Andererseits sind jene eben genannten altertumswissenschaftlichen Disziplinen auf die Ergebnisse epigraphischer Grundlagenforschung im besonderen Maße angewiesen, da nur Inschriften (z.T. auch Papyri) unseren antiken lateinischen Textbestand heute noch nennenswert erweitern. Und ganze Zweige der Altertumswissenschaften – etwa die Prosopographie, die der Erforschung der Eliten in der römischen Gesellschaft gilt, oder die Forschung zur Sozialgeschichte ganz allgemein, zur Wirtschafts-, Verwaltungs- und Militärgeschichte – basieren großenteils auf diesem Quellenfundament.
Literarische und epigraphische Quellen
Wo die literarische Tradition schweigt oder nur bruchstückhaft und in Exzerpten auf uns gekommen ist (etwa die historiographische Literatur zur Geschichte des dritten nachchristlichen Jahrhunderts), vermag die inschriftliche Hinterlassenschaft oftmals einen Ersatz zu bieten.
Diachrone epigraphische Darstellungen wie die Fasten von Priestern und staatlichen Amtsträgern, Kalender und Chroniken von Städten und Institutionen, sind Vorläufer wie auch bleibendes Grundgerüst der historiographischen Tradition (Annalen); und selbst der Cursus honorum, die Darstellung der Ämterlaufbahn – manchmal auch der Lebensstationen eines Menschen – läßt sich mit der literarischen Biographie vergleichen.
Daneben korrigieren, bestätigen oder ergänzen epigraphische Zeugnisse die literarische Tradition und geben – anders als diese, weil sie in der Regel unmittelbarer Überlieferung verdankt werden – ein von der Tradition unverfälschtes Zeugnis römischer Kultur und Geschichte. Das bestätigen die jüngsten Funde aus Spanien, die dem Bericht des Tacitus über den Tod des Germanicus und seine Folgen nun eine zeitgenössische, offizielle Version zur Seite stellen (vgl. unten S. 35f.).
Auch die Lexikographie, die ihren Ausgang von der handschriftlich tradierten ‘Literatur’ nimmt, begreift die epigraphischen Zeugnisse als den literarischen zur Seite zu stellen und bisweilen nur durch den Zufall der Überlieferung unterschieden. So ist es ganz selbstverständlich, wenn der ‘Thesaurus linguae Latinae’, das umfassende Wörterbuch lateinischer Sprache, auch immer das Zeugnis der antiken lateinischen Inschriften berücksichtigt.
|4|Bibl. Hinweise
Vgl. meine einführenden Bemerkungen in: Schmidt, Corpus 2f. (als Datei in der 1. Aufl. unter http://cil.bbaw.de). Zur Abgrenzung der Epigraphik von den Disziplinen Papyrologie und Handschriftenkunde siehe die ältere Diskussion bei W. Larfeld, Griechische Epigraphik, München 19143, 1ff.; vgl. zuletzt Calabi Limentani, Epigrafia latina 16ff. – Beispiele ‘literarischer’ Inschriften: ‘Laudatio Turiae’, vgl. D. Flach, Die sogenannte Laudatio Turiae. Einleitung, Text, Übersetzung und Kommentar, Darmstadt 1991; ‘Carmen de obitu Probi’ des Hl. Ambrosius, vgl. M.G. Schmidt, Hermes 127, 1999, 99–116. – Der Begriff epigraphic habit wurde geprägt von R. MacMullen, AJPh 103, 1982, 233–246; s. schon S. Mrozek, Epigraphica 35, 1973, 113–118; zu den Grabinschriften vgl. E.A. Meyer, JRS 80, 1990, 74–96; zur Entwicklung in der Kaiserzeit G. Woolf, JRS 86, 1996, 22–39. Zum ‘epigraphic habit’, speziell zum Wandel im 3. Jh. n. Chr., vgl. den weit gespannten Ansatz von B. Borg – Chr. Witschel, in: Alföldy – Panciera (ed.), Selbstdarstellung 47–120. – Zunächst mit der Frage nach der Schreibund Lesefähigkeit der Bevölkerung in der Stadt Rom und in den Provinzen verknüpft, der Frage nach der literacy, war epigraphic habit auf das Phänomen der Enstehung und des Niedergangs der epigraphischen Kultur Roms bezogen, während der Begriff jetzt als Synonym für ‘epigraphische Kultur’ regionaler Ausprägung gebraucht wird. Zur damit zusammenhängenden Frage nach der ‘Romanisierung’ siehe den umfassenden Forschungsbericht von G. Alföldy, Romanisation – Grundbegriff oder Fehlgriff? Überlegungen zum gegenwärtigen Stand der Erforschung von Integrationsprozessen im Römischen Weltreich, in: Zs. Visy (ed.), Limes XIX. Proceedings of the XIXth Congress of Roman Frontier Studies held in Pécs, Hungary, September 2003, Pécs 2005, 25–56. – Mozarabisch und Westgotisch: Beispiele bei E. Hübner, Inscriptiones Hispaniae Christianae, Berlin 1871, p. 68–90; ders., Inscriptionum Hispaniae Christianarum supplementum, ebda. 1900, p. 97–132. Zum Mozarabischen vgl. auch G. Ineichen, Arabisch-orientalische Sprachkontakte in der Romania, Tübingen 1997; siehe im übrigen die einschlägige romanistische Literatur; Hinweise auf neuere Lit. z.B. im Band A. Bollée – J. Kramer (ed.), Latinitas et Romanitas, Bonn 1997. – Durchdringung: Vgl. nur Solin, Namenbuch, zu den griechischen Personennamen in Rom; G. Alföldy, Die Personennamen in der römischen Provinz Dalmatia, Heidelberg 1969; vgl. M.L. Albertos Firmat, in: ANRW II 29.2 (1983), 853–892 zu indigenen Namen in Hispanien (weiteres zur Onomastik im Guide n. 1366ff.); vgl. auch die Beiträge in: ANRW II 29.2 (1983) von R. Schmitt (Griechisch und Latein in den östl. Provinzen), 554–586, W. Meid (zu gallorömischen Inschriften) 1019–1044. – Zu Bi- und Trilinguen siehe Häusle, Denkmal 22f. 48f.; Calabi Limentani, Epigrafia latina 18ff.; eine Sammlung nordafrikanischer Zeugnisse: G. Marcy, Les inscriptions libyques bilingues de l’Afrique du Nord, Paris 1936; vgl. die Beiträge in: J.N. Adams – M. Janse – S. Swain (ed.), Bilingualism in Ancient Society. Language Contact and Written Text, Oxford 2002; F. Biville – J.-C. Decourt – G. Rougemont (ed.), Bilinguisme gréco-latin et épigraphie (Actes du colloque international, Lyon, 17–19 mai 2004), Lyon 2008. – Biographie und Epigraphik: G. Alföldy, Inschriften und Biographie in der römischen Welt, in: K. Vössing (ed.), Biographie und Prosopographie. Internationales Kolloquium zum 65. Geburtstag von Anthony R. Birley, Stuttgart 2005, 29–52. – Illustrationen zum Thema ‘Epigraphik und Lexikographie’ bietet der Beitrag von H. Solin, in: Wie die Blätter am Baum, so wechseln die Wörter, Stuttgart – Leipzig 1995, 57–78.