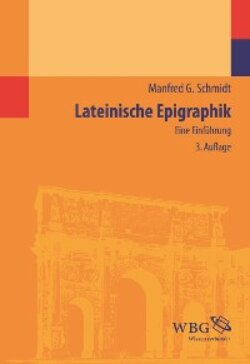Читать книгу Lateinische Epigraphik - Manfred G. Schmidt - Страница 11
|11| III. Epigraphischer Befund und Edition 1. Editorische Prinzipien
ОглавлениеIn einer Denkschrift der Berliner Akademie aus dem Jahre 1847 mit dem Titel ‘Über Plan und Ausführung eines Corpus Inscriptionum Latinarum’ legte Theodor Mommsen in Abgrenzung zu den früheren Editionen seine dezidierte Auffassung zum Plan eines umfassenden lateinischen Inschriftenwerks nieder:
“Die Nothwendigkeit einer Sammlung aller lateinischen Inschriften braucht nicht erst bewiesen zu werden. Notorisch ist die gruter-scaligersche veraltet, die muratorische von Haus aus mangelhaft und unzulänglich, die Masse der außerhalb der beiden Hauptsammlungen befindlichen, in hundert Büchern zerstreuten Inschriften ungeheuer …” (bei von Harnack, Geschichte II 522).
Sein immer wieder zitiertes Wort, daß “… alle Kritik aber ohne Zurückgehen auf die letzten Quellen Stückwerk ist”, ist dieser Broschüre entnommen (ebda. 526f.); es gibt in lakonischer Kürze die Richtlinien epigraphischer Forschung vor – sowohl, was die Arbeit mit Handschriften und Druckwerken angeht, als auch, was die Beurteilung der Inschrift selbst betrifft. In dem Bemühen, der unübersichtlichen Masse von Codizes und Publikationen ganz unterschiedlicher Qualität Herr zu werden, hat Mommsen vor allem zwei editorische Forderungen formuliert: die einer radikalen Echtheitskritik und das Gebot der Autopsie der Inschriften.
Fälschungen
Als realisiertes, in Stein oder Bronze geschnittenes Artefakt gibt sich eine Fälschung schon an den Charakteristika der Schrift (Schnitt und Form der Buchstaben, Interpunktion, Ligaturen) und an der Ausführung des Inschriftträgers zu erkennen (verwendetes Material, Schmuckelemente wie Rahmung, Reliefs, figürliche Darstellungen usw.). Untrügliche Zeichen nachantiker Steinmetzarbeit sind auf der umseitig abgebildeten Inschrift die Interpunktion auf der Höhe der Standlinie der Buchstaben nach modernem Gebrauch (nach dem abgekürzten Namen Ael(ius), Z. 2); sie sind im übrigen in Dreiecken ausgeführt, deren Spitze nach oben weist, so wie sie nur auf republikanischen Monumenten zu sehen sind. Auch die zu kurze Mittelhaste des E, abgeschlossen mit einer deutlichen Serife (z.B. Z. 1 bei prole und sonst), das M mit senkrechten Außenhasten und einem Winkel in der Mitte, der nicht bis zur Standlinie reicht, sowie die schräge Ligatur von A und E (Z. 3 und 4) sind Kennzeichen moderner Gestaltung. Die schlichte Rahmung um das vertiefte Inschriftfeld ist bei einer solchen, repräsentativen Zwecken dienenden Inschrift verdächtig, wo wir die sonst geläufige Rahmung antiker Monumente erwarten: Das cymatium rectum oder inversum, so genannt nach seinem wellenartigen Profilschnitt.
|12|Abb. 1: Inschrift zu Ehren der Stadt Venusia/Italien, ursprünglich wohl auf einem Statuenpostament; das Monument wurde geweiht (consecravit) von einem gewissen Aelius Restitutianus aus der Führungselite des Reiches, eines v(ir) p(erfectissimus), vgl. PLRE I 764 s. v. Restitutianus. Von Mommsen (CIL IX 430) wurde die Inschrift als Abschrift eines antiken Originals angesehen, das von früheren Gewährsleuten zwar beschrieben, aber nicht einstimmig als antik beurteilt wurde. Das hier abgebildete Exemplar ist jedenfalls modern und, sofern wirklich auf einen antiken Text zurückgehend, am Anfang korrupt, d.h. eine unvollständige, fehlerhafte Wiedergabe. Der Block selbst läßt keine Rückschlüsse auf die Gestalt des antiken Inschriftträgers zu.
Hingegen können Fälschungen in epigraphischen Manuskripten, wenn sie nicht von vornherein an den überlieferten Texten zu erkennen sind, nur dann sicher ausgeschlossen werden, wenn ihnen eine klare Einschätzung des Gewährsmannes, des Verfassers eines epigraphischen Codex, vorausgeht. Ist einmal anhand von Einzelfällen die Erkenntnis gewonnen, ein Autor habe sich durch nachgewiesene Fälschungen diskreditiert (beispielsweise Ligorio), muß notwendigerweise die gesamte, auf ihn gegründete Tradition in Frage gestellt werden. Wo dieser Autor als einzige Autorität einer Inschrift begegnet, muß – so das Konzept Mommsens – diese bis zum Beweis des Gegenteils zu den incertae vel falsae, zu den “unsicheren oder falschen Inschriften” gesetzt werden, um den reinen Bestand einer Edition nicht zu gefährden.
Diese Inscriptiones incertae vel falsae sind in den Bänden des CIL durch einen zur Nummer gesetzten Asteriskus, ein Sternchen, gekennzeichnet und treten in einer eigenen Abteilung vor die Präsentation der echten Zeugnisse; im Romband füllen sie mit über 3.600 Nummern sogar einen eigenen Faszikel (CIL VI fasc. 5). Es finden sich darunter so eindrucksvolle Zeugnisse wie jene Inschrift aus einem Vatikanischen Codex des 14. Jh., die vorgibt, Kaiser Nero habe den Ruhm des Dichters Lukan bewahren wollen, der an der Pisonischen Verschwörung gegen den Kaiser beteiligt war, CIL VI 6*: M(arco) A(nnaeo) | Lucano Cordubensi | poete beneficio | Neronis Caesaris |13|| fama servata. Weniger Spektakuläres bietet dem ambitionierten Epigraphiker noch heute ein ideales Übungsfeld für scharfsinnige Überlegungen zur handschriftlichen Tradition – sei es, daß in Zweifel gezogene Abschriften durch Wiederauffindung des Steines rehabilitiert werden, oder sei es, daß eine hinzugetretene, unabhängige, handschriftliche Tradition die Inschrift nochmals bestätigt und so neues Licht auf den Verfasser einer Handschrift wirft. Auch die Bestätigung des onomastisches Befundes durch eine neu entdeckte Inschrift derselben Person eröffnet die Möglichkeit, die Echtheit einer zunächst ausgesonderten Inschrift zu bestätigen. Freilich sollte man sich davor hüten, wegen derlei Trouvaillen vom methodisch einzig gangbaren Weg der sauberen Scheidung von bestätigter und zweifelhafter Tradition abzuweichen.
Fehlerhaft kopierte Inschriften und Interpolationen
Neben falschen Inschriften oder solchen mit falschen Herkunftsangaben sind mehrfach wiedergegebene Zeugnisse mit unterschiedlichen Lesungen auszusondern – dies wiederum eine Folge unkritischer Editionsarbeit der vorausgegangenen Generationen. Denn oftmals wurden Inschriften fehlerhaft kopiert, aus anderen ergänzt oder unverständliche Passagen ohne Kennzeichnung des Eingriffs willkürlich “verbessert”, auch Abkürzungen nach Gutdünken aufgelöst, so daß bisweilen aus einer ursprünglich korrekt wiedergegebenen Inschrift über die Zeit mehrere Fassungen entstehen konnten, die ihr Eigenleben entwickelten und als selbständige Zeugnisse die Zahl der Inschriften in den älteren Corpora vermehrten.
Beispiele aus Muratori
Nehmen wir ein besonders eklatantes Beispiel aus Muratoris inkriminiertem Werk: Es ist die Seite 7 seines ‘Novus Thesaurus’ (Abb. 2), die in der systematisch geordneten Sammlung den Iuppiter-Weihungen gewidmet ist. Unter den zehn hier versammelten Inschriften findet sich ein und dieselbe gleich zweimal auf dieser Seite wieder, insgesamt aber viermal in seinem Corpus (Muratori, Novus Thesaurus I p. VII n. 2 et 8; p. CXLI n. 5; p. CXLVI n. 3 = CIL III 1087), mit unterschiedlichen Lesungen und Herkunftsangaben. Hier hat der abgekürzt wiedegegebene Beiname Iuppiters Stat(or) bald zur Fehldeutung stat(uam) geführt, bald wurde er in Unkenntnis der adäquaten Auflösung einfach weggelassen. Noch schwerer wiegen drei dubiose Inschriften auf derselben Seite (p. VII n. 1 = CIL II 180a*; n. 4 = CIL X 632*; n. 10 = CIL XI 160*). Die erste stammt angeblich aus Antequera/Anticaria in der südspanischen Provinz Baetica die Weihung einer Silvia Severiana an Iuppiter Optimus Maximus. Diese Inschrift, nur aus handschriftlicher Tradition bekannt, hatte Emil Hübner in seiner Ausgabe der hispanischen Inschriften mit einem Asteriskus versehen und unter die Incertae vel falsae gesetzt, um anzuzeigen, daß sie in spanischen Sammlungen unbekannt geblieben ist und wahrscheinlich anderer Provenienz, vielleicht aber nicht gänzlich frei erfunden ist (CIL II 180a*, vgl. ebda. p. XXI). In der neuen Ausgabe (CIL II2/5, 744) wurde wiederum die Authentizität der Inschrift vertreten – obwohl das Nomen gentile Silvius/Silvia nicht gerade für hispanische Herkunft spricht (es ist ganz dürftig im Nordwesten der Iberischen Halbinsel belegt; vgl. H. Solin, Studi classici e orientali 43, 1993, 360, zu dieser Familie im conventus Asturum: “I cognomi in questa familia sono molto ‘romani’”). Und eine als zusätzlich und unabhängig bewertete Quelle zu dieser Inschrift ist nun in Verdacht geraten, die Existenz von einigen Inschriften aus Antequera fälschlich |14|behauptet zu haben (A. Franco y Bebrinsáez, Viaje topográfico desde Granada a Lisboa en 1774, Granada s. a. [1774]; vgl. dazu A.U. Stylow, Habis 32, 2002, 352). – Ein zweifelhafter Fall also, den Muratori hier als authentische Inschrift aus Anticaria dokumentiert hat. Auch heute ist es offensichtlich noch schwierig, Echtes von Falschem in der handschriftlichen Tradition zu scheiden. – Ein weiterer Eintrag auf dieser Seite führt zu einer Felsinschrift nach Atina, einer südöstlich von Rom gelegenen Stadt in Latium (Muratori, Novus Thesaurus I p. VII n. 4 = CIL X 632*; s. Abb. 2). Der Text lautet: Iovi | quod periculum | feliciter evaserit L(ucius) Sulla | v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). “Dem Iuppiter hat Lucius Sulla, weil er glücklich der Gefahr entronnen ist, das Gelübde gern erfüllt und verdientermaßen.” Das klassische Beispiel einer erfundenen Inschrift, denn gern werden die Großen aus Roms vergangenen Tagen herbeizitiert (vgl. oben zu Nero und Lukan)! Auch Muratori erschien eine Weihung des großen Diktators Lucius Cornelius Sulla Felix(!) zweifelhaft – vgl. quod periculum feliciter evaserit –, noch dazu in den blanken Fels gemeißelt. Er stellt die Echtheit aber nur in der Anmerkung in Frage: “Quod peregrinum puto.”
Die Säuberungsarbeit Mommsens bezog sich also vor allem auf die handschriftliche Tradition. Hier galt es, jede einzelne Inschrift, die ihren Weg in die Editionen nicht selten mittelbar gefunden hatte, auf ihren eigentlichen Gewährsmann zurückzuführen und so den Archetypus zu gewinnen. In der Bibliographie zu jeder Inschrift sollten die Abhängigkeiten der Autoren untereinander abzulesen sein, die Varianten aber in einem textkritischen Apparat notiert werden, um so dem Benutzer der Edition auf der Grundlage einer vollständigen Dokumentation ein selbständiges Urteil zu ermöglichen.
Sofern also Inschriften heute verloren sind und ihre Texte ausschließlich handschriftlicher Tradition verdankt werden, ist bei der Bewertung der einzelnen Textzeugen und ihrer Abhängigkeit untereinander die philologische Textkritik gefordert.
Bibl. Hinweise
Wiedergabe der “als Handschrift für die Herren Mitglieder” der Akademie gedruckten Schrift bei Harnack, Geschichte II 522ff. n. 216. Wesentliche Elemente seiner Konzeption eines ‘Corpus Inscriptionum Latinarum’ konnte Mommsen den Vorarbeiten Olav Kellermanns wie auch dem Pariser Plan entnehmen, s. J.P. Waltzing, Le recueil général usw., Louvain 1892, 39ff. Zum Vergleich die Denkschrift O. Kellermanns bei J. Irmscher, in: Akte des IV. Internat. Kongresses f. Griechische u. Lateinische Epigraphik, Wien 1964, 167ff.; zum Pariser Vorhaben J. Scheid, in: Bartolomeo Borghesi. Scienza e libertà. Colloquio intern. AIEGL, Bologna 1982, 337–353. – Methodische Fragen der Echtheitskritik schon bei S. Maffei, Artis criticae lapidariae quae exstant, Lucca 1765 (postum erschienen); ein ausführlicher Überblick zur Problematik bei di Stefano Manzella, Mestiere 195ff.; zu den Fälschungen Ligorios siehe grundlegend W. Henzen, in: Commentationes philologae in honorem Theodori Mommseni, Berlin 1877, 627–643; vgl. G. Vagenheim, Italia Medioevale e Umanistica 30, 1987, 199–309; H. Solin, in: R. Günther – St. Rebenich (ed.), E fontibus haurire, Paderborn al. 1994, 335–351; dens., in: Analecta epigraphica 1970–1997, Rom 1998, 242 (zum Fälscher Pratilli mit kaum berechtigter Kritik an Mommsens Methode); vgl. des weiteren S. Panciera, Un falsario del primo ottocento. Girolamo Asquini e l’epigrafia antica delle Venezie, Rom 1970; M. Mayer Olivé, L’art de la falsifició. Falsae inscriptiones |16|a l’epigrafia romana de Catalunya, Barcelona 1998; M. Buonocore, in: G. Angeli Bertinelli – A. Donati (ed.), Varia epigraphica. Atti del coll. int. di epigr. Bertonoro, 8–10 giugno 2000, Faenza 2001, 63–127. – Zu Fälschern und ihren Motiven: A. Grafton, Forgers and Critics: Creativity and Duplicity in Western Scholarship, Princeton 1990; A. Cooley (ed.), The Afterlife of Inscriptions. Reusing, Rediscovering, Reinventing and Revitalizing Ancient Inscriptions, London 2000. – Zur Textkritik vgl. M.L. West, Textual Criticism and Editorial Technique Applicable to Greek and Latin Texts, Stuttgart 1973; nützliche Einführung von J. Delz, in: F. Graf (ed.), Einleitung in die lateinische Philologie, Stuttgart – Leipzig 1997, 51–73.
Abb. 2: Ansicht einer Seite aus L.A. Muratori, Novus Thesaurus veterum inscriptionum I, Mailand 1739.