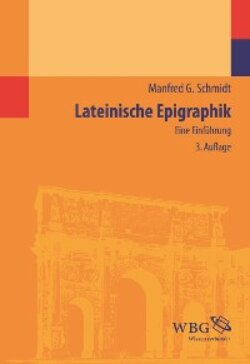Читать книгу Lateinische Epigraphik - Manfred G. Schmidt - Страница 14
4. Die Edition
ОглавлениеZiel epigraphischer Bemühungen ist in jedem Falle die Präsentation eines Textes, so weit wie möglich um Verlorenes ergänzt und von Fehlern bereinigt, mit Auflösung der häufig anzutreffenden und bisweilen regionaltypischen Abkürzungen (ein Verzeichnis häufiger Abkürzungen u. S. 122ff.) und unter Berücksichtigung des paläographischen und epigraphischen Gesamtbefundes (Schriftart, Ligaturen, Worttrenner, Apices, Sonderzeichen usw.; rasura und Wiederbeschriftung, Tilgung und Einfügung, Verschreibung, Auslassung usw.). Während in den älteren Editionen, im Muratori (s.o.) wie auch in den älteren Bänden des CIL, die Majuskel-Wiedergabe der Inschriften eine ‘Abbildung’ des epigraphischen Zeugnisses intendiert, den Benutzer aber hinsichtlich der Auflösungen von Abkürzungen oder der Ergänzung fehlender Textteile größtenteils im Stich läßt, ist in den meisten modernen Editionen – auch in den jüngeren Bänden des CIL – die Minuskelumschrift und die Verwendung eines diakritischen Zeichensystems nun Standard geworden.
Diakritische Zeichen
Die Edition inschriftlicher Texte bedarf einer besonderen Darstellungsform, die stärker differenziert, als es das überkommene Instrumentarium philologischer Textkritik vermag. Die in der Epigraphik verwendeten diakritischen Zeichen betreffen nicht nur Paläographie, Tradition und Textkritik, sondern berücksichtigen auch das Erscheinungsbild der häufig nur fragmentarisch erhaltenen oder anderweitig entstellten Inschriften (z.B. durch Wiederbeschriftung). Abweichungen vom sog. klassischen Latein sind in den Texten aus dem ganzen Mittelmeerraum, aus einer Zeitspanne von tausend Jahren römischer Kulturtradition und ihren Veränderungen, ganz selbstverständlich. Ungewöhnliche Abkürzungen und Schreibweisen, sprachliche Besonderheiten der Provinzen, Vulgarismen, orthographische und grammatikalische Fehler, auch bloße Versehen wie die Haplo- oder Dittographie (einmalige oder doppelte Schreibung von Buchstaben oder ganzen Wörtern), fordern eine eigene, epigraphische Darstellung: Der Herausgeber ist in seinem Bemühen um einen vollständigen und verständlichen Text zu klärenden Eingriffen gezwungen. Sie sind durch das folgende Zeichensystem kenntlich gemacht, dessen Standardisierung in Weiterentwicklung des sog. ‘Leidener Klammersystems’ als weitgehend abgeschlossen betrachtet werden kann (H. Krummrey – S. Panciera, Criteri di edizione e segni diacritici, in: Miscellanea, Rom 1980, 205–215; vgl. Suppl. It. 8, 1991, 10–21 und zuletzt CIL VI 8, fasc. 3 p. XXXI s.). Dennoch wird man auch in jüngeren Editionen immer wieder unterschiedliche diakritische Zeichen finden – etwa den Bogen über Buchstaben, die verbunden geschrieben sind, also in Ligatur stehen.
|24|Die diakritischen Zeichen (mit abc ist eine beliebige Buchstabenfolge bezeichnet):
| ab|c | Zeilentrenner |
| ab||c | Text außerhalb des Inschriftfeldes oder an versetzter Stelle |
| (vac.) | unbeschriftete Stelle (vacat) |
| a°1bc | Interpunktion (punctum, hedera = ein Blattmotiv als Trennzeichen) |
| âc; ì | verbunden geschriebene Buchstaben, z.B. Æ (ligatura); sog. I longa |
| abc(!) | antiker Fehler, Verschreibung, grammatikalische Unregelmäßigkeit |
| ạḅc̣ | unsichere, aus dem Kontext erschlossene Buchstaben |
| +++ | Reste unbestimmbarer Buchstaben (cruces); hier 3 Buchstaben |
| ------ | verlorener Teil, meist zu Beginn oder am Ende einer Inschrift |
| [---] | Lücke (drei Striche), ganze verlorene Zeile (sechs Striche) |
| [[abc]] | antike Tilgung des Textes (rasura) |
| «abc» | antiker Text auf eradiertem Feld (litura), Wiederbeschriftung |
| a‘bc’ | antike Einfügung |
| a(bc), (abc) | Auflösung von Abkürzungen, Erklärung von Sonderzeichen |
| abc(?), a(bc?) | unsichere Lesung, unsichere Auflösung einer Abkürzung |
| a[bc] | Ergänzung des Textes durch den Herausgeber |
| {abc} | Tilgung des Textes durch den Herausgeber, z.B. bei Dittographie |
| abc | von früheren Herausgebern gelesene, heute verlorene Buchstaben |
Schede
Im Idealfall setzt sich die ‘Schede’ (von scheda, “Papierstreifen”, bezeichnet also ursprünglich die Karte in einer Scheden-Kartei) einer Inschrift im ‘Corpus Inscriptionum Latinarum’ oder anderen, anspruchsvollen textkritischen Ausgaben aus folgenden Elementen zusammen (Erläuterungen häufiger lateinischer Termini der Editionen sind beigefügt):
1. Kopfzeile: Nach der laufenden Inschrift-Nummer der Edition folgt gelegentlich eine Konkordanz (meist in Klammern hintangesetzt). Sie weist auf frühere Publikationen derselben Inschrift im CIL oder auf andere Standard-Editionen hin – etwa die Sammlung Dessaus (ILS) oder Büchelers (CLE). Es folgt die Bestimmung der Inschriftenklasse, wie sie im folgenden Kapitel beschrieben sind: instrumentum publicum, titulus sacer, tit. operis publici, tit. honorarius, tit. sepulcralis, instr. domesticum, miliarium.
2. Präskript: Der Vorspann enthält insbesondere die präzise Beschreibung des Inschriftträgers.
Monumenttypus und Material werden bestimmt (z.B. tabula aenea, “Bronzetafel”), sodann der Erhaltungszustand dokumentiert (Glättungen, Beschädigungen, Brüche, Fragmentierung, weiterführende Hinweise zur Form, etwa Schmuckelemente, Rahmungen) – etwa stela ex lapide calcario |25|cymatio cincta, infra et supra a dextra fracta, “Stele aus Kalkstein mit Rahmung, unten und oben rechts gebrochen”. Es folgen die Maße (Reihenfolge: Höhe, Breite, Tiefe – wenn nicht vollständig erhalten, in Klammern), Angaben zu Schrift und Interpunktion – ebenfalls mit den Maßen. Fundjahr und Fundkontext werden kurz umrissen, Hinweise auf frühere Aufbewahrungsorte und Erhaltungszustände unter Angabe der Gewährsleute referiert, damit z.B. die Identifizierung der Inschrift in älteren Publikationen gewährleistet ist. Angaben, sofern sie nicht eigener Überprüfung am Original verdankt werden, sondern aus der handschriftlichen Tradition oder nach früheren Gewährsleuten erfolgen, werden namentlich gekennzeichnet. Angaben zur Aufbewahrung unter Angabe des Ortes und der Aufbewahrungsstätte (z.B. ein Museum, gegebenenfalls mit Inventar-Nummer) sollen dem Interessierten die Auffindung erleichtern.
Ein Autopsievermerk (z.B. descripsi, recognovi, contuli “ich habe (es) beschrieben, nochmals begutachtet, verglichen”) mit Angabe des Datums schließt die Beschreibung ab. Sofern das Original nicht verglichen werden konnte, wird auch dieses notiert (frustra quaesivi, non inveni, periit – “ich habe (es) vergeblich gesucht, nicht gefunden, es ist verschollen”).
3. Text (exemplum): Die Minuskelumschrift des exemplum, also des Textes, folgt der Anordnung des Originals oder verdeutlicht den Zeilenwechsel durch die oben gegebenen Zeichen des diakritischen Systems, das auch sonst bei Eingriffen in den Text beachtet wird. Bei einer Rekonstruktion der häufig fragmentarischen Texte wird nur sicher zu Ergänzendes in den Text aufgenommen bzw. Unsicheres gekennzeichnet – etwa durch ein vorangesetztes fuisse videtur (“es scheint (so) gewesen zu sein”). Weitergehende Mutmaßungen zu verlorenen Textpartien werden im textkritischen Apparat oder im Kommentar diskutiert (z.B. die Zuweisung einer Inschrift an eine bestimmte Person, die im Text nicht oder nur unvollständig genannt ist); Abkürzungen werden aufgelöst.
Wenn die vorgestellte Lesung einer Inschrift von einer früheren ganz erheblich abweicht, werden bisweilen beide exempla gegenübergestellt, um dem Leser einen bequemen Vergleich zu ermöglichen. In neueren Ausgaben finden sich regelmäßig Abbildungen zu den Texten.
4. Bibliographie: Die Bibliographie ist grundsätzlich chronologisch angeordnet. Abhängigkeiten von Autoren untereinander werden durch Formulierungen wie ex eo “nach diesem” oder inde “daher” bzw. durch Klammern kenntlich gemacht und erleichtern so die Beurteilung, wer von den Gelehrten wirklich den Text aus eigener Anschauung bietet. Bisweilen werden die älteren Gewährsleute zusammengefaßt als Antiquiores, vor allem dort, wo die Inschrift und ihr Träger noch in gutem Zustand und die früheren Lesungen obsolet geworden sind.
5. Paläographischer und textkritischer Apparat (apparatus criticus): Der paläographische Apparat enthält weiterführende Angaben zur Schriftform, etwa Hinweise auf apices, besondere Formen von hederae usw., dazu auch Bemerkungen zu eigentümlichen Schreibungen und Formen. Der textkritische Apparat enthält alle notwendigen Erklärungen zu den im Exemplum gegebenen Lesungen, Ergänzungen – auch zu verderbten Stellen, den cruces (= nicht bestimmbare Buchstaben), soweit sie gegeben werden können; darüber hinaus werden die Herkunft der gegebenen Ergänzungen |26|benannt, bisweilen die Texteingriffe oder Ergänzungen beurteilt (z.B. recte, “richtig”, minus apte, “weniger passend” oder sine idonea causa, “ohne geeigneten Grund”).
6. Kommentar und Datierung: Der Kommentar ist meist knapp gehalten; gleichwohl werden alle wesentlichen, mit der Inschrift verbundenen Probleme thematisiert. Insbesondere schließt er gewöhnlich mit einer Datierung der Inschrift und begründet diese – etwa mit einer Konsuldatierung, einer zeitlichen Einordnung nach der Kaisertitulatur, nach bekannten Persönlichkeiten usw. Ausführliche Beispiele finden sich hierzu bei Alföldy, CIL VI 8, fasc. 3.
Bibl. Hinweise
Zur epigraphischen Edition vgl. schon Mommsen, in: Harnack (ed.), Geschichte II 524ff.; Di Stefano Manzella, Mestiere 33ff. zur Scheda; 209ff. zur Transkription des Textes; Keppie, Roman Inscriptions 36ff. Zum diakritischen Zeichensystem vgl. H. Krummrey – S. Panciera, in: Miscellanea, Rom 1980, 205–215. Zu Neuauflagen im CIL vgl. G. Alföldy – M. Mayer – A.U. Stylow, in: CIL II2/14, 1 p. IX s. und A.U. Stylow, CIL II2/7, p. XVII–XX; zur Edition von Supplementen G. Alföldy, in: CIL VI 8, 3 p. XII–XIV; für die Planung zum Corpus insgesamt vgl. Schmidt,Corpus 32ff.