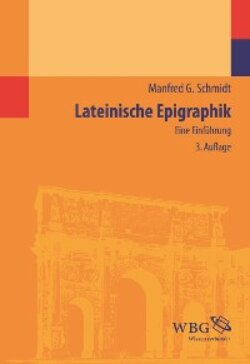Читать книгу Lateinische Epigraphik - Manfred G. Schmidt - Страница 13
3. Paläographie der lateinischen Inschriften
ОглавлениеDie Entwicklung der lateinischen Schrift auch nur skizzieren zu wollen, ist nicht Aufgabe einer Einführung in die Epigraphik, wiewohl die Paläographie hier ihren Anfang nimmt. Genauso wenig können linguistische oder philologische Probleme – der Orthographie, Lexik oder Grammatik – erörtert werden. Dennoch muß der epigraphisch Interessierte einen Begriff von den wichtigsten paläographischen Erscheinungen der lateinischen Schrift bekommen, von den verschiedenen Schriftarten, auch von der Genese einer Inschrift, d.h. von den Stadien vom Entwurf bis zur Realisierung. Nur auf diesem Fundament wird man die Lesung und Interpretation nachvollziehen, gegebenenfalls selbst z.B. eine inhaltliche oder zeitliche Zuweisung wagen können. Doch bemerkt Ernst Meyer gerade zur Datierung: “Lateinische Inschriften nach ihrer Schrift zu datieren, ist nicht möglich, jedenfalls nicht genauer als nach den groben Kriterien archaisch, republikanisch, kaiserzeitlich, |19|spätantik” (Meyer, Einführung 98). Man kann ihm durchaus zustimmen, wenn wir die fünf Alphabete der kaiserzeitlichen Monumentalschrift kaum unterschiedlichen Aussehens vergleichen, die Meyer (ebda. 39) dennoch verschiedenen Zeiten zuweist: Augusteisch, Zeit des Claudius und Nero, Flavische Zeit, Zeit Trajans und der Antonine, Severische Zeit. Doch wird im Einzelfall und unter Berücksichtigung der jeweiligen regionalen Entwicklung, unter Beachtung von Text und Kontext, eine differenziertere Einschätzung möglich sein (vgl. unten S. 105ff. zur Datierung sowie die folgenden Beispiele im Kap. IV Inschriftenklassen).
Republik
Das Alphabet der republikanischen Monumentalschrift mit seinen 21 Buchstaben (Cic. nat. 2, 93) erkennt man zum einen an der einfachen, groben Furche des Meißels, die den V-förmigen Keilschnitt noch nicht kennt, am oftmals noch unregelmäßigen Schriftbild mit breiten Buchstaben, an der nach oben weisenden, dreieckigen Interpunktion (in früher Zeit auch viereckige oder oblonge, also längliche) und den Besonderheiten einiger Buchstaben: Das spitzwinklige L der Frühzeit, das später zu einem genau rechtwinkligen mit langer Querhaste wird, das gleichschenklige, breite M (auch das der fünf Hasten, das Symbol für den Vornamen Manius), das offene P, anfangs noch nicht gerundet und dem griechischen Gamma ähnlich, das spitzwinklige S, erst später gerundet usw. Die meisten republikanischen Zeugnisse stammen jedoch aus den beiden letzten vorchristlichen Jahrhunderten und haben nicht mehr den archaischen Charakter der frühen Buchstabenformen, wie sie etwa der lapis Satricanus zeigt (Abb. 9). Sie sind im Vergleich nicht sehr häufig, zudem in ihrer Hauptmasse auf Rom und Italien beschränkt: Von etwa 3.900 lateinischen Inschriften der Zeit vor Caesars Tod sind ca. 3.200 aus den letzten beiden Jahrhunderten v. Chr., vgl. die chronologisch und geographisch differenzierende Tabelle bei R. Gordon, IRS 93, 2003, 219. Gemessen an den weit mehr als 300.000 Inschriften der Kaiserzeit (nicht gerechnet Sonderfälle des Instrumentum wie die Ziegelstempel aus Germanien oder die Amphoreninschriften des Monte Testaccio, s. unten S. 79f.; zur geschätzten Gesamtzahl vgl. G. Alföldy, in: XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina (Roma, 18–24 sett. 1997). Atti, Rom 1999, I 90) wird man republikanischen oder gar archaischen Inschriften nur selten begegnen.
Kaiserzeit
Die gleichmäßige, wohlproportionierte Scriptura capitalis quadrata – in den besten Exemplaren von geradezu geometrisch genauer Konstruktion (W. Ohlsen, Monumentalschrift, Monument, Mass. Proportionierung des Inschriftenalphabets und des Sockels der Trajanssäule in Rom, Hamburg 1981) – ist in ihrer vollendeten Form eine Schöpfung der Augusteischen Zeit. Sie bleibt bis in die Spätantike die vorzugsweise für größere Bauten verwendete Schrift und wird heute am ehesten mit römischen Kulturdenkmälern in Zusammenhang gebracht (z.B. das Pantheon in Rom). Der Buchstabenbestand des Alphabets ist auch in der Kaiserzeit unverändert. Lediglich unter Kaiser Claudius treten einige wenige Zeichen hinzu – am bekanntesten das Digamma () zur Bezeichnung eines Lautwertes zwischen V und W. So liest man auf den Terminus-Inschriften der Stadt Rom aus Claudischer Zeit (CIL VI 40852; vgl. S. 64): POMERIVM AMPLIA IT TERMINA TQ° (“hat das Pomerium erweitert und abgegrenzt”). Sie werden in der Folgezeit nicht weiter verwendet.
|20|Interpunktion und Sonderzeichen
Die lateinische Schrift der Monumente ist grundsätzlich eine Versalienschrift (Großbuchstaben), fortlaufend und oft ohne Spatien zwischen den Wörtern geschrieben, nicht immer Rücksicht nehmend auf das Zeilenende, aber in der Regel durch Interpunktionszeichen auf mittlerer Buchstabenhöhe gegliedert, wobei deren Funktion variiert: Mal nur als Schmuckelement verwendet, dann Silben, Wörter, oder Sätze/Verse scheidend oder den Text in Abschnitte gliedernd, sind auch die Formen dieser Interpunktionszeichen ganz unterschiedlich: vom einfachen, runden Punkt hin zum bekanntesten Zeichen, dem kleinen Dreieck (punctum triangulare), dem in der Kaiserzeit häufiger werdenden Blattmotiv (hedera distinguens) in vielfältigen Formen wie kleinen Zweigen (virgulae), herzförmigen Blättern oder Palmruten (palmae), auch stilisierten Trauben u.ä. Überdies finden sich in manchen Zeugnissen der kommaförmige sicilicus zur Kennzeichnung der geminatio, d.h. der Verdoppelung eines Konsonanten, der apex, ein ebenfalls kommaförmiger Schrägstrich über dem Vokal zur Kennzeichnung langer Silben (vgl. Quint. inst. 1, 7, 2), und wesentlich häufiger: die I longa für prosodisch langes I, die jedoch nicht selten als Schmuckelement verwendet wird wie z.B. in der Kaisertitulatur bei der Initialen von IMP = Imp(erator).
Zahlzeichen
Überstreichungen verdeutlichen den Gebrauch von Abkürzungen (z.B. für noster, “unser”) oder Zahlzeichen – z.B. das Zeichen für decem, also zehn, ursprünglich die aus dem griech. Alphabet übernommene Aspirate X (Chi), die im lat. Alphabet zum Zahlzeichen wurde. Ebenso hat sich aus der Aspiraten ψ (Psi) das Zeichen ↧ für den Zahlwert 50 entwickelt (später das geläufige L), oder die griech. Aspirate Φ (Phi) für 1000 (neben M = mille), als Zahlzeichen geschrieben. Sie haben, meist durch Vervielfältigung oder Halbierung eines bestehenden Zeichens, einige Sonderformen entwickelt, die über das hinausgehen, was heutzutage noch als römische Zahlen bekannt ist: So wurde aus dem Zahlzeichen (ursprünglich Φ) für 1000 ein ‘halbes’ Zeichen D oder Ð für 500 gebildet, des weiteren durch Einfügung zusätzlicher Kreise oder Halbkreise größere Zahlen wie etwa oder für 10.000, entsprechend z.B. für 100.000. Daneben entwickelte sich schon früh die Notierung von Tausendern der einfachen Zahlzeichen durch Überstreichung, also für 5.000 oder für 100.000, der Hundertausender durch Strich-Markierung an drei Seiten wie für 500.000. In den Zusammenhang der Zahlzeichen gehören auch die ‘durchgestrichenen’ Münzzeichen mit horizontaler Mittelhaste, denn sie gehen auf diese zurück: so X (das Zahlzeichen für 10) für den Denar, denarius (“Zehner”, d.h. 10 Asse), und für den Sesterz, sestertius (IIS = semis-tertius = “der Dritte halb”, d.h. 2 1/2 Asse). Aus technischen Gründen werden hier nicht alle Zahlzeichen, auch nicht alle Sonderzeichen, wiedergegeben; ein umfänglicher Katalog z.B. bei Calabi Limentani, Epigrafia latina 128; ausführlicher Hübner, Exempla LXX s. zu den Numeralia; zu Sonderzeichen wie z.B. Ͻ L° = mulieris liberta/us (d. h. die oder der Freigelassene einer Frau), oder das sog. Theta nigrum θ für den Verstorbenen, das durchgestrichene für obiit oder obitus (“verstorben”) u. v. m. vgl. ebenfalls Hübner, ebda. LXXII s.
Ligaturen
Generell läßt sich bei Erscheinungen der Schriftentwicklung feststellen, daß hypertrophe Bildungen eher einer späteren Zeit angehören. Auch die |21|Ligaturen, d.h. die Verbindung von Buchstaben, die zunächst einer unpassenden Aufteilung des Textes geschuldet sind und darum häufig am Schluß einer Zeile zwei oder mehrere Buchstaben aus Platzgründen zusammenfassen, haben vor allem in spätantiken Inschriften ein ornamentales Eigenleben entwickelt, bis hin zum Monogramm – also der Schreibung ganzer Namen in einer Buchstabenkombination. Gerade bei Inschriften auf sehr persönlichen Gegenständen wie geschnittenen Schmucksteinen/Gemmen (gemmae) oder den in Senatorenkreisen so beliebten Elfenbeindiptycha, die zu Neujahr verschenkt wurden, ist vorauszusetzen, daß der Besitzer solche Monogrammata ohne Schwierigkeiten aufzulösen wußte. Aber auch schon früher begegnen durch Ligatur von Buchstaben gebildete Symbola wie die für dies nefastus im römischen Kalender gebräuchliche Ligatur (Abb. 4), oder der bekannte Wahlaufruf, wie er sich an vielen Wänden Pompejis findet: o(ro) v(os) f(aciatis) … (“Bitte wählt …”; vgl. Abb. 26). Ansonsten finden sich allerlei Kombinationsmöglichkeiten – wie z.B. der ‘eingeschriebene’ Buchstabe (auch Enklave genannt), etwa bei der Filiation C(ai) f(ilius) , die Ligatur der drei Anfangsbuchstaben im abgekürzten Kaisernamen Imp(erator) , wobei das I durch Verlängerung nach oben angedeutet wird, oder die häufige Ligatur der Genitivendung in den Nomina der ersten Deklination, wie sie auch in der oben gezeigten, modernen Fassung imitiert wurde (Abb. 1).
Schriftarten
Die unten abgebildeten Alphabete zeigen die schrittweise Annäherung der Scriptura capitalis quadrata an die Scriptura actuaria (auch libraria genannt), die sowohl bei gemalten wie bei gemeißelten Inschriften verwendet wurde – und zwar durchaus auch auf ‘ offiziellen’, repräsentativen Monumenten. Dies soll freilich keine zeitliche Entwicklung suggerieren, denn beide Schriftarten waren zur selben Zeit in Gebrauch. Vielmehr verdeutlichen die beispielhaft gewählten Alphabete die möglichen Abstufungen der Capitalis hin zur Actuaria. Deren Buchstabenformen imitieren mit breiter Horizontal- und dünner Vertikallinie den Pinselstrich (vgl. Abb. 26) und streben ein elegantes, ornamentales Schriftbild an, das bisweilen der Vertikalen so sehr den Vorzug vor der Horizontalen gibt, daß die einzelnen Buchstaben an ihren kurzen Querhasten nur noch schwer zu erkennen sind (litterae oblongae). Die Scriptura vulgaris oder cursiva (eine moderne Bezeichnung, nach dem stilus currens, dem “eilenden Schreibgriffel” gebildet) ist die Schrift der schnellen Notiz, der privaten Post und des Geschäftsdokuments. Da sie nicht von professionellen Steinmetzen geübt wird, sondern auf Häuserwänden, Papyri, Holz- und Wachstafeln, auch im noch ungebrannten Ton von Bechern und Gefäßen der individuellen Handschrift des Schreibers folgt, läßt sich ein ‘idealtypisches’ Alphabet dieser Schrift kaum gewinnen. Sie wird daher im Zusammenhang mit jenen Dokumenten vorgestellt, für die sie bestimmend geworden ist (S. 74f. u. 77 m. Abb. 27). Seltener sind Exemplare der erst in der späteren Kaiserzeit begegnenden Scriptura uncialis mit ihren gerundeten Buchstaben dann den Buchstaben λ (A) und (D), die eine bis weit ins Mittelalter reichende Schrifttradition begründet hat. Selbst auf einem Ehrenmonument begegnet diese Schrift, allerdings in der Provinz Syria Phoenice, wo Tyrus, die Heimatstadt des Juristen Ulpian, ihrem berühmten Sohn ein Monument gesetzt hatte (Foto des Abklatsches in AE 1988, 1051).
|22|Abb. 3: Von der Capitalis quadrata zur Actuaria. Für die Schreibung griechischer Namen und Begriffe finden sich auch Y und Z in lateinischen Inschriften, während die griechischen Aspiraten Phi, Chi und Psi für die Darstellung von Zahlen im lateinischen System modifiziert wurden. – Zur Form des Κ vgl. unten Abb. 33 (Z. 6).
Ordinare et sculpere
Bei einer in Stein gehauenen, professionell bearbeiteten Inschrift werden im wesentlichen zwei Schritte unterschieden: Die schriftliche Vorlage für die Arbeit, nicht selten in Scriptura cursiva geschrieben und so schon eine erste Fehlerquelle für die buchstabengetreue Realisierung, wird vom Steinmetz zunächst in eine ordinatio tituli auf dem Stein überführt, also eine feinlinige Skizzierung der Anordnung des Textes und der Buchstaben. Erst dann erfolgte die eigentliche Steinmetzarbeit, das sculpere, die wiederum Fehler verursachen konnte – zumal Doppelschreibungen (Dittographie) oder Auslassungen (Haplographie). Beide Phasen werden auch in einer berühmten Werbeinschrift aus Palermo unterschieden, wo in griechischer und lateinischer Sprache verkündet wird: tituli heic ordinantur et sculpuntur … “Hier werden Inschriften entworfen und gemeißelt …” (CIL X 7296 cf. Index ad n.). Nachdem der Stein also geglättet worden war, konnte eine Vorzeichnung die Aufteilung des Textes vorgeben und den lapicida vor einer Schwierigkeit bewahren: Daß das einmal begonnene Werk eventuell nicht genügend Platz für den verbleibenden Text lassen könnte. So mußte etwa bei einer Grabinschrift aus Segovia/Spanien das Inschriftfeld, eine tabula ansata, nach rechts erweitert werden, um den Namen des Errichters noch zu fassen (CIL II 2747 cf. p. 926; Foto bei Knapp, Latin Inscriptions n. 255). Spuren der ordinatio finden sich noch heute auf den Steinen – meist als Führungslinien, die die Zeilen unten und oben begrenzen.
Bibl. Hinweise
Zur lateinischen Paläographie allgemein vgl. das Standardwerk von B. Bischoff, Paläographie der römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters, Berlin 19862; speziell zur epigraphischen Überlieferung s. Mallon, Paléographie, und die Sammlung von Hübner, Exempla – diese erstellt auf der Grundlage der Abklatschsammlung des CIL (Berlin); vgl. zudem Gordon, Paleography; aktuelle Zusammenfassung der Forschung zum römischen Schriftwesen (auch der literarischen Überlieferung) von M. Steinmann, in: F. Graf (ed.), Einleitung in die lateinische Philologie, Stuttgart – Leipzig 1997, 74ff. Weiteres zur Paläographie im Guide n. 1250ff. – Die Interpunktion und ihre Zeichen bei E.O. Wingo, Latin Punctuation in the Classical Age, The Hague – Paris 1972; Abkürzungen und Kontraktionen in lateinischen Inschriften: U. Hälvä-Nyberg, Die Kontraktionen auf den lateinischen Inschriften Roms und Afrikas bis zum 8. Jh. n. Chr., Helsinki 1988; vgl. A.E. Gordon, Supralineate Abbreviations in Latin Inscriptions, repr. Mailand 1976; zu den notae numeralium B.E. Thomasson, OR 3, 1961, 169–178; zu apex und sicilicus R.P. Oliver, AJPh 87, 1966, 129–170; Münzbezeichnungen auf Inschriften: |23|S. Mrozek, Eos 57, 1967/68, 288–295. – Zur antiken Technik des Steinmetzen, zur Terminologie (lapidariusi/quadratarius) und den verschiedenen Phasen der Arbeit vom Entwurf bis zur Realisierung vgl. Hübner, Exempla 29ff.; di Stefano Manzella, Mestiere 51ff.; Susini, Roman Stonecutter, bes. 9ff.; zusammenfassend Keppie, Roman Inscriptions 12ff.