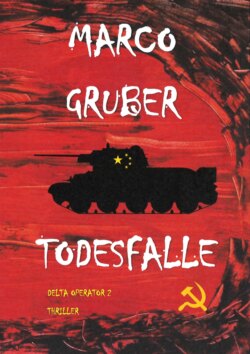Читать книгу Todesfalle - Marco Gruber - Страница 9
5. Kapitel
ОглавлениеPanzerkreuzer Prinz Eugen
Nordsee
04. Mai 1934
„Sofort Feuer einstellen, verdammt noch mal!“, brüllte Hohenstein wütend, dann presste sie das Fernglas an ihre Augen und starrte ins Zielgebiet.
Da war es wieder, dieses Blinken.
Es hob sich sanft auf und ab, folgte der kabbeligen Dünung der Nordsee. Wieder blinkte es, dann stob Gischt und Wasser auf, als die Granaten direkt in ihrem Sichtfeld einschlugen. Das Blinken verschwand im Gischtnebel. Hohenstein konnte es nun auch nicht mehr ausmachen. Ihr Herz schlug schneller und ihre Gedanken rasten. Hatte sie womöglich ein Fischerboot versenkt, oder noch schlimmer, ein größeres Schiff auf den Grund des Meeres geschickt? Hatte sie es fertiggebracht, in diesen sehr angespannten Zeiten vielleicht sogar eine internationale Krise auszulösen? Nicht auszudenken, wenn sie hier und jetzt einen Krieg ausgelöst hatte. Was sie mit ihrer Karriere anstellen konnte, wenn dem so war, war an zwei Fingern auszurechnen.
Was war ihr passiert, ihr, die ausgeschickt worden war, um dieses alte Schlachtross mit dem glorreichen Namen Prinz Eugen wieder auf Vordermann zu bringen? Sie musste sich zusammenreißen und die Fäden, die ihr kurzzeitig zu entgleiten drohten, wieder fest in die Hand nehmen.
Rasch entfernte sie die Watte aus ihren Ohren und ließ sie unbewusst in der Tasche ihrer Uniformjacke verschwinden.
„Wenn auch nur ein einziges Geschütz nochmal feuert, lass ich den Verantwortlichen kielholen“, knurrte sie ihrem Ersten Offizier zu, dann befahl sie laut:
„Gefechtsstationen auflösen, neuer Kurs: 0-3-0, Geschwindigkeit: Äußerste Kraft voraus!“
„Frau Kapitän, was haben Sie vor?“, fragte der IO ratlos.
„Das führt uns ins Zielgebiet.“ Zornig wandte Hohenstein sich an den wesentlich älteren Mann, der einen halben Kopf größer war als sie.
„So wie die Geschützbedienungen gezielt haben, ist die halbe verdammte Nordsee das Zielgebiet!“, zischte sie böse.
„Erstens hat es ewig gedauert, bis überhaupt gefeuert wurde, dann lag die erste Salve völlig verstreut über dem Ziel, was noch verständlich wäre. Doch auch die folgenden Salven lagen komplett durcheinander und überhaupt nicht koordiniert. Wenn wir es hier mit einem sowjetischen Zerstörer zu tun gehabt hätten, dann würden wir jetzt beide Wasser treten, verstanden?“
Sie hatte sich gefährlich nahe an Mühlmann heran geschoben und roch dessen alten, abgestandenen Schweiß.
„Und bis die Flak endlich gefechtsbereit war, hätte uns das feindliche Flugzeug zweimal bombardieren können. Von einer Torpedierung durch das U-Boot ganz zu schweigen, als sie diesen lahmen Zickzackkurs laut Lehrbuch befahlen. Der Feind kennt unsere Standardmanöver und hätte dementsprechend reagiert!“
Mühsam gelang es Hohenstein, ihren Ärger zu verdrängen und sich wieder auf das zu konzentrieren, was vor ihr lag.
„Mühlmann, lassen Sie die Ausgucks dreifach besetzen und schicken Sie die schärfsten Augen raus, die wir haben“, befahl sie.
„Ich habe Blinksignale im Zielgebiet gesehen, kurz bevor die letzte Salve einschlug“, gab sie etwas leiser zu.
„Mein Gott!“, entfuhr es einem leichenblassen Mühlmann.
„Hoffen wir, dass die Geschütze ihre miserable Treffgenauigkeit beibehalten haben“, schloss Hohenstein müde. Dann wandte sie sich von Mühlmann ab und spähte wieder durch das Fernglas in die dunkle Nacht hinaus.
„Machen Sie wenigstens das richtig, Mühlmann!“, schloss sie mürrisch, während sie nach dem Blinken suchte, es aber nicht wiederfinden konnte.
Fünfundzwanzig Minuten später schaukelte der schwere Panzerkreuzer auf dem unruhigen Wasser der Nordsee, während das hilfreiche Mondlicht hinter aufgezogenen Wolken verschwunden war. Der Wind hatte aufgefrischt und die Dünung lag nun höher. Das Schiff machte kleine Fahrt und dampfte kreuz und quer durch das kleine Seegebiet, in dem Korvettenkapitän Hohenstein das Blinklicht gesehen hatte. Zu allem Überfluss zogen nun Nebelschwaden auf, die die Sicht verkürzten und die Suche nach irgendwelchen Anzeichen einer möglichen Versenkung noch schwieriger machten. Zahlreiche Lampen, die an den Relings überall auf dem Schiff verteilt aufgehängt worden waren, versuchten mit ihrem schwachen Licht die Oberfläche des nahen Wassers zu erhellen.
Hohenstein stand nun persönlich ganz vorne am aufragenden Bug des Kreuzers, beobachtete, wie das Schiff die Wellen schnittig teilte, und suchte methodisch das schwarze Wasser vor sich ab. Sämtliche Ausguckposten waren doppelt und dreifach besetzt. Man hatte zusätzliche Ferngläser aus dem Magazin kommen lassen, die, da nun der Mond wieder verschwunden war, den Suchenden nicht sonderlich viel nützten. Auf der Brücke hatte der IO Mühlmann das Kommando inne und wartete auf weitere Anweisungen.
„Kontakt!“, rief ein Ausguck von den steuerbordseitigen mittleren Aufbauten.
„Unbekanntes Treibgut an Steuerbord querab, Entfernung etwa einhundert Meter!“, brüllte der junge Mann. Hohenstein spurtete zurück zum Kommandoturm der Prinz Eugen, öffnete das Schott und betätigte die erste Sprechanlage, die sie erreichte.
„Hier spricht der Kommandant. Maschinen Stopp! Beiboot zu Wasser lassen. Entermannschaft antreten!“
Sie hängte das Mikrophon wieder auf die Gabel und verließ den Kommandoturm, rannte hinaus aufs feuchte Deck. Dort überwachte sie, wie wenig später eines der hölzernen Beiboote mit dem befohlenen Enterkommando zu Wasser gelassen wurde. Das kleine Boot schaukelte wie eine Nussschale auf den immer rauer werdenden Wellen und stieß sich mühsam vom Stahlrumpf des Panzerkreuzers ab. Kraftvoll tauchten die Ruder ins schwarze Wasser, die Männer pullten lautstark unter dem Befehl eines erfahrenen Bootsmannes. Zwei Mann des Kommandos hatten tragbare Lampen mit an Bord genommen und versuchten nun damit, das Wasser vor dem schmalen Bug des Holzbootes zu beleuchten. Über ein klobiges Funkgerät standen sie im Kontakt mit dem Ausguck, der sie dorthin dirigierte, wo er etwas gesehen zu haben glaubte. Immer weiter entfernte sich das Beiboot von der Prinz Eugen und immer angespannter folgten ihm die Blicke der zurückgebliebenen Besatzungsmitglieder. Schließlich, es schien schon eine Ewigkeit zu dauern, rief der Bootsmann an Bord des Beiboots lautstark und deutete wild gestikulierend nach steuerbord. Die Ruderer drehten das Boot mit kräftigen Schlägen und brachten es auf den neuen Kurs. Der Bootsmann hantierte mit einem Bootshaken am Bug des kleinen Schiffes und stocherte auf der Wasseroberfläche herum. Plötzlich verlor er den Halt, rutschte aus und drohte, ins kalte Wasser zu stürzen. Doch mehrere starke Arme griffen nach ihm und hielten ihn fest, sodass er taumelnd stehend blieb und den Bootshaken einholen konnte. Hohenstein sah, wie er etwas losmachte, das er aus dem Wasser gefischt hatte. Dann machte das Boot kehrt und näherte sich wieder dem Panzerkreuzer. Man warf Leinen aus und hievte das kleine Boot wieder an Bord. Sofort war Hohenstein am Boot und verlangte zu sehen, was der Bootsmann aus dem Wasser gezogen hatte.
„Was haben Sie, Slupitzki?“, wollte sie wissen, woraufhin der Bootsmann sich am kahlen Kopf kratzte und ihr das Ding hinhielt, das er aus der rauen Nordsee gezogen hatte.
„Keine Ahnung, was das sein tut, Frau Kapitänin“, antwortete der alte Seebär.
„Sowas hab ich in meim ganzen Lebn nicht gesehn!“
Hohenstein betrachtete das Treibgut, berührte es und versuchte es einzuordnen, hatte aber keine Ahnung, was es war. Sie hielt einen etwa eineinhalb Meter langen und etwa einen halben Meter breiten Streifen eines leuchtend orangen Materials in ihren Händen. Die Ränder des Materials, das sich wie Gummi anfühlte, aber eher etwas folienartig erschien, waren gezackt ausgefranst. Einzelne Fasern dieser Folie hingen mehrere Zentimeter über die Abrisskante hinaus. Als sie sie berührte, fühlten sie sich trocken an, obwohl sie eben noch im Wasser gelegen hatten. Die gesamte Folie war auch völlig trocken. Wassertropfen des einsetzenden Regens, die die Oberfläche des Materials benetzten, perlten rückstandslos ab und fielen auf die alten Holzplanken des verwitterten Decks.
„Da tut was gschriebn stehn!“, rief der Bootsmann Slupitzki und deutete auf die Rückseite der Folie. Rasch drehte Hohenstein das Fragment um und entdeckte tatsächlich matte schwarze Zeichen, die auf dem Orange zu sehen waren. Sie erkannte die Buchstabenfolge RES, dann noch einen Teil eines vierten Buchstaben, vielleicht ein O oder ein C, dann riss die Abrisskante das Wort entzwei. Direkt darüber waren merkwürdige Zeichen zu erkennen, die Hohenstein nicht zu entziffern vermochte.
„Das gehört den Russn, sapperlot!“, rief Slupitzki aus.
„Wir hamm an Russn versenkt!“
Ein Raunen durchlief die anwesenden Männer, und Slupitzki schien drauf und dran, noch mehr Unsinn auf seine unnachahmliche Art und Weise zu verbreiten.
„Halten Sie den Mund, Bootsmann!“, mahnte Hohenstein ihn ruhig ab.
„Das sind keine kyrillischen Buchstaben“, stellte sie nüchtern fest.
„Wenn ich mich nicht irre, dann handelt es sich hierbei um eine asiatische oder arabische Schrift. Vielleicht Persisch oder auch Chinesisch.“
„Was sollte ein chinesisches oder persisches Schiff hier in der Nordsee verloren haben?“, fragte ein anderer Unteroffizier. Die Antwort blieb man ihm schuldig, da sich ein Ausguck, diesmal von Backbord, lautstark meldete.
„Kontaaakt, Kontaaakt!“, brüllte der junge Mann. Hohenstein drückte die orange Gummifolie dem Seemann in die Hand, der ihr am nächsten stand.
„Bringen Sie das unverzüglich in meine Kajüte!“, befahl sie, dann lief sie den anderen folgend über das rutschige Deck auf die Backbordseite des Schiffs. Zuvor hatte sie Slupitzki erneut befohlen, das Beiboot zu wassern. Es dauerte einige Minuten, bis das kleine Boot den Bug des Panzerkreuzers umrundet hatte und sich schließlich weiter entfernte, um die neue Sichtung zu untersuchen. Slupitzki und die Entermannschaft verschwanden schließlich aus dem in der Dunkelheit überschaubaren Nahbereich des Schiffes, weshalb Hohenstein der Brücke befahl, dem Beiboot behutsam zu folgen. Immer wieder tauchte der Umriss des Bootes, verschleiert durch Regen und Nebel, im diffusen Licht der Lampen auf, dann verschwand es wieder in einem Wellental. Die Anspannung an Bord der Prinz Eugen wuchs mit jedem Augenblick und war beinahe physisch greifbar.
Minute um Minute verstrich, ohne dass das Beiboot Anstalten machte, zum Mutterschiff zurückzukehren. Dann, nach einer schieren Ewigkeit, tauchte der weiße Rumpf des Bootes wieder im Lichtkegel der Lampen auf. Bootsmann Slupitzki, der aufrecht am Bug des schaukelnden Bootes stand, fuchtelte aufgeregt mit den Armen. Als das Boot noch näher kam, konnte man erkennen, dass es etwas im Schlepptau hatte, das dieselbe orange Farbe hatte, wie der zuvor gefundene Fetzen. Nur war dieses unförmige Ding, so erkannte Korvettenkapitän Hohenstein nun, als das Boot bereits sehr nahe am Rumpf der Prinz Eugen war, viel größer. Nun konnte sie auch das Brüllen hören, die lautstarke Stimme des Bootsmannes Erwin Slupitzki, der, die Hände zu Trichtern geformt an den Mund haltend, zum Panzerkreuzer herüber schrie.
„Aufgepasst, miteinander!“, konnte sie verstehen und dann:
„Da ist noch einer drinnen!“
Kaltes Nordseewasser klatschte auf das hölzerne Deck und umspülte ihre Knöchel, als das Beiboot wieder an Bord gehievt und festgemacht wurde. Augenblicklich war Hohenstein ganz vorne im neugierigen Pulk der Matrosen, die das Boot umringten. Während sie versuchte, das Durcheinander, das unter den Männern des Enterkommandos herrschte, zu durchblicken, bemerkte sie aus den Augenwinkeln das große orange Gebilde, das die Matrosen soeben über die Reling an Deck zogen. Kurz sah sie hinüber und stellte fest, dass dieses futuristisch aussehende Ungetüm ohne Zweifel aus demselben Material gefertigt worden war, wie das Bruchstück, welches sie zuvor aus dem Meer aufgelesen hatten. Doch als sie wieder ins Beiboot sah, vergaß sie augenblicklich das orange Objekt unbekannter Herkunft. Da war Blut im Wasser und auf den weißen Planken des Beibootes, erkannte Hohenstein zunehmend beunruhigt. Der Bootsmann Slupitzki und zwei weitere Seemänner beugten sich über ein schwarzes Etwas und hantierten lautstark maulend und gestikulierend an dem Körper – so viel glaubte Hohenstein nun zu erkennen – herum.
„Meldung, Bootsmann!“, brüllte sie gegen den Lärm des Windes und des mittlerweile peitschenden Regens an. Slupitzki drehte sich zur Seite und auf Hohenstein zu, sodass sie sehen konnte, dass er den Kopf der Person vorsichtig in seinem Schoß gebettet hatte. Das Gesicht konnte man nicht erkennen, da lange schwarze Haare es teilweise verdeckten. Oberkörper und Beine waren in schwarze, enge Kleidung gehüllt, nur ein schwarzer Stiefel war am linken Fuß zu erkennen, der rechte Fuß war nackt.
„Den Arzt, Frau Kapitänin, schnell!“, brüllte Slupitzki. Dann sah sie das Blut an Slupitzkis Händen und ihr Atem stockte.
„Den hats ordentlich erwischt, glaub ich“, ergänzte der Bootsmann mit besorgter Miene. Korvettenkapitän Anna Maria Hohenstein wischte sich das Wasser des kalten Regens aus den Augen, drehte sich um und brüllte ihre Befehle.
„Sie!“, Hohenstein zeigte auf einen Unteroffizier, „laufen Sie sofort ins Krankenrevier und teilen sie Dr. Schrammel mit, dass er sich auf die Ankunft eines Schwerverwundeten vorbereiten soll!“
Der Mann salutierte und hastete davon, verschwand durch eine Luke ins helle Innere des schweren Schiffes.
„Slupitzki, Sie sind mir dafür verantwortlich, dass der Verletzte in einem Stück beim Doktor ankommt. Teilen Sie Männer ein, die das Beiboot sichern und lassen Sie klar Schiff machen. Der Sturm sieht ungemütlich aus und ich will nicht, dass mir irgendwas um die Ohren fliegt. Das da…“, Hohenstein zeigte auf das zusammengesunken auf den Planken liegende orange Gebilde, „das bringen Sie unter Deck in einen Lagerraum. Lassen Sie Posten davor aufstellen und niemandem, absolut niemandem darf ohne meine Erlaubnis Zutritt gewährt werden.“
„Jawohl, Frau Kapitänin“, antwortete Slupitzki, der die korrekte Anrede wohl nie mehr lernen würde, dann erteilte er seine eigenen Befehle an die umstehenden Seemänner. Das mit der förmlichen Anrede war aber Hohensteins geringstes Problem, als sie durchs selbe Schott ins Schiffsinnere schlüpfte, wie der Unteroffizier vor ihr. Sie griff nach dem Hörer der Meldeanlage an der Stahlwand neben dem Schott und brüllte ins Mikrophon:
„Brücke, hier Kommandant. IO, Sie haben weiterhin das Kommando. Sofort Kurs zurück zur Basis Wilhelmshaven setzen. Geben Sie die Meldung durch, dass wir zurückkommen. Genaueres dann später. Ich bin auf dem Krankenrevier, falls Sie mich brauchen. Ende.“
Sie wartete auf die Bestätigung des Befehles, dann marschierte sie mit großen Schritten weiter ins Innere des alten Panzerkreuzers. Ihr Ziel lag zwei Decks tiefer und sie übermannte ein dunkles Gefühl, als sie sich fragte, was sie auf der Krankenstation wohl erwarten würde. Trotzdem beschleunigte sie ihre Schritte und verschwand im Bauch der Prinz Eugen. Als sie sich Augenblicke später der kleinen Krankenstation des Panzerkreuzers näherte, konnte sie die laute, befehlsgewohnte Stimme des Bordarztes schon hören, bevor sie das Schott zur Station überhaupt erreicht hatte.
Sie schlüpfte durch die offenstehende Stahltür vom Gang ins Innere und wäre um ein Haar mit drei Matrosen zusammengestoßen, die der Arzt soeben lautstark nach draußen gescheucht hatte.
„Jeder, der nicht zum medizinischen Stab gehört, verlässt sofort den Raum!“, rief Dr. Albert Schrammel erneut. Der große, etwas schmal geratene Mediziner, dessen schütteres, blondes Haar an den Schläfen bereits schlohweiß war, beugte sich über den dunkel gekleideten Verwundeten, der vor ihm im grellen Licht einer großen Deckenleuchte auf dem Untersuchungstisch lag. Er schaute in die Augen des Mannes, untersuchte die Pupillen und erkannte, dass sein Patient zwar bewusstlos, aber immerhin noch am Leben war. Zwei Krankenschwestern in weißen Kitteln mit ebenso weißen Kopftüchern waren emsig damit beschäftigt, kleine Rolltischchen mit Instrumenten an den Untersuchungstisch heran zu schieben. Ein zweiter Mann, Sanitätsgefreiter Werner Hübner, unterstützte den Arzt bei der Untersuchung des Verwundeten.
„Was haben wir hier?“, fragte er die Kommandantin, die seinem direkten Blick nicht auswich, obwohl sie das Bedürfnis dazu stark spürte.
„Ein Schiffbrüchiger“, antwortete sie kurz.
„Er war mitten im Zentrum unserer Gefechtsübung und könnte durch unsere Granaten getroffen worden sein“, ergänzte sie widerwillig und mit leiser Stimme. Der Schiffsarzt nickte und wandte sich wieder seinem Patienten zu.
„Wir müssen ihn schnell aus der nassen Kleidung holen“, sagte Dr. Schrammel zu dem Sanitätsgefreiten.
„Schwester, Schere!“, befahl er lautstark. Während Hübner langsam die Hose des Verwundeten zerschnitt, um diese schließlich zu entfernen, betastete der Arzt den Oberkörper, um die Ursache der Blutung zu finden.
„Frau Kapitän, würden Sie sich bitte im Hintergrund halten?“, brummte Schrammel, ohne Hohenstein anzusehen. Er war nun voll darauf konzentriert, die Verletzung zu finden und das Entkleiden des Patienten zu überwachen.
„Na los, Hübner, schneiden Sie den verdammten Stiefel einfach der Länge nach auf!“, befahl er, als er merkte, dass der Sanitätsgefreite zwar die Hose schon aufgeschlitzt hatte, aber beim Erreichen des einzelnen Stiefels nicht so recht weiter zu wissen schien. Aha, dachte Dr. Schrammel, als er den linken Rippenbogen des Patienten abtastete und dabei die Verwundung entdeckte.
„Hier!“, befahl der Arzt und zeigte auf die Stelle an der Brust des Mannes, etwa eine Handbreit unterhalb des Brustmuskels, „Sofort den Stoff aufschneiden und die Stelle freilegen!“ Während der junge Sanitätsgefreite sich mit leicht zitternden Händen daran machte, das komisch eng geschnittene, schwarze Oberteil des Verwundeten, das weder Knöpfe, noch sichtbare Nähte aufzuweisen schien, an der gewünschten Stelle zu zerschneiden, hatte Korvettenkapitän Hohenstein, die sich abwartend und wie gewünscht ein paar Schritt abseits des Untersuchungstisches im Hintergrund gehalten hatte, die Möglichkeit, die nun nackten Beine des Mannes zu betrachten. Die Haut spannte sich über muskulöse Oberschenkel, war leicht gebräunt, an manchen Stellen glaubte sie Narben zu erkennen. Der Mann trug eine seltsam aussehende, eng anliegende dunkelgraue Unterhose in einem komischen Schnitt, so wie Hohenstein noch nie eine gesehen hatte. Abgesehen davon glaubte sie zu erkennen, dass Beine und Füße unverletzt waren. Sein Gesicht konnte sie nicht richtig erkennen, da es von nassen, dunklen Haarsträhnen teilweise verdeckt wurde. Außerdem trug er einen Bart, der an Oberlippe und Kinn länger zu sein schien, als an den Wangen und am Hals. Sie entdeckte auch graue Haare, sowohl an den Schläfen, wie auch in seinem Bart.
„Geben Sie her das Ding!“, knurrte Dr. Schrammel ungeduldig und riss dem nervösen Hübner die Schere aus den zitternden Fingern. Wesentlich ruhiger und schneller als der junge Gehilfe hantierte der Arzt mit der Schere und schnitt das Oberteil so auf, dass sie es problemlos zur Seite legen und mit einer kurzen, ruckartigen Bewegung unter dem Körper herausziehen konnten.
„Da haben wir’s“, murmelte Dr. Schrammel, klappte den Hohlspiegel, den er auf der Stirn trug, vor die Augen und beugte sich weiter nach vorne, um die Wunde zu untersuchen. Er sah eine fingerdicke, kreisrunde Öffnung, aus der stetig Blut auf den Untersuchungstisch sickerte. Mit schmalen, länglichen Instrumenten, die ihm eine der Schwestern auf seine Aufforderung hin in die ausgestreckte Hand gelegt hatte, machte er sich daran, die Wunde zu untersuchen.
„Kein Granatschrapnell“, murmelte er konzentriert, „nein, sicher nicht“, ergänzte er kopfschüttelnd.
„Vorsichtig auf die Seite drehen!“, befahl er Hübner.
„Wollen mal sehen, ob die durchgegangen ist, oder ob sie noch steckt“, sagte er mehr zu sich selbst als zu irgendjemand bestimmtem. Gemeinsam hoben sie den Oberkörper des Mannes ein paar Zoll an, sodass Schrammel den Rücken untersuchen konnte. Schließlich ließen sie ihn wieder nach unten sinken, nachdem keine Verletzungen am Rücken entdeckt worden waren.
„Was hat er?“, fragte Hohenstein, die sich nicht länger zurückhalten konnte und aus dem Gebrabbel des Arztes nicht recht schlau wurde. Dr. Schrammel drehte sich nicht zu ihr hin, als er antwortete.
„Er hat schon mal keine Verwundung aus dem Beschuss durch die Artillerie davongetragen. Das hier“, er deutete mit einem der länglichen Instrumente auf die kleine, kreisrunde Verletzung, „ist mit größter Wahrscheinlichkeit eine Schussverletzung.“
„Wie bitte?“ Korvettenkapitän Hohenstein glaubte, nicht richtig gehört zu haben.
„Woher“, begann sie, doch Dr. Schrammel, der sich schwungvoll zu ihr umgedreht hatte, unterbrach sie rüde.
„Frau Kapitän, würden Sie mich nun bitte diesem Mann helfen lassen? Wir können sämtliche Fragen, die Sie haben, gerne danach besprechen. Jetzt halte ich es für das Beste, wenn Sie mich einfach meine Arbeit erledigen lassen.“
Er wandte sich wieder seinem Patienten zu, befahl den beiden Schwestern, die Beine und den größten Teil des Oberkörpers mit warmen Decken zu verhüllen, damit sie die Unterkühlung des Patienten in den Griff bekamen. Die Körpertemperatur, die sie zuvor gemessen hatten, war schon bedenklich niedrig. Auch ohne die Verwundung und den damit verbundenen Blutverlust konnte diese Unterkühlung genügen, einen gesunden Menschen umzubringen.
Hohenstein, die schroffe Zurechtweisung des ihr eigentlich untergebenen Schiffsarztes noch verarbeitend, stand ein paar Meter abseits und bemerkte, dass sie fror. Ihre Uniform war völlig durchnässt, selbst in ihren Stiefeln stand knöcheltief kaltes Meerwasser. Obwohl es ihr schwerfiel, gestand sie sich ein, dass der Arzt recht hatte. Wenn sie diesen Schiffbrüchigen retten wollte, dann musste sie ihre medizinische Abteilung ungestört arbeiten lassen. Den rauen Ton, den Dr. Schrammel ihr gegenüber angeschlagen hatte, konnte sie gut verkraften, hatte sie doch während ihrer Ausbildung und auch als junger Fähnrich so manche Zurechtweisung einstecken müssen. Und auf der Krankenstation war der Doktor immer der Chef, nicht nur hier auf der Prinz Eugen, sondern überall, wo unter dem Banner des roten Kreuzes Menschen geholfen wurde. Also hielt sie sich ein paar Meter abseits im Hintergrund und beobachtete wortlos gespannt das Geschehen.
„Ja, genau wie ich mir gedacht habe“, sagte Dr. Schrammel, der hochkonzentriert mit der Untersuchung der Wunde befasst war. Er richtete sich auf und wandte sich an die beiden Schwestern sowie an seinen Assistenten Hübner.
„Bereiten Sie den Patienten vor, wir müssen die Kugel entfernen“, sagte er, während er sich daranmachte, noch einmal Puls und Blutdruck zu messen. Er hob den Arm des Verwundeten und legte die Druckmanschette am Oberarm an, schloss die Gurte und begann, die Manschette aufzupumpen. Der erfahrene Schiffsarzt sah die Bewegung nicht kommen, erschrak deshalb heftig, als er kraftvoll am offenstehenden Hemdkragen gepackt wurde. Brutal wurde er nach vorne gezogen, der Stoff riss geräuschvoll und Knöpfe landeten klappernd am Boden. Er fand sich nur wenige Zentimeter vor dem Gesicht des Verwundeten wieder, der ihn nun aus verwirrten Augen ansah.
„Nina“, röchelte er mit heiserer Stimme, während sein Blick wie der eines gehetzten Tieres in der Krankenstation umherirrte. Als er Korvettenkapitän Hohenstein entdeckte, sah er sie einige Augenblicke lang an. Seine Blicke trafen die ihren, kurz schien er so etwas wie Erleichterung zu verspüren, doch dann, als er erkennen musste, dass ihm diese Frau nicht bekannt war, schlich sich wieder ein Ausdruck in seine Augen, der erneut Unsicherheit suggerierte, ja beinahe Angst ausdrückte.
„Wo ist sie?“, fragte er zitternd und hielt dabei Dr. Schrammel so fest am Hemdkragen, dass dieser bereits zu würgen anfing. Hübner packte nun seinerseits die Hand des Verwundeten, mit der dieser den Arzt in seinem eisernen Griff hielt.
„Was habt ihr mit ihr gemacht, verflucht?“, schrie der Mann nun, während Dr. Schrammel und der Sanitätsgefreite Hübner nach wie vor erfolglos versuchten, die Hand vom Hals zu lösen.
„Nina!“, grölte der Verwundete röchelnd und machte sich daran, sich von der Liege zu erheben. Hohenstein war aus ihrer Erstarrung erwacht und lief nun mit großen Schritten auf den Behandlungstisch zu. Beherzt griff sie zu und packte den sehnigen Unterarm des Mannes, riss mit aller Kraft daran und gemeinsam gelang es ihnen, kurz bevor der bereits bläulich angelaufene Arzt das Bewusstsein zu verlieren drohte, die Hand von dessen Hals zu lösen. Schrammel sackte nach Luft japsend auf dem Boden zusammen, wo er schnaufend und hustend auf dem Rücken liegen blieb. Eine der Schwestern war auf den Gang gestürmt und schrie nun lauthals nach der Wache. Die andere Schwester warf sich auf den Behandlungstisch, mitten ins Gerangel, und wurde keine Sekunde später von einem Ellbogenhieb an der Schläfe getroffen. Ihre Augen verdrehten sich und sie rutschte wie ein nasser Sack auf den Boden, wo sie neben dem schwer atmenden Doktor liegen blieb.
„Wo ist sie?“, brüllte der Mann, der sich nun halb aufgerichtet hatte und sich mit all seiner Kraft gegen Hohenstein und Hübner wehrte, die ihn wieder niederdrücken wollten. Plötzlich schoss die Faust des Schiffbrüchigen nach vorne, traf wuchtig das Nasenbein des Sanitätsgefreiten, welches knackend brach. Augenblicklich ließ Hübner von ihm ab und wandte sich aufjaulend und sein Gesicht mit den Händen bedeckend ab. Nun war es also an Hohenstein, den Randalierenden zu bändigen. Als sie die Kraft seiner Arme spürte und den schieren Willen in seinen Augen sah, wusste sie, dass sie keine Chance haben würde. Sie spürte seine Hände, die ihre Handgelenke packten und sie mühelos verdrehten, sodass sie sich nicht mehr wehren konnte. Hohenstein sah in die Augen des Mannes, die sie in einem klaren Graugrün anstarrten, und glaubte, darin völlige Unsicherheit und Unverständnis zu entdecken, aber keinesfalls Bösartigkeit oder Hass. Dann hörte sie dumpfes Poltern schwerer Stiefel in ihrem Rücken und Schreie von mehreren Männern.
Der Mann, der sie gepackt hielt, hatte dies ebenfalls registriert und ließ sie augenblicklich los. Während sie nach unten sackte, sah sie den Kolben eines Gewehres, das nach dem Kopf des Mannes schlug. Sie sah, wie dieser das Gewehr gekonnt parierte und zur Seite abwehrte. Sie sah aber auch, wie ein zweiter Kolben klatschend die Stirn des Mannes traf, dann verschwand er aus ihrem Blickfeld.
„Nein!“, schrie sie, „sofort aufhören!“
Mühsam rappelte sie sich hoch und entdeckte dabei Dr. Schrammel, der sich ebenfalls wieder halb erhoben hatte. Ihr Blick fiel auf den Behandlungstisch, wo der Verwundete lag. Seine Augen waren geschlossen, er bewegte sich nicht mehr und überall war Blut.
„Zurück!“, befahl sie den beiden Marinesoldaten, die mit fragenden Blicken und schussbereiten Gewehren die chaotische Szenerie betrachteten.
„Sichern Sie Ihre Waffen, bevor Sie damit noch jemanden erschießen!“, brüllte sie, worauf die beiden Soldaten sich vielsagende Blicke zuwarfen und die Waffen senkten.
„Raus!“, wies sie die beiden an.
„Warten Sie vor dem Schott auf weitere Befehle.“
Als sie sich umdrehte, sah sie Dr. Schrammel, wie sich dieser wieder über den nun nicht mehr rabiaten Verwundeten beugte, um ihn zu untersuchen. Sie ging die paar Schritte zum Behandlungstisch und betrachtete den Schiffbrüchigen. Als sie sein Gesicht sah, zuckte sie zusammen. Er blutete stark aus einer hässlichen Wunde an seiner Stirn, auch die Schusswunde an seiner Seite hatte wieder verstärkt zu bluten begonnen. Ansonsten gab der Mann kein Lebenszeichen mehr von sich, dass Hohenstein hätte erkennen können.
„Ist er tot?“, fragte sie gerade heraus. Dr. Schrammel fühlte nach dem Puls, fand ihn und begann sofort wieder Anweisungen zu geben.
„Nein, er lebt“, antwortete er.
„Noch“, ergänzte er ernst. Dann wurde es hektisch, als die beiden Schwestern und der Arzt sich um den Schwerverletzten kümmerten. Einen Augenblick besah sich Schrammel die gebrochene Nase des Sanitätsgefreiten, erkannte, dass hier keine akute Gefahr bestand, und überließ ihn der Pflege eines weiteren Sanitäters, der mittlerweile aus der Messe geholt worden war. Dann wandte er sich wieder an Hohenstein.
„So, jetzt verlassen alle die Krankenstation, außer zwei Wachen, die zur Sicherheit hierbleiben.“
Er glaubte zwar nicht, dass der Mann nach diesem Schlag, sollte er ihn überhaupt überleben, in den nächsten Minuten aufwachen würde, aber garantieren konnte er es nicht.
„Ich will versuchen, das Leben dieses Verrückten zu retten“, sagte er launig, dann machte er sich an die Arbeit.
Korvettenkapitän Anna Maria Hohenstein trug frische, trockene Kleidung, als sie später mit nachdenklicher Miene vor dem orangen Gebilde kniete, in dem der Schiffbrüchige gefunden worden war. Sie trug ihren Wollmantel und eine dicke Mütze aus Biberfell, die die Marine erst kürzlich für den Dienst in den arktischen Regionen eingeführt hatte. Ein silberner Adler, der auf einem Anker saß, war vorne auf der Mütze aufgenäht worden, das Symbol der Seestreitkräfte der noch so jungen Republik Österreich. In der Offiziersmesse war es überhaupt nicht kalt, doch Hohenstein hatte sich noch immer nicht vollends aufgewärmt, weshalb sie den Mantel und die Mütze noch nicht abzulegen gedachte. Die Wärme des Schiffsinneren bahnte sich nur recht langsam den Weg zurück in ihren schlanken Körper, dem der Regen und die Kälte des eisigen Decks zugesetzt hatten. Nach ihrer Dienstzeit bei der vierten Flotte in der warmen Adria hatte sie sich noch nicht an die für sie neuen Witterungsverhältnisse gewöhnt, die hier oben in der Nordsee und noch weiter nördlich, im Polarmeer, herrschten.
Sie berührte das gummiartige Material, fuhr beinahe zärtlich mit ihren langen, gepflegten Fingern über die schwarzen Buchstaben, folgte den Konturen der exakt gearbeiteten Nähte, an denen keinerlei Stiche oder Fäden zu finden waren, und fragte sich immer wieder, was zum Teufel sie da aus der rauen Nordsee gezogen hatten. RESCUE, las sie, und ihre Englischkenntnisse erlaubten ihr zu erkennen, dass es sich um ein Rettungsfloß oder einen überdimensionalen Rettungsring handeln musste – besser gesagt: um die Reste eines solchen. Die Granaten der Prinz Eugen mussten sehr nahe eingeschlagen haben und es war ein Wunder, dass der Mann nicht von Schrapnellen getroffen worden war. Diesem Rettungsfloß hatten sie auf jeden Fall ordentlich zugesetzt. Außer dem einen war kein anderes englisches Wort mehr zu entdecken. Die persische oder chinesische Schrift hingegen, die überall zu lesen war, vermochte niemand an Bord zu entziffern. Den Namen eines Schiffes, zu dem dieses Floß oder Boot gehörte, suchte man ebenso vergeblich.
In diesem durchnässten, zerfetzten Gummiding hatte man außer dem Überlebenden nur einige wenige Dinge gefunden, die nun fein säuberlich auf einem weißen Tisch aufgereiht lagen. Hohenstein erhob sich wieder, nahm nun doch zumindest die dicke Fellmütze ab und fuhr sich kurz kontrollierend durchs Haar. Vor dem Tisch hielt ein Matrose Wache und passte auf, dass nichts von den gefundenen Gegenständen abhandenkam. Hohenstein nickte dem salutierenden Soldaten zu und besah sich den mickrigen Fund. Sie würde die Dinge besser auf ihre Kajüte bringen lassen, dachte sie, während sie nach dem ersten Fundstück griff. Es handelte sich um einen sehr merkwürdig geformten Dosenöffner aus einem schwarzen, leichten Material. Sie betrachtete ihn eine Weile, legte ihn dann wieder zurück. Ein Paddel war gefunden worden und es schien aus weißem Plastik zu sein, nicht aus Holz. Das Paddel war nicht sonderlich interessant, im Gegensatz zu den weiteren Objekten. Sie griff nach einem kleinen, weißen Plastikpäckchen, auf dem dieselbe nicht entzifferbare Schrift stand wie überall auf dem Rettungsfloß. Es war so groß wie ihre geöffnete Hand und wog etwa ein Viertelkilo. Hohenstein vermochte nicht zu erkennen, um was es sich handelte, und legte es zurück auf den Tisch. Dann nahm sie einen größeren Gegenstand in Augenschein, eine orange Boje, die etwa die Größe und die Form einer Weinflasche hatte. Die Boje war aus mattem Metall und teilweise aus Plastikteilen gefertigt. In kleinen schwarzen Buchstaben war wieder etwas Unbekanntes aufgedruckt worden. Eine seitliche Halterung war abgerissen, wie sie am ausgefransten Plastik erkennen konnte. Das Ding war schwer, dachte sie, es wog gut und gerne drei bis vier Kilogramm. Wieder fragte sie sich, was sie da wohl in Händen hielt, als sie Schritte und eine Stimme in ihrem Rücken hörte. Sie drehte sich um und sah, wie Dr. Schrammel die Messe betrat. Es war noch keine zwei Stunden her, seit sie ihn im Krankenrevier verlassen hatte.
„Frau Kapitän“, sagte er wesentlich ruhiger, als vorher, „der Mann ist am Leben.“
„Sehr gut“, antwortete Hohenstein erleichtert. Ein toter Zivilist, der auf ihre Rechnung ging, war das Letzte, was sie jetzt gebrauchen konnte.
„Ist er bei Bewusstsein?“, fragte sie. Der Blick des Arztes verfinsterte sich.
„Nein“, sagte er leidenschaftslos.
„Und ich habe keine Ahnung, ob er jemals wieder aufwachen wird“, schloss er müde. Hohenstein nickte verständnisvoll, auch ihre Miene verdüsterte sich.
„Die Schusswunde ist unproblematisch“, fuhr der Arzt fort.
„Und den vielen Narben nach zu urteilen, die er am ganzen Körper hat, scheint er hart im Nehmen zu sein.“
Hohenstein nickte und erinnerte sich an die zahlreichen hellen Striemen und Flecken.
„Aber dieser schwere Schlag gegen seinen Kopf“, murmelte er kopfschüttelnd, „keine Ahnung, ob er den übersteht.“
„Dann müssen wir abwarten“, sagte Hohenstein, „und hoffen, dass sich sein Zustand nicht verschlechtert, bis wir wieder zurück an Land sind.“
Der Arzt nickte zustimmend, murmelte ein paar Worte, dass er wieder zurück müsse, drehte sich um und ging langsam zur Tür. Dann, kurz bevor er sie erreichte, hielt er inne und drehte sich wieder um.
„Ah, bevor ich’s vergesse“, sagte er und strich sich über die müden Augen.
„Der Mann hat eine Tätowierung an der Schulter, die ist recht interessant.“
Hohenstein sah den Arzt an.
„Und?“, fragte sie, „was stellt sie dar?“
„Vier Großbuchstaben“, erklärte Schrammel.
„U.S.M.C.“
Dann ging er endgültig und Korvettenkapitän Hohenstein war so klug wie zuvor. Nachdenklich stand die junge Kommandantin in der Offiziersmesse, während der stählerne Rumpf des Panzerkreuzers Prinz Eugen auf Heimatkurs durch die aufgewühlte Nordsee pflügte. Das Manöver war beendet.