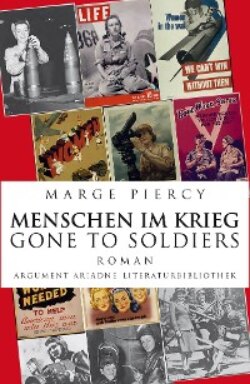Читать книгу Menschen im Krieg – Gone to Soldiers - Marge Piercy - Страница 20
Louise 2 Der schwarze Ritter
ОглавлениеDer Zug zurück aus Washington war unvorstellbar überfüllt. Louise hockte die ganze Fahrt über auf ihrem Koffer und wünschte, sie hätte den neuen Farbstift für die Beine benutzt, den Kay ihr gezeigt hatte, und nicht ihr letztes Paar Strümpfe ruiniert. Neben ihr war ein Matrose eingeklemmt, so dicht, dass sie das an seinen Schuhen klebende Erbrochene riechen konnte. Erschöpft schlief er im Stehen, lehnte sich anfangs an sie, dann an den Mann auf seiner anderen Seite. Es war heiß für Mitte Mai, in Washington bereits subtropisch, und der Zug war unangenehm verstunken, sogar in den Gepäcknetzen schliefen Militärangehörige.
Sie hatte einer Konferenz des Schriftstellerkriegsbeirates beigewohnt. Dieser war nicht Teil der offiziellen Regierungsbürokratie, auch wenn Redakteure und Verleger das oft annahmen, weil er eng mit dem Statistischen Bundesamt zusammenarbeitete, das wiederum laut Flüsterparole bald durch eine Behörde ersetzt werden sollte, die sich eher dafür eignete, Propaganda zu verbreiten.
Sie war angesprochen worden, beim Aufbau der Zeitschriftenabteilung mitzuhelfen. Sie hatte wenig mit dem Komitee für Boulevardblätter zu tun, doch sie arbeitete in der Gruppe mit, die Richtlinien für Frauenzeitschriften und Zeitschriften mit unbegrenztem Leserkreis erstellen half: ihren eigenen Märkten. Alle drei Monate gab der Beirat Kriegsrichtlinienergänzungen heraus mit Themenvorschlägen für die Kurzgeschichten und Beiträge in den Zeitschriften.
Sie erkannte Washington von ihrem ersten Besuch als Touristin mit Oscar und Kay kaum wieder. Auf gleichem Raum schienen fünfmal so viele Menschen zu leben. Was sie auch tat, ob sie am Taxistand wartete, an der Essensausgabe wartete, vor der Toilette wartete, überall standen lange Schlangen. Washington kam ihr vor wie eine Telefonzelle, in die sich zu viele Leute gezwängt hatten, um alle gleichzeitig in den Hörer zu schreien. Es blieb im Kern eine selbstzufriedene, rassengetrennte Südstaatenkleinstadt, deren bessere Restaurants und Hotels sich Schwarze verbaten und deren Schulen und sonstige Einrichtungen nach Schwarz und Weiß sortiert waren. Dennoch wimmelte es von faszinierenden Männern, jetzt vielleicht mehr denn je.
In New York war Pennsylvania Station überrannt von Menschen mit und ohne Uniform, die sich mit Inbrunst begrüßten oder verabschiedeten. Louise hatte ihr Kostüm arg verschwitzt und fühlte sich welk und matt. Sie schaute sich nach ihrer Tochter um. Sie hatte Kay gebeten, sie abzuholen, da sie nicht nur ihren Koffer, sondern auch eine Aktentasche und dazu noch einen Pappkarton voller Materialien mitschleppte. Sie konnte keinen Gepäckträger finden und zerrte ihre Last den Bahnsteig entlang zur Sperre, dann hielt sie nach Kay Ausschau. Verspätet, nahm sie an. Sie setzte sich wieder auf ihren Koffer, fühlte sich entschieden schmutzig, müde und unattraktiv. Wo zum Teufel blieb ihre verdammte Tochter? Sie wollte sich bei einem öffentlichen Fernsprecher anstellen, aber die Warteschlangen waren einfach viel zu lang.
Schließlich, nachdem eine halbe Stunde verstrichen war, requirierte sie einen der wenigen verbliebenen Gepäckträger und setzte sich in ein Taxi. New York war für halb fünf überraschend unverstopft. Noch vor sechs Monaten um diese Stunde in der Pennsylvania Station anzukommen und ein Taxi zu nehmen hätte bedeutet, im Schritttempo voranzuschmauchen. Schon waren deutlich weniger Autos auf den Straßen von Manhattan, und der Verkehr floss rasch. Was war nur mit Kay passiert?
Sinnliche Erleichterung durchflutete sie, als sie die Diele ihrer Wohnung betrat. Daheim. In Washington hatte sie sich im Mayflower ein winziges Zimmer, das offensichtlich bis zu diesem Jahr ein kleineres Einzelzimmer gewesen war, mit Dorothy McMichaels teilen müssen, die unter einer ganzen Phalanx von Pseudonymen pro Monat zwei bis vier Geschichten für die Boulevardblätter ausspie. Dorothy war konservativ, fromm und glaubte fest an sexuelle Sünde und Sühne. Mit ihren derben Knochen und ihrer lauten Stimme erinnerte sie Louise an die Sozialarbeiterinnen, die sie als Waisenkind in Cleveland zu diversen Pflegeeltern gesteckt hatten.
Louise dachte nicht gern an ihre Kindheit zurück, die hart, freudlos und wie ein Zeitsprung zurück in einen Roman von Dickens gewesen war. Wegen ihrer christlichen Frömmigkeit erinnerte Dorothy sie an ein ganz bestimmtes Pflegeelternpaar, das sie besser ernährte und kleidete, als sie gewohnt war, dafür aber weit mehr in Angst und Schrecken versetzte, denn der Vater versuchte ihr ins Höschen zu greifen, wann immer er sie allein erwischte. Ein Diakon der Methodistenkirche. Die Sozialarbeiterinnen hatten sich oft nicht darum gekümmert, dass Louise jüdisch war, denn – wie sie in ihrer Gegenwart laut zueinander sagten – man sah es ihr nicht an. Louise wusste es besser. Sie sah wie eine ungarische Jüdin aus, wie Fotos von ihrer Mutter, bevor Krankheit und stupide Schwerstarbeit ihre Schönheit weggefressen hatten. Darum gemahnte Dorothy sie stärker an ihr verängstigtes und machtloses früheres Selbst, als ihr lieb war. Louise ließ ihre Herkunft lieber in ihren politischen Überzeugungen als in ihren Gefühlen weiterleben. Außerdem liebte sie ein gewisses Maß an Abgeschiedenheit und Bequemlichkeit. Das Reisen hatte auf Kriegsdauer, wie man jetzt sagte, aufgehört, ein Genuss zu sein.
Sie sah rasch ihre Post durch, die sich in einer Ansammlung wackeliger, von Blanche sortierter Türme aufgehäuft hatte, bevor sie durch die Wohnung eilte und »Kay! Kay!« rief.
Ihre Tochter war nicht in ihrem Zimmer. Mrs. Shaunessy erklärte, Kay habe ihr gesagt, sie könne ihre Mutter nicht abholen. »Es wäre nett gewesen, wenn sie sich die Mühe gemacht hätte, mir das zu sagen! Ich habe eine halbe Stunde gewartet«, beklagte sich Louise.
Mrs. Shaunessy schüttelte müde den Kopf. Obwohl beide etwa im gleichen Alter waren – die Haushälterin, die zwei verheiratete Töchter hatte, war einundvierzig –, wirkte Mrs. Shaunessy mit ihrem straff zu einem Knoten zurückgekämmten graumelierten Haar auf Louise großmütterlich. »Wo wir schon dabei sind, ich hatte Streit mit Kay über ihr Kommen und Gehen. Ich muss schon sagen, sie ist mir reichlich pampig über den Mund gefahren. Das Kind hat sich geweigert, mir zu sagen, wo sie heute Nachmittag nach Schulschluss hingeht.«
»Was steckt bloß dahinter? Ich werde mit ihr über ihr ungehöriges Benehmen sprechen.«
»Es steht mir nicht zu, das zu sagen, aber wenn Sie mich fragen, die ist hinter den Jungens her. So fängt das alles an in dem Alter. Sie wissen ja.«
»Kay?« Sie dachte an ihr linkisches, schlaksiges Füllen. »Irgendwie habe ich meine Zweifel, aber ich werde sie mir sofort vorknöpfen.«
Bestrafte Kay sie, weil sie weggefahren war? Sie hätte ja erwogen, Kay mitzunehmen, aber dafür hätte Kay der Schule fernbleiben müssen, einer Elizabeth-Irwin-Schule, und im Washington der Kriegszeit waren Unterkünfte so knapp, dass sie nicht einfach ein Doppelzimmer verlangen und ihre Tochter hineinsetzen konnte. Sie hätte ja selbst alles für ein Einzelzimmer gegeben.
Sie ärgerte sich über ihre Ansprüche. Ein Zimmer mit einer lauten Schmachtfetzenschreiberin zu teilen war schließlich kaum mit den Gefahren vergleichbar, denen die europäische Zivilbevölkerung und die amerikanischen Militärangehörigen ausgesetzt waren. Manchmal war ihr unbehaglich, wie sehr sie sich an Komfort und Annehmlichkeiten gewöhnt hatte, an saubere frische Kleider, die modisch und gut gearbeitet waren, ein heißes Bad, wann immer sie Lust hatte, eine Haushälterin, die Kay und sie versorgte, eine Sekretärin, um ihre Korrespondenz zu erledigen und ihre Manuskripte zu tippen, saubere, helle, geräumige Zimmer, geschmackvoll eingerichtet und mit ein paar schönen Bildern geschmückt, Originalen, von Oscar oder ihr ausgesucht. Sie hatte sich an alle Annehmlichkeiten des gehobenen Bürgertums gewöhnt und Kay dazu erzogen, sie zu erwarten, einen sauberen, schönen, lichtdurchfluteten Ort zum Wohnen und Arbeiten, gutes und reichliches und abwechslungsreiches Essen, einen ständigen Strom von Anregungen in Form von Konzerten, Büchern – die neuesten, die ältesten, die besten – und immer intelligenten und engagierten Gesprächen.
Sie zog ihr Hauskleid und ihre Pantoffeln an und warf sich in den Sessel vor ihrem Walnussschreibtisch. Sie war für den Ausschuss ungeheuer nützlich, denn der Gedanke, das, was sie schrieb, als Propaganda zu sehen, war für sie weder neu noch schockierend. Sie zog die neue Linie der alten vor: Ihr lag viel näher, in arbeitenden Frauen liebevolle, verantwortungsbewusste, ja sogar aufregende Staatsbürgerinnen zu sehen, als die Linie, die propagiert worden war, seit sie zu veröffentlichen begann, dass nämlich die arbeitende Frau eigenmächtig sei, selbstsüchtig, eine Gefahr für ihre Familie und die Gesellschaft.
In ihrer Familie hatten die Frauen immer gearbeitet. In Ungarn hatte ihre Großmutter einen Geflügelhandel betrieben, hieß es. Ihre Mutter hatte in einer Konservenfabrik gearbeitet, bis TB sie von Louise fortriss in ein Sanatorium und schließlich in einen frühen Tod. Oscar hatte nie den Wunsch, dass sie untätig blieb oder die Arbeit im Haushalt zu ihrer ganzen Existenz machte. Doch wollte er selbstverständlich, dass sich die gesamte Aufmerksamkeit dieser intelligenten Frau auf ihn konzentrierte. Ihre Arbeit war gut und schön, solange sie alles fallen ließ, wenn er sie brauchte, um seine wissenschaftlichen Aufsätze zu tippen, zu lesen und zu begutachten und seinen Stil zu verbessern, ihm den Rücken zu massieren und sich seine Klagen über seine Kollegen anzuhören.
Das war der Grund, warum sie nur ein Kind hatten. Ihr war kurz nach Kays Geburt klar geworden, dass sie bei seinen Anforderungen an sie nur mit Mühe zurechtkommen würde. Sie musste ständig das, was Kay brauchte, mit dem austarieren, was Oscar verlangte. Sollte sie mit ihm über Kays Widerspenstigkeit reden? Sie mied Oscar dieser Tage. Beinahe mit ihm ins Bett gefallen zu sein hatte sie genügend aufgeschreckt, so dass sie es seitdem eingerichtet hatte, ihn nicht zu sehen, außer für die paar Augenblicke, wenn er Kay abholte oder wieder ablieferte.
Kay erschien kurz vor sieben, zum Abendessen. »Wo warst du?« Louise folgte ihrer Tochter in deren Zimmer. »Warum hast du mich nicht abgeholt? Ich habe in der Pennsylvania Station über eine halbe Stunde auf dich gewartet.«
»Mutter, ich habe gestern Abend bis halb zwölf versucht, dich anzurufen, aber du warst nicht auf deinem Zimmer. Schließlich hat diese schreckliche Frau gesagt, ich soll nicht mehr anrufen. Hat sie dir nichts ausgerichtet?«
Louise hatte unten in der Bar gesessen, bis geschlossen wurde. Sie war mit Claude Martel zusammen gewesen, einem Filmregisseur, den sie im Statistischen Bundesamt kennengelernt hatte. »Die schlief schon, als ich kam – wir hatten eine Konferenz bis spät in die Nacht, um neue Richtlinien auszuarbeiten. Warum warst du nicht am Bahnhof? Du wusstest, dass ich mich auf dich verlassen habe.«
»Ich hatte eine Verabredung, die ich nicht absagen konnte.«
»Du kannst sehr wohl eine Verabredung absagen, wenn deine Mutter dir aufträgt, sie vom Zug abzuholen! Ich hatte tonnenweise Gepäck.«
»Mutter, ich verstehe einfach nicht, warum du so ein Geschrei machst! Du hast es doch geschafft – du bist da. Wenn du in deinem Hotelzimmer gewesen wärst, hättest du gestern Abend meine Nachricht bekommen.«
Louise sah im Geiste Claude Martel an dem Tischchen vor sich. Sie hatte mit einem Dramatiker aus dem Mitarbeiterstab geflirtet, aber das erste ernsthafte Tête-à-Tête mit Martel hatte diese zerbrechliche Konstruktion zertrümmert. Claude war Sohn einer rumänischen Jüdin, die einen französischen Geschäftsmann geheiratet hatte; die späten dreißiger Jahre hatten Claude nach Hollywood gebracht, wo er sich als meisterhafter Tonfilmregisseur erwiesen hatte. Jetzt war er bei Universal. Sie schätzte sein Alter auf fünfundvierzig. Dynamisch, magnetisch, dunkelhaarig, helläugig, war er der erste Mann, der sie seit Oscar anzog. Gegenüber ihrer Tochter hatte sie ein etwas schlechtes Gewissen, so lange mit ihm zusammengesessen zu haben, über den Flirt hinaus in die Erkundung. Er hatte gesagt, er würde Mitte des Sommers in New York sein und sich dann mit ihr treffen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Sie war überzeugt, er begegnete einer Vielzahl von Frauen, die jünger waren und wesentlich aufsehenerregender aussahen als sie. Trotzdem war es beruhigend, ihre Anziehungskraft zu spüren, es nahm ihr die Furcht, grundsätzliche Treue zu Oscar könnte auf ewig ihr Los sein. Dieser Abend gab ihr ein Gefühl von Dichte und Schwere, sinnlicher als die paar Mal im Bett mit Dennis Winterhaven. Obwohl nichts weiter geschah als Reden und Händchenhalten, fühlte sie sich von Claude berührt wie von keinem anderen Mann seit Oscar. Deshalb befürchtete sie, dass ihre Tochter ihr diese Affäre vom Gesicht ablesen konnte, in deutlich geschriebenen Worten.
»Mrs. Shaunessy ruft uns, Mutter. Das Abendessen steht auf dem Tisch.«
»Ich möchte nicht, dass du ungezogen zu ihr bist, Kay. Du wirst dich mit ihr einigen, und du wirst freundlich zu ihr sein.«
»Sie ist nicht meine Mutter. Sie darf mich nicht herumkommandieren.«
»Sie ist mein Ersatz, wenn ich fort bin, und du wirst sie gut behandeln. Kay, du hast Mrs. Shaunessy immer lieb gehabt. Was soll diese verächtliche Haltung?«
»Du meinst die Zeit, als ich ein Kind war. Dabei ist sie nur eine Dienstbotin. Sie hat kein Recht, mit mir zu reden, wie sie es tut.«
»Sie ist eine Respektsperson, der Achtung gebührt, und sie kennt dich, seit du klein warst. Sie hat für dich gesorgt. Wo warst du heute Nachmittag?«
Kay warf sich schmollend auf einen Stuhl im Esszimmer. Oh Jugendzeit, oh Kinderkacke, dachte Louise. Ich hatte nie die Möglichkeit, solche Allüren zu haben und solche Anfälle zu kriegen. Vielleicht ist das ein Geschenk, das ich ihr mache, die Möglichkeit, emotional um sich zu schlagen, ohne dass es etwas kostet. Louise hasste Streit bei Tisch, so verschob sie die Auseinandersetzung, bis sie den Lammbraten genossen hatten, den Mrs. Shaunessy ergattert hatte. Gelbe Schwertlilien in einer blauen Vase. Louise war immer noch erleichtert, daheim zu sein, aber in ihr Glück mischte sich die Verärgerung über ihre Tochter.
Eine Haushälterin zu beschäftigen war eine heikle Angelegenheit für ihr Gewissen, aber sobald die Entscheidung einmal getroffen war, hatte sie sich rasch daran gewöhnt. Ohne Mrs. Shaunessy hätte sie nur halb so viel geschafft. Vor langer Zeit hatten sie ihren Umgang miteinander festgelegt. Sie siezten sich und plauschten nicht. Mrs. Shaunessy klatschte mit ihren Freundinnen, die in anderen Haushalten im gleichen großen Mietshaus arbeiteten. Mrs. Shaunessys Zimmer war für alle Übrigen tabu, und was sie ihnen kochte, aß sie in der Küche – wo auch Louise aß, wenn sie allein war, und wo Kay aß, wenn Louise nicht da war. Mrs. Shaunessy hatte mittwochnachmittags und sonntags frei, wo sie ausnahmslos den Zug in das Fünf-Städte-Gebiet auf Long Island nahm, um die eine oder die andere ihrer verheirateten Töchter zu besuchen.
Dennoch fasste Louise die Widersprüche ihres Lebens in einem Satz zusammen, den sie sich einmal hatte sagen hören: »Sag bitte Mrs. Shaunessy, sie soll den Daily Worker auf den Couchtisch legen.« Sie war eine Sympathisantin, die der Kommunistischen Partei nie beigetreten war, weil es für sie stets einen Teil der momentan gerade gültigen Parteilinie gab, mit dem sie nicht einverstanden war. Stets hatte sie Bedenken, Vorbehalte, Einwände. Es war ein langer Flirt gewesen, doch falls nicht entweder sie oder die Partei sich drastisch änderte, würde sie wohl nie schwören zu lieben, zu ehren und zu gehorchen. Der Hitler-Stalin-Pakt besiegelte und verplombte ihre Entscheidung wie einen endgültig zuplombierten Zahn.
Sie bereitete den Kaffee und trug ihn ins Wohnzimmer, wie sie es immer tat. Sie fand, mit dem Abwasch des Geschirrs vom Abendessen sollte Mrs. Shaunessys Arbeitstag beendet sein. Kay hatte in letzter Zeit begonnen, Kaffee zu trinken. »So, wo warst du heute Nachmittag, Kay?« Sie gab sich Mühe, forsch zu klingen, fest.
»Ich hatte ein Rendezvous.«
»Ein was?« Aber sie hatte Kay deutlich gehört. »Mit wem?«
Kay warf die Haare in den Nacken. Sie reckte das Kinn in die Höhe und hielt die Wimpern auf Halbmast, zweifellos imitierte sie irgendeinen Filmstar. »Er heißt Andy.« Als Louise ihren strengen Blick nicht abwandte, fügte sie hinzu: »Andy Bates.«
»Sprich weiter. Wo hast du ihn kennengelernt und wer ist er und warum hast du nicht vorher mit mir darüber geredet?« Louise hatte den sauren Gedanken, wenn sie ihre Kindheit in einem Roman von Dickens verbracht hatte, so schien die ihrer Tochter in Filmschnulzen zu baden.
»Ich bin sechzehn, Mutter, ich bin jetzt erwachsen, und es wird Zeit, dass du das zur Kenntnis nimmst. Mädchen werden in Kriegszeiten schneller erwachsen.« Kay lauschte mit einiger Zufriedenheit, wie sich das anhörte.
»Seit letzter Woche bist du erwachsen? Erstaunlich. Und wer ist dieser Andy Bates?«
»Er ist bei der Marine.«
»Oh nein! Ein Matrose? Wo zum Teufel lernst du Matrosen kennen?«
»Vor dem Rekrutierungsbüro. Wir sind zu jung, um hineinzugehen, aber wir treffen uns draußen mit ihnen. Deine Haltung ist unpatriotisch, Mutter. Ich schäme mich für dich.«
»Ich schäme mich für dich, du gabelst auf der Straße einen Matrosen auf und willst mir weismachen, das sei Teil der Kriegsanstrengungen. Was hast du mit ihm gemacht?«
»Wirklich, Mutter, du hörst dich an wie eine viktorianische Matrone, die mir gleich die Tür weisen wird. Ich bin zu einer Doppelverabredung mit ihm zum Zoo im Central Park und dann auf dem See rudern gegangen. Mit seiner Freiheit ist es vorbei. Ich habe versprochen, ihm zu schreiben, aber ich werde ihn erst in einigen Monaten wiedersehen, falls er nicht vorher in Stücke gerissen wird.«
»Kay, er mag ein netter junger Mann sein, aber du kannst nicht Männer auf der Straße aufgabeln und erwarten, dass sie sich anständig verhalten. Du hast überhaupt keine Ahnung, in was du da geraten kannst. Manche Männer sind durchaus bereit, Gewalt anzuwenden –«
»Wirklich, Mutter, heutzutage treffen sich alle zwanglos, und wenn du ehrlich glaubst, er wollte mich mitten im Zoo schänden –«
»Du weißt gar nicht, was das Wort bedeutet! Ich wünsche nicht, dass du dich vor dem Rekrutierungsbüro herumtreibst und dich in Schwierigkeiten bringst. Und wenn ich dich jeden Tag von der Schule abholen und nach Hause bringen muss, dann werde ich das tun.«
»Mutter! Willst du, dass ich vor Blamage sterbe? Ich höre mit der Schule auf, wenn du mich so behandelst.«
»Das bezweifle ich. Du würdest dich zu Hause ganz schön langweilen. Hör zu, Kay, wenn du meinst, du bist alt genug für Verabredungen, dann nur an Wochenenden, und ich möchte die jungen Männer kennenlernen.« Sie hörte sich an wie eine Tugendwächterin, und es war ihr egal. In Kays Alter hatte sie einen geschärften Sinn dafür gehabt, welche Männer gefährlich waren und welche nicht, ein Wissen, vor dessen Erwerb sie Kay immer beschützt hatte; auch wünschte sie Kay nicht, die Männer, denen sie begegnete, auf ihr Potenzial zu brutaler Gewalt abschätzen zu müssen.
Sollte sie nicht Oscar zu Rate ziehen? Vielleicht war er in der Lage, Kay wesentlich wirksamer ins Gewissen zu reden, als sie es konnte; womöglich gelang es ihm, sie so zu beschämen, dass sie sich weniger leichtsinnig verhielt. Louise hatte das Gefühl, ihn hineinziehen zu müssen, wollte sich aber nicht in die gefährlichen Ranken von Oscars Aufmerksamkeit verwickeln. Bestimmt konnte sie mit Kay alleine fertig werden, sich für immer von ihm freimachen.
Sie saß bei zugezogenen Verdunkelungsvorhängen in ihrem Bett und las Saint-Exupérys Flug nach Arras. Dennis hatte ihr den Roman an jenem Abend gegeben, als sie ihn nicht davon abhalten konnte, ihr einen Heiratsantrag zu machen und sich dann verletzt zurückzuziehen. Plötzlich klingelte das Telefon.
Sie runzelte die Stirn. Spät für einen Anruf. Es war ein Ferngespräch. Als sie die Stimme mit dem französischen Anklang hörte, verschwand ihre Verärgerung. »Claude! Wo bist du?«
»Ich bin immer noch in Washington. Aber ich habe meinen Terminplan geändert. Morgen nehme ich den Zug nach New York, wo ich auch den Abend verbringe, und wir treffen uns, einverstanden? Kannst du absagen, was du vorhast, und kommen? Denn am nächsten Vormittag muss ich zurück an die Westküste.«
»Morgen? Soll ich dich vom Zug abholen?«
»Nein, der wird überfüllt sein. Ich habe es so arrangiert, dass ich mich in New York mit unserem Geldmogul treffe. Irgendein Lakai wird mich abholen. Ich rufe dich am späten Nachmittag an und sage dir, wann wir essen gehen. Ist das gut?«
»Hört sich sehr gut an.«
»Ich konnte nicht bis zum Sommer warten, Louise, um unser Gespräch fortzusetzen. Ich halte es für dringend. Bist du dafür?«
»Ich bin dafür, dich morgen zu treffen, Claude. Und jetzt gute Nacht.« Sie hatte sich im Verdacht, Claude unweigerlich in die Arme zu fallen, wenn er sie nur heftig genug bedrängte. Offensichtlich hatte sie auf ihn Eindruck gemacht, wie er auch auf sie, aber würde das zweite Treffen neben dem ersten bestehen? Mach dir keine Gedanken, befahl sie sich und knobelte, wie sie in ihren bereits engen Zeitplan einen Friseurtermin einarbeiten konnte und mit welcher Ausrede sie darum herumkam, mit ihren Freunden, den Bauers, Katherine Cornell in Shaws Candida anzuschauen, nachdem es so schwer gewesen war, dafür Karten zu ergattern. Sie musste Kay an ihrer Stelle hinschicken und unerwartete Arbeit für den Ausschuss vorschützen. Die Bauers waren es gewohnt, dass ihre Freunde nach Washington gerufen wurden und bei Bundesdienststellen ehrenamtliche Posten übernahmen. Sie würden ihren Termindruck nicht hinterfragen. Ihr kam die Idee, sich morgen früh von Kay beim Sortieren der Unterlagen aus dem Karton helfen zu lassen, was Kay von der Wahrheit ihrer Geschichte zu überzeugen versprach. Der Weg war frei für Torheiten.
Ich bin Oscar nicht nur in der Ehe treu gewesen, sondern auch noch lange danach, selbst wenn ich mich gelegentlich wie ein Packen frisch gewaschener, unsortierter Wäsche in das Bett eines anderen Mannes fallen lasse. »Ich war dir treu, Cynara, auf meine Weise.« Louise lächelte bei dem Gedanken an dieses schwer atmende Gedicht ihrer Jugend, das unter den literarisch interessierteren und emanzipierteren Koedukationsschülerinnen herumgereicht wurde, weil sie es erotisierend fanden, bis sie Joyce und Hemingway entdeckten. Claude hatte Oscars Kaliber, und selbst ein kurzer Galopp mit ihm tat ihrem Sinn für sich selbst und ihre Möglichkeiten bestimmt gut. Louise seufzte und fragte sich, ob sie sich nicht lieber auf schwüle Romane hätte werfen sollen statt auf stromlinienförmige Kurzprosa, denn in keiner ihrer Geschichten durften ihre Heldinnen den Hochofen sexueller Lust durchleben, der da im Zentrum toste und mit seiner Energie ihr Leben speiste.
Louise war zu aufgeregt, um schlafen zu können, wollte aber anderntags blendend aussehen. Schließlich kramte sie in einer Schublade nach einer Schlaftablette. Sie hatte seit den Monaten nach Oscars Auszug keine mehr genommen. Sie konnte sich an ihren unglücklichen Zustand erinnern, aber heute Abend hatte sie eine Vogelperspektive auf diese Hölle, säuberlich wie Flickenteppichfelder weit unter ihr. Wenn sie heute Abend eine Einschlafhilfe brauchte, dann nicht, weil ihr Leben ihr entleert vorkam, sondern übervoll.
Als sie erwachte, erinnerte sie sich an zwei sexuelle Träume. Darin hatte sie nicht mit Oscar geschlafen, der ihr Traumleben immer noch zu dominieren schien, auch nicht mit gesichtsloser Jugend, jung Tausendlieb, der manchmal Oscar ersetzte. Sie hatte geträumt, Körper an Körper nackt mit Claude zu liegen, einmal und dann noch einmal, und als sie nun aufstand, um sich ihrem Tag zu stellen, ertappte sie sich dabei, dass sie an ihn bereits als ihren Liebhaber dachte, als einen Mann, der ihr schon zweimal Genuss bereitet hatte.