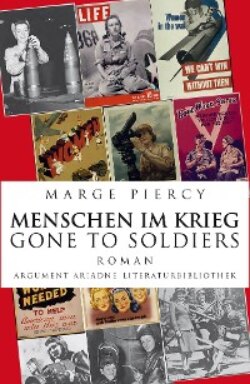Читать книгу Menschen im Krieg – Gone to Soldiers - Marge Piercy - Страница 7
Daniel 1 Ein alter China-Hase
ОглавлениеDaniel Balaban überquerte die Brücke von der Harvard Business School, in der er und seine Kommilitonen untergebracht waren, zum älteren Harvard auf der Cambridge-Seite des Charles River. Die Scharen junger College-Studenten betrachtete er ebenso neugierig und kühl distanziert, wie er die vielsprachigen Spaziergänger auf der Bund in Schanghai beobachtet hatte. Er gehörte hier nicht her. Die Marine erlaubte sich Harvard gegenüber einen kleinen Scherz mit diesem Sammelsurium aus Missionarssöhnen, Marinestabsoffizieren und alten China-Hasen, die in Geschäfts- oder Militärangelegenheiten die letzten zwanzig Jahre dort verbracht hatten. Die meisten konnten ein wenig Japanisch, doch andere wie er selbst konnten nur Chinesisch. Die Marine hatte sie hier zu einen Japanisch-Intensivkurs am Yenching-Institut versammelt. Daniel, Kind einer in der Bronx untergekrochenen jüdischen Emigrantenfamilie, hatte als Student hier und da Tüpfel von Begabung gezeigt, war jedoch zu keinem besonderen Ehrgeiz gelangt, zumindest keinem, für den akademische Grade verliehen wurden. Nun arbeitete er hart an seinem Japanisch und war von sich selbst überrascht: Sein Glück freute ihn, und zugleich fand er es komisch.
Daniel erinnerte sich gut genug an die Depression, um niemals zu vergessen, was Hunger war und wie er einen Menschen zusammenstutzte auf nichts als sich selbst. Sein Vater war mit fünfzehn Jahren aus dem polnischen Kozienice in die Vereinigten Staaten gekommen. Nach und nach hatte er sich ein kleines Knopfgeschäft aufgebaut, das in den zwanziger Jahren florierte. Er glaubte an sein Adoptivland und wollte alles so tun, wie es die Amerikaner taten. Er nahm Daniel und seinen älteren Bruder Haskel mit zu den Spielen der Giants, und er bedankte sich überschwänglich bei seinen Geschäftsfreunden für die Börsentipps, die sie ihm gaben. Es ging ihnen sehr, sehr gut, wie in seinen Träumen. Dann verschwand es über Nacht, als wäre es nie da gewesen: Feengeld. Daniel dachte, dass weder sein Vater noch seine Mutter je den Schock verwunden hatten, als all das Geld zu Schulden schmolz. Innerhalb von zwei Monaten waren sie nicht mehr wohlhabend, und wenig später waren sie arm.
Onkel Nat, der in Deutschland Geschäftsmann gewesen war, ging fort, sobald Hitler die Macht ergriffen hatte. In Schanghai blühten seine Geschäfte, und so wollte er seine Brüder nachkommen lassen. Onkel Mendel arbeitete in Frankreich; Onkel Eli und Tante Esther ging es in Kozienice sehr gut, vielen Dank. Daniels Vater in der Bronx nahm das Geld für die Überfahrt dankbar an und machte sich auf den Weg, um das Glück seines Bruders in Schanghai zu versuchen. Keiner von beiden wurde reich, aber es ging ihnen gut, taipans, erfolgreiche Geschäftsleute. Innerhalb von sechs Monaten holte Daniels Vater seine Familie nach. Alle fuhren, bis auf Haskel, den hochbegabten, wenngleich engstirnigen Medizinstudenten in einem vorklinischen Semester am City College.
Er konnte sich noch daran erinnern, wie er und seine Schwester Judy und seine Mutter auf dem französischen Schiff, das sie nach China brachte, gegessen hatten. Sie fuhren dritter Klasse, doch das Essen war reichlich, so reichlich, dass sie in ihrer ersten Woche auf See von nichts anderem reden konnten. Wie viel es zu essen gab. Wie oft sie aßen. Wie bald sie wieder so viel essen würden. Nach drei Wochen auf dem Schiff hatte sich ihre Ausgezehrtheit in sonnengebräuntes Fleisch verwandelt. Seine Mutter sah zehn Jahre jünger aus. Seine sechzehnjährige Schwester Judy war plötzlich hübsch.
Bis dahin war er ein linkisches Kind gewesen. Flog ein Ball in seine Richtung, traf er ihn unweigerlich ins Gesicht, als leite Bosheit das runde Ding oder ein Magneteisen in seinem Schädel, so dass er mit vierzehn von harten und weichen Baseballbällen, von Footballbällen, Basketbällen, Fußbällen, Strandbällen, Tennisbällen, ja selbst von Pingpongbällen schmerzlich getroffen worden war; sobald sie Gelegenheit dazu bekamen, hatten die Bälle ihn angegriffen und damit bei seinen Spielkameraden Wut und Spott ausgelöst.
Er war ein eigensinniges, verträumtes, in sich gekehrtes Kind und liebte Bücher über die Hunde und Katzen und Pferde, die er nicht haben konnte. Seine Kosetiere waren zwei Goldfische, Mink und Mank. Seine Mutter schärfte ihm immer wieder ein, sie nicht zu überfüttern, doch das war das Einzige, was er für sie tun konnte. Eines Morgens schwammen sie mit dem Bauch nach oben in ihrem winzigen Glas. Er ersetzte sie nicht. Er las lieber Burschi, ein Hund oder das Dschungelbuch. Ihm schienen Wölfe die liebevolleren, aufmerksameren Eltern. In früher Kindheit war er seiner Mutter eng verbunden gewesen, doch der Verlust ihres behaglichen Heims, des Autos, der Möbel, des Ansehens versetzte sie in Apathie. Sie führte nur noch Selbstgespräche, wenn sie ohne Unterlass die enge, überfüllte Wohnung putzte. Obwohl sie sich nun unablässig über China beklagte, hatte sie hier einen Hausdiener und einen Koch, und jeden Tag stattete sie anderen verheirateten jüdischen Damen Besuche ab.
Daniels Familie zog in ein sogenanntes Hofhaus in Hongkew, einem armen, überbevölkerten, aber faszinierenden nordöstlichen Vorort, der auf drei Seiten von Wasser umgeben war. Sie wohnten dort, weil die Mieten und die Lebensmittel nur halb so teuer waren wie im International Settlement oder in der Französischen Konzession. Ihr Haus gehörte zu den rasch hochgezogenen Neubauten der Gegend, stand im Schutze einer Mauer mit einem Tor und war feuchtkalt, nur beheizt von kleinen, stinkenden Kohleöfen.
Daniel wurde auf die amerikanische Schule im International Settlement geschickt, aber der tägliche Unterricht dauerte nicht lange und ließ ihm viel Zeit, durch die Straßen zu stromern. Bei einem Straßenhändler kaufte er sich getragene chinesische Kleidungsstücke, die er in der Mauer verbarg. Mit seinem schwarzen Haar, der tiefgebräunten Haut und den dunkelblauen Augen sah er nicht chinesisch aus, konnte aber als mandschurisch durchgehen. Wäre er in europäischen Kleidern mit seiner Armbanduhr herumgelaufen, man hätte ihn überfallen und ausgeraubt. In seinem selbsterdachten Abenteuer blühte er auf vor neuem Selbstvertrauen. Er stellte sich vor, wie die Jungens aus seinem alten Viertel ihn beneideten und wie sie bedauerten, ihn nicht in ihre Baseballmannschaft gewählt und ihn sogar vom Brennball ausgeschlossen zu haben. Die Straßen waren verstopft und glitzerten von riesigen, vergoldeten Schildern, leuchtenden Neon reklamen und gewaltigen grellbunten Wandbildern, die einheimische Produkte anpriesen. Er wuchs rasch und hatte immer Hunger, aber es gab viel zu essen, und alles billig: Nudeln, gefülltes Pao, Tangtuanklöße, süße Mandelsuppe, süße oder salzige Kuchen, Salzfisch und Kohl. Er liebte die Dampfer und die Sampans, die Hausboote mit den aufgemalten Augen im brackigen Hafen.
Auf der amerikanischen Schule wurde kein Chinesisch unterrichtet. Wenige Eltern sprachen Chinesisch oder verstanden es. Onkel Nat sagte, auf den anderen internationalen Schulen sei es das Gleiche. Als sein Onkel sah, dass er sich dafür interessierte, besorgte er Daniel zwei Lehrer, einen für umgangssprachlichen Wu-Dialekt und den anderen zum Lesen und Schreiben der Schriftzeichen. Er lernte bei seinen beiden chinesischen Lehrern weitaus eifriger als bei seinen Lehrern in der amerikanischen Schule, weil er das, was er lernte, sofort auf der Straße anwenden konnte, dort, wo er immer sein wollte.
»Die Europäer und die Amerikaner verhalten sich wie Schafsköpfe«, sagte Onkel Nat und wies darauf hin, dass die Amerikaner keine Chinesen in ihren Country Club ließen. »Es gibt in dieser Welt niemanden, auf den man sich absolut verlassen kann. Man kommt in anderer Leute Land, wo man die Chance hat, in Sicherheit zu sein, ein gutes Leben zu führen, also lernt man ihre Sitten und spricht ihre Sprache, damit man sie nicht mehr kränkt als nötig. Wenn man in den Wind spuckt, fliegt’s einem ins Gesicht zurück. Kapiert?«
Onkel Nat war ein grauhaariger Mann ähnlich wie sein Vater, aber er stand anders da, nicht krumm und gebeugt. Er hielt sehr auf äußere Form. Daniel fühlte sich bei ihm wohler als bei seinem Vater. Seine Eltern redeten ununterbrochen von Haskel, der im City College Einser sammelte. Der Erstgeborene, der gute Sohn.
Schanghai wimmelte von Menschen, vier Millionen Chinesen und dazu hunderttausend Ausländer, es gab moderne Wolkenkratzer, tipptopp uniformierte Sikhs auf kleinen Zementpodesten, die den Verkehr regelten, fünf Universitäten, zahlreiche gelehrte und wissenschaftliche Einrichtungen, Nobelhotels und exklusive Privatclubs; doch für die meisten Chinesen gab es nur Armut und einen schnellen oder langsamen Tod. Morgens lagen Leichen auf seinem Schulweg. Überall schüttelten verkrüppelte Bettler ihre Büchsen. Schanghai brodelte von Krankheiten, von politischen Unruhen und Morden. Er sah zu, wie Gefangene für politische oder ganz gewöhnliche Verbrechen geköpft oder garrottiert wurden, öffentliche Hinrichtungen, wo er in der Menge stand und staunend mit ansah, wie ein Leben ausgelöscht wurde, sich aber in Acht nahm, so gleichmütig dreinzuschauen wie alle anderen, um keinen Ärger zu bekommen.
Dann fing er sich eine Art Paratyphus ein, der so mächtige Darmkrämpfe auslöste, dass er sehen konnte, wie sein Bauch davon wogte, während er ächzend in hohem Fieber lag. Nach diesem ersten heftigen Anfall kehrte die Krankheit jeden Monat wieder; schließlich schien er sie auszuwachsen. Er aß weiterhin Gerichte von Garküchen und Straßenverkäufern. Er schoss zu einem Meter achtzig auf. Mit sechzehn kaufte er sich seine erste Sexualerfahrung im Rotlichtdistrikt der Kiangsestraße, und im Gegensatz zu dem, was seine Lektüre ihn glauben gemacht hatte, fand er sie nicht widerwärtig oder abstumpfend, sondern reizvoll, wenn auch unvollständig, da ohne jeden Zusammenhang.
Nach diesen anfänglichen Sexualerlebnissen betrachtete er Frauen mit großem Interesse. Er versuchte, sich nichts anmerken zu lassen, aber offenbar bemerkte die Frau eines Arztes aus Berlin sein Interesse. Sie verführte ihn, eine Aufgabe, die ihr keine Schwierigkeiten bereitete, sobald er begriffen hatte, dass ihm angeboten wurde, was er am meisten begehrte. Prompt verliebte er sich in sie. Ach, das war es also, worauf er gewartet hatte, was er erwartet hatte. Da war zum einen der Sex und da war zum anderen die Schwärmerei, aber wenn er beides in einer bestimmten Frau zusammenfügte, entstand ein unwiderstehliches neues Spiel, eines, das bis in sein erstes Jahr an der Schanghai-Universität andauerte, wo er sich mit zwei chinesischen Jungen anfreundete und in ihre Elternhäuser eingeladen wurde.
Die japanische Invasionsarmee näherte sich der Stadt. Die chinesischen Truppen verbrannten einen Großteil von Hongkew, die Japaner zerbombten den Rest, und die Balabans zogen widerwillig in kleinere, wesentlich teurere möblierte Zimmer in der Französischen Konzession, bis rasch wieder Hofhäuser hochgezogen wurden. Häufige Bombenangriffe erschütterten den Boden, zerstörten ganze Wohnblocks. Der Bahnhof wurde von Bomben getroffen, und es gab unzählige Tote. 1938 war Schanghai vom Festland abgeschnitten und warf weniger Gewinne ab. Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich kamen in Scharen und brachten haarsträubende Berichte mit. Daniels Eltern wurden zunehmend nervös. Es war an der Zeit, fanden sie, in die Bronx zurückzukehren.
Er verließ China unter Protest und weinte ganz offen. Judy war glücklich. Sie wollte das normale Leben eines amerikanischen Mädchens, sagte sie laut. Daniel hatte kein Verlangen nach dem normalen Leben eines amerikanischen Jungen, das er sich als Titelseite der Saturday Evening Post vorstellte, ein sommersprossiger Dorfbub mit einer Angel. Genauso wenig sehnte er sich nach den Prügeleien mit italienischen und polnischen Bengels auf den umkämpften Straßen der Bronx.
Er besuchte das City College. Der politische Umbruch faszinierte ihn, wie es die Straßen von Schanghai getan hatten. Er ging zu den Versammlungen von Splittergruppen, schlenderte durch den Basar der Ideen, konnte sich mit keiner identifizieren, war aber guter Hoffnung, dass irgendeine Ideologie ihn zum Engagement verlocken würde. Er wohnte zu Hause und fuhr täglich zum College, obwohl er bei seinen Eltern, denen er sich seit Jahren nicht mehr anvertraut hatte, keine Ruhe fand. Er sah sie als enge, naive, liebe, aber beschränkte Menschen. Sie hatten sich den Kopf stets über Überlebensstrategien zerbrechen müssen. Er versprach sich ganz andere Optionen. Er war ungern mit Haskel zusammen, der jetzt in den klinischen Semestern war und von seiner Mutter bedient wurde wie von einer Magd. Jeder Bruder fand den anderen verachtenswert.
Dienstags und mittwochs fuhr er mit der Stadtbahn zur Upper West Side, wo es eine kleine chinesische Gemeinde von der Mittelküste gab. Dort nahm er Unterricht bei dem Besitzer des Shanghai Star, in einem kleinen Büro über dem Restaurant. Dienstags war die Umgangssprache dran. Pao Chi war ein kahler, großgewachsener und schwergewichtiger Mann, doch seine Stimme war sanft und melodiös. Er redete gern über den Taoismus. Mittwochs studierten sie die Schriftzeichen. Gleich nach dem amerikanischen Neujahr erlaubte ihm Mr. Pao, die Kalligrafie auf einer Speisekarte zu machen.
Seine Familie missbilligte seine Vernarrtheit in alles Chinesische. Sein Vater, seine Mutter und seine Schwester Judy hatten in China gelebt wie eine Katzenfamilie, die auf einem Baumstamm in einem Bach hockt und bemüht ist, nicht nass zu werden, nicht in das vorbeifließende Leben hineingezogen zu werden. Daniel hatte vor, zu seinem Onkel Nat zurückzukehren, der China so liebte wie er. Das war der Traum, nach dem er sich verzehrte.
Er verliebte sich in eine Trotzkistin und gab sich große Mühe, auch Trotzkist zu werden, denn ihr Körper war seidenweich, und sie hatte ein warmes, aufreizendes Lachen und einen klaren, nüchternen Verstand, mit dem er gern die Klingen kreuzte. Sie genoss die Streitgespräche nicht so sehr wie er und gab ihn für einen auf, dessen politische Überzeugungen stärker waren und dessen Verlangen ebenso stark schien. Er erfuhr, dass die Liebe für ihn wie ein Feuerwerk war, Hitze und Licht, doch wenig Schaden. Sein Verlangen ließ nicht nach, wenn auch oft seine Verliebtheit. Er verliebte sich in Belanglosigkeiten, ein Lachen, die Form eines Beines, ein Lächeln; kein Wunder, dass sein Interesse rasch verflog.
Er freundete sich mit seinem Vetter Seymour an, der ein Jahr älter und Kommunist war und sich bemühte, ihn anzuwerben. »Du bist ein Dilettant«, sagte Seymour zu ihm. »Nichts bewegt dich, oder alles bewegt dich.«
Mr. Pao hielt das für eine annehmbare Daseinsweise. »Das höchst Gute gleicht dem Wasser. Das Wasser nützt den zehntausend Wesen und streitet nicht; es fließt selbst dahin, wo kein Mensch sein mag. Darum ist es nahe dem Weg«, zitierte Pao aus dem Taoteking.
Daniel war sich uneins, ob er wirklich so wässerig bleiben wollte. Er versuchte, sich wundersame Leidenschaften vorzustellen, die ihn länger als zwei Wochen beschäftigen würden. Nur die Frau des Arztes hatte sein Interesse wach gehalten, doch es hieß, sie sei mit einem Engländer durchgebrannt, der angeblich Geheimagent war und sich dann als Hochstapler mit einem Berg Schulden entpuppte. Onkel Nats Briefe waren voll von Katastrophen unbegreiflichen Ausmaßes, Menschen fielen wie welkes Laub und gaben einen blutigen Kompost ab, während der Krieg unaufhörlich weiterging. Die Japaner kontrollierten nun die Stadt. Onkel Nat beschrieb ein letztes Kontingent von tausend polnischen Juden, die auf der Suche nach Sicherheit bis dorthin geirrt waren. Viele Flüchtlinge saßen in Schanghai fest, das keine Visa verlangte, keine Pässe, keine Papiere, keine Zeugnisse über Unbescholtenheit und vergangene oder gegenwärtige Reichtümer. Der Krieg bescherte allen Armut, berichtete Onkel Nat. Bald würde er nur noch ein yang kueitze sein, das Schimpfwort für mittellose Ausländer. In Hongkew, schrieb Onkel Nat, gab es inmitten der Ruinen und Schutthalden ein Kammerorchester, mehrere Theater und einen hin- und herwogenden Krieg kultureller Versnobtheit zwischen den Juden aus Wien und den Juden aus Berlin. Daniel wurde von Heimweh gepackt. Seine Eltern sangen die Litanei über die Klugheit ihrer Abreise. Nur sein Lehrer Pao Chi teilte seine Faszination für das, was in China vorging.
Daniel arbeitete als Platzanweiser in einem Kino. Im Sommer kellnerte er in den Catskills. Ein einziges Mal drang seine Chinaleidenschaft in sein College-Leben ein, als er nämlich gebeten wurde, im Progressive Club einen Vortrag über die Lage in China zu halten. Seine Rede war kein Erfolg, denn sein Selbstvertrauen, in Einzelbegegnungen oft das eines Löwen, schwand beim Anblick der ausdruckslosen, anonymen Gesichter. Nach dem Examen war die einzige Arbeit, die er finden konnte, das Zustellen von Gerichtsvorladungen.
Trotzdem zahlte sich sein missratener Vortrag doch noch aus, denn sein Volkswirtschaftsdozent hatte seinen Namen jemandem von der Marine genannt, der nun im Frühjahr 1941 anrief und fragte, ob er nicht vielleicht an einem Japanisch-Intensivkurs diesen Sommer in Harvard interessiert sei. Die Marine brauchte japanischsprachige Offiziere und bot entsprechende Schulung an. Die meisten Studenten konnten schon etwas Japanisch, aber andere, so wie er selbst, wurden wegen ihrer Chinesischkenntnisse angeworben. Daniel hielt das im Stillen für ein Beispiel weißer Dummheit, denn obwohl die Schriftsprachen viele Zeichen gemeinsam hatten, waren die gesprochenen Sprachen weniger miteinander verwandt als Norwegisch mit Italienisch. Das Vorgehen der Marine beruhte auf der typisch amerikanischen Haltung, wenn ein Mensch schon eine dieser komischen Heidensprachen lernen konnte, warum dann nicht gleich noch eine?
Da er nicht zu seinem Onkel zurückkonnte, erschien ihm dies verlockender als der einzige andere Weg, den er vor sich sah, nämlich weiterhin Gerichtsvorladungen für die Binokelfreunde seines Vaters zuzustellen. Er kam sich vor, als sei er, Daniel, der Bedrücker all der kleinen Ganoven, der Ehemänner auf Abwegen, der unglücklichen Zeugen und der ertappten Buchmacher. Zweimal hatten die Vorgeladenen schon nach ihm geschlagen.
Also auf nach Harvard. Für einen Jungen vom City College war das ein Blick in das Leben der oberen fünf Prozent. Seine Eltern sprudelten vor Freude: Judy heiratete einen netten jüdischen Zahnarzt, Haskel beendete sein Medizinstudium, und nun ging ihr Jüngster nach Harvard. Er wusste, ein Intensivkurs am Yenching-Institut war nicht ganz das, was man unter »nach Harvard gehen« verstand, aber weitaus besser, als das Pflaster der Bronx zu treten und nach Leuten zu suchen, die nicht von ihm gefunden werden wollten.
Seine Tage in Harvard waren angenehm. Er begann in der Anfängerklasse, aber sobald er sich hineingekniet hatte, stieg er rasch auf. Er machte seine Zimmergenossen wahnsinnig, denn er bestand darauf, vom Aufwachen bis zum Einschlafen nur Japanisch zu sprechen. Bis zum Oktober hatte er deutliche Fortschritte gemacht und war hochgestuft worden. Er machte lange Spaziergänge am Charles River, durch Cambridge, zum Mount-Auburn-Friedhof. Sonntagabends ging er in Boston mit Kameraden aus seinem Kurs chinesisch essen und gab damit an, aus der chinesischen Speisekarte zu bestellen. Viele der Restaurants waren natürlich kantonesisch, was er nicht sprechen konnte. Eines Tages würde er es lernen: nach dem Krieg, wenn er nach China zurückkehren konnte. Aber wenn er schon nicht nach China konnte, dann war Boston gar nicht so übel. Seine Zimmergenossen machten sich über ihn lustig, weil ihm Boston lieber war als New York, aber mit New York verband er nicht Manhattan, sondern die ärmeren Quartiere der Bronx. Er konzentrierte sich auf den anspruchsvollen und intensiven Unterricht. Seine Arbeitstage waren zu lang für Liebesgeschichten. Obwohl er mit stechendem, aussichtslosem Interesse den Radcliffe-Girls auf ihren Fahrrädern nachsah, fand er sein Leben kultiviert und merkte, er war glücklich. Endlich rief etwas anderes als eine Verliebtheit seine Kräfte wach. Er war nicht mehr nur fließendes Wasser.