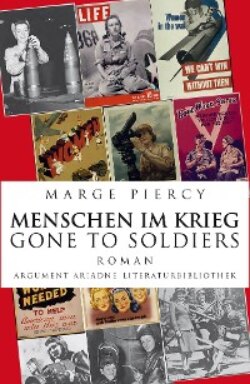Читать книгу Menschen im Krieg – Gone to Soldiers - Marge Piercy - Страница 9
Abra 1 Abra macht sich auf
ОглавлениеSeit zweihundert Jahren fuhren die Männer in Abras Familie aus Bath, Maine, zur See. Abra fuhr nach New York.
Mit dreiundzwanzig meinte Abra, ihr richtiges Leben habe damals im September 1938 begonnen. Da hatte sie, mit neunzehn, vom Smith College ans Barnard gewechselt und endlich den Sprung nach Manhattan geschafft, dem glitzernden Land Oz ihrer Kindheit, wo sie ihrer Überzeugung nach immer hingehört hatte. Letztes Jahr war sie als Doktorandin zur Graduate School der Columbia in der Fachrichtung Politische Wissenschaften zugelassen worden. Abra hielt sich nicht für die geborene Gelehrte und konnte sich nicht recht vorstellen, selber zu unterrichten, doch zum einen genügte ihr die Graduate School an und für sich – Politik war schließlich das aufregendste Thema der Welt –, zum anderen waren die Studierenden in ihrer Fachschaft zu neunzig Prozent Männer, die Lehrenden zu hundert Prozent. Abra, die mit Brüdern aufgewachsen war, fand die Situation, die einzige Frau im Raum zu sein, völlig normal. Unter Männern lebte sie auf.
Sie hatte sich ihrer Jungfernschaft während ihres neunzehnten Sommers entledigt, draußen auf Popham Point, wo ihre Familie alljährlich den Sommer verbrachte, mit einem goldigen Jungen aus dem Ort, der inzwischen Hummerfischer war. Er hatte sie heiraten wollen, und sie hatte erkannt, dass sie, um gute Miene zum bösen Spiel zu machen, zum Schein einwilligen und vorgeben musste, die Heirat in Erwägung zu ziehen – oh, natürlich in ferner Zukunft, nach ihrem Examen. Abra war im gleichen Herbst ans Barnard gewechselt, und sie hatte nicht die Absicht, nach Bath zurückzukehren, außer natürlich in den Ferien, in denen John für zwei weitere Jahre ihre erfrischende Sommerromanze blieb. Zu einer Romanze gehörte für Abra guter, gesunder, akrobatischer Sex.
Nun war sie hier, dreiundzwanzig, mit quirligem Freundeskreis und eigener Wohnung im Village in der Bank Street, gemütlich, wenn auch ohne Fahrstuhl, einem guten Verhältnis zu ihrem Doktorvater Professor Blumenthal und einer stimulierenden Assistenzstelle bei seinem Freund Oscar Kahan im Fachbereich Soziologie. Ihre Familie war entsetzt, dass sie ihren Doktor machte; in ihren Augen war das unweiblich und würde zwangsläufig dazu führen, dass aus ihr eine verschmähte und bemitleidenswerte alte Jungfer wurde. Man verglich sie mit einer Abigail schrecklichen Angedenkens, die ein Blaustrumpf und eine leidenschaftliche Gegnerin der Sklaverei gewesen war und die tatsächlich einmal eine öffentliche Rede gehalten und mit dieser Schamlosigkeit Schande über die Familie gebracht hatte, woraufhin ihr Vater sie fünf Jahre lang eingeschlossen hatte. Abra, die gerade im Begriff war, ihren sechsten Heiratsantrag abzublocken, bezweifelte, dass sie auf einen einsamen Lebensabend zusteuerte. Der neueste Antrag kam von einem jungen Mann, den sie beim Tennis kennengelernt hatte und mit dem sie sich seit zwei Monaten traf.
»Was soll das, Hank? Willst du mich zu einer ehrbaren Frau machen oder irgend so ein Unsinn?«
Er saß auf dem kleinen Windsor-Stuhl vor ihrem weiß getünchten Backsteinkamin, in dem ein paar Birkenscheite von zu Hause lustig flackerten. Der Stuhl war zu klein für ihn und gab ihm ein grashüpferartiges Aussehen. »Ich glaube, du wirst mir eine gute Frau sein, Scotty. Deine Wildheit ist Jugend und Ausgelassenheit, ein Fohlen, das herumtollt. Du wirst zur Ruhe kommen.«
Ein Fohlen, das noch nicht zugeritten worden ist, meint er, dachte Abra und lächelte süß. »Meinst du, es ist die passende Zeit, um sich zur Ruhe zu setzen? Überall um uns herum geht die Welt zu Bruch.«
»Umso mehr Grund, ein Heim zu gründen. Ich glaube zwar, dass nicht einmal dieser Wahnsinnige, dieser Roosevelt, vorhat, uns in den Krieg zu führen, um Englands Kastanien aus dem Feuer zu holen, aber trotzdem kann ich jeden Moment einberufen werden.«
Stoßt ins Horn, dachte Abra. Ich soll mich deinen Familienvorstellungen opfern, weil du vielleicht als Offizier einberufen wirst? »Ich gäbe eine miserable Frau ab. Ich bin mit meiner eigenen Arbeit beschäftigt und habe nicht vor, sie zu vernachlässigen.«
»Bist du nicht schon lange genug zur Schule gegangen? Du bist eine richtige Frau, Scotty, und es wird Zeit für dich, wie eine zu leben.«
»Mir liegt sehr viel an dem, was ich tue.« Sie hörte sich anders mit ihm reden, alte Melodien, alte Texte. »Ich finde meinen Doktorvater Professor Blumenthal faszinierend, und mein Thema interessiert mich.« Ihr war sehr wohl bewusst, dass ihre Doktorarbeit über die Gewerkschaft der Damenbekleidungsindustrie Hank nicht interessierte. »Ich habe eine Stellung bei Professor Kahan –«
Abscheu huschte über Hanks blonde, adlernasige Züge, und er spannte erst den rechten, dann den linken Arm, eine nervöse Geste, die automatisch schien. »Krauts und obendrein Juden, Scotty. Also wirklich!«
»Professor Blumenthal ist ein in Deutschland geborener Jude. Wie zum Beispiel Marx.«
»Eben. Ich begreife nicht, wieso deine Familie das duldet.«
Abra betrachtete ihn und überlegte, welchen Grad an Frechheit sie sich gestatten würde. Sie hatte sich das selber eingebrockt, indem sie sich mit jemandem aus ihren eigenen Kreisen eingelassen hatte. Das hatte sie bisher noch nie getan, und sie beschloss, es in Zukunft zu vermeiden. Der einzige Vorteil, den sie entdecken konnte, war, dass sie den weiteren Verlauf des Gesprächs kannte, bevor dessen öde Vorhersehbarkeit von ihnen durchgespielt worden war. Sie stand auf, ging zur Wohnungstür, öffnete sie und stellte sich daneben.
Hank schaute sie verdutzt an. »Jemand draußen?«
»Du gleich, hoffe ich. Dein Mantel hängt am Haken. Hilf dir bitte selbst hinein.«
»Was soll das, Scotty? Das ist doch albern. Du kannst mir keinen Korb geben. Und nicht so.«
»Irrtum. Ich bin an Heirat nicht besonders interessiert. Und du wärst der Letzte, der in Betracht kommt.«
»Scotty, du weißt doch, dass wir uns lieben.«
In ihr blitzte Zorn über sich selber auf, sich in diese Bredouille gebracht zu haben. Sie musste das Tennisspielen aufgeben. Sie traf auf den Plätzen die falsche Sorte Männer. Die Männer, die sie auf Kundgebungen kennenlernte, waren eher ihr Fall. »Ich glaube, wir haben beide einen kleinen Fehler gemacht, der leicht zu beheben ist. Vergiss nicht deinen Hut.«
Langsam ging er rückwärts hinaus, Hut und Mantel immer noch in der Hand, und starrte sie fassungslos an. Dann rannte er die Treppen hinunter, und wenn die Haustür zuknallbar gewesen wäre, hätte er sie zugeknallt. Sie schloss sich jedoch in ihrem eigenen gemächlichen Tempo, mit einem pneumatischen Seufzer.
Abra dachte über die Ruine ihres Sonntags nach. Sie prüfte die Wasser ihrer Seele und fand sie nur lauwarm. Ein guter Tag, um zu Hause zu bleiben und etwas mehr an ihrer Doktorarbeit zu tun, als sie nur in der Öffentlichkeit zu erwähnen. Ihre Seminare würden bald abgeschlossen sein, aber sie hatte sich noch nicht ernsthaft ans Schreiben begeben. Sie sah sich um in ihrer kleinen, leicht künstlerisch angehauchten Bude mit der Hopi-Vase und der Mola aus Guatemala und der geschnitzten afrikanischen Gazelle, dunkler als die Nacht, inmitten leuchtend bunter Chintzkissen und zweihundert Jahre alter Möbelstücke aus der Familienrumpelkammer. Hank gehörte hier nicht her. Sie ja.
Die Ehe war für Abra etwas, das ihr in einem bestimmten Alter mit Sicherheit zufallen würde, so wie sie mit einundzwanzig ihr kleines Legat von ihrem Großvater Scott geerbt hatte und wie sie eines Tages von ihrer Großmutter Woolrich die Stühle mit den Leitersprossenlehnen erben würde, die sie dann irgendwo hinstellen musste, nebst einem weiteren Legat von dieser Familienseite mit sechsundzwanzig. Sie war der Überzeugung, dass die meisten ihrer Freundinnen aus dem College geheiratet hatten, um sich einen Platz zu erobern, eine Identität, doch dass sie sich ihren eigenen Platz schaffen konnte.
Sie verspürte kein Verlangen danach, reich zu sein; ihr Zweig der Familie hatte – zumindest seit dem Untergang ihrer Reederei – keinen Wert auf Geld um des Geldes willen gelegt, anders als ihr Onkel Frederick Woolrich, den sie immer gemocht hatte mit seiner Energie und seinem donnernden Gehabe, als gelte es, einen Sturm zu übertönen. Sie hatte Onkel Frederick im Verdacht, im Bett eine große Nummer zu sein, aber Inzest gehörte nicht zu ihren Lastern. Ganz im Gegenteil. Sie hätte Hank höflich sagen sollen, sie habe eine exogame Persönlichkeitsstruktur. Sie flog selten auf andere Blonde, und mit Hank war das Feuer einfach nicht angegangen. Ein Monat mit ihm war länger als ein Jahr mit Slim, dem schwarzen Saxophonspieler, obwohl sie sich in Wahrheit nur acht Monate lang hin und wieder mit ihm getroffen hatte. Slim lebte mit einer Frau zusammen, die das mit Abra irgendwann spitzbekommen hatte. Schade. Vor New York waren die einzigen Nichtweißen, die sie je zu Gesicht bekommen hatte, zwei ortsansässige indianische Fischer gewesen, doch Abra fand, dass sie dem liberalen Erbe der skandalösen Urgroßtante Abigail gerecht werden musste.
Abra war in Bath aufgewachsen, in einer Familie, die dort beste Beziehungen unterhielt und wohlbekannt war, wenn auch längst nicht mehr so wohlhabend wie noch vor ein paar Generationen. Es gab eine kleine Bucht, die nach der Familie ihres Vaters hieß (wo sich die eingegangene Reederei befunden hatte), und eine Insel, die nach der Familie ihrer Mutter hieß. Sie war mit ihren beiden Brüdern in einem adretten weißen neoklassischen Haus mit Kuppel in der Washington Street aufgewachsen. Die Porträts an den Wänden zeigten nicht die Ahnen, sondern ihre Schiffe: Steife, förmliche Ölgemälde der Ebeneezer Scott, der General Abraham Woolrich unter unglaubwürdig vollen Segeln auf statischen Wellen wechselten sich ab mit naiven Darstellungen berühmter Schiffbrüche, die Mary Frances sinkt mit Mann und Maus vor Woolrich Island. Ahnenporträts schienen entbehrlich, denn ihr war immer gesagt worden, sie habe Großmutter Abra Scotts Nase und Großvater Timothys Augen. Sie hatte sich in die Familienerwartungen weniger hineingestellt als eingebettet empfunden, das Leben vor ihr ein regelmäßiges, vieljähriges Beet, das nur gelegentlich gegossen werden musste, bepflanzt mit Everetts und Timothys und Toms und Mary Franceses und Abras.
Die Sommer waren die freien und herrlichen Zeiten gewesen, immer auf dem Wasser – im Segelboot durch das Labyrinth der Wasserläufe und Nebenarme und Buchten des Kennebec gleiten oder im Motorboot hindurchtuckern oder sich auf den (für Maine) ungewöhnlichen Sandstränden ihrer Halbinsel aalen. Sie hatten für ihre Spiele sogar ein Fort aus dem Bürgerkrieg gehabt, mit Wendeltreppen und Verliesen und Wehrgängen. Sie kletterten über die Felsen, sie suchten Venusmuscheln, sie segelten mit ihren Vettern in Catbooten um die Wette. Die Lücke von zwei Jahren zwischen Everett, genannt Ready, und Abra, die in Bath während des Schuljahres weit klaffte, schloss sich im Sommerhaus.
Jeden Sommer kamen die New Yorker auf die Halbinsel, mit ihrem anderen Tonfall, anderen Werten, anderer Kleidung und anderen Haltungen; mit ihnen kam die Freiheit, die ihr zur Sucht wurde. In Bath stand sie immer unter jemandes erwartungsvoller oder ermahnender Beobachtung, aber draußen in dem einfacheren, schlichten Haus auf dem Hügel in Popham konnte sie der Überwachung jederzeit entfliehen. Einfach, indem sie zu einer anderen Insel oder außer Sichtweite segelte. Die Woolrichs hatten ihren Familiensitz auf einer Insel, die von der breiten Veranda ihrer Familie aus zu sehen war, und sie konnte immer sagen, sie segelte zu ihrem Onkel. Wenn das Wetter das Segeln verbot, dann gab es die Wälder voll Birken, Eichen und Tannen, die Marschen, die feuchtkalten Sümpfe, wo sie sich verlieren konnte. Abgeschiedenheit war nur einen Hügel weit fort. Die gesellschaftlichen Regeln, die die Tiefe und Häufigkeit aller Kontakte in Bath festschrieben, zerfaserten in der Sommerwelt aus Tanne und Fels, aus Nebel, der zauberisch und kühl hereintrieb, der blendenden Sonne, dem Wind, der anschwoll, bis sie sich selbst als eine reale Person empfinden konnte, mit einem Willen und einer Zukunft, möglicherweise ebenso stürmisch und wechselhaft wie die kalte See, die sie belebte. Sie konnte nicht zur See fahren, wie Ready es tun würde, also wählte sie anstelle der See eine Insel, die ihr ebenso frei und reich vorkam: Manhattan.
Sie aß in einem Nedick’s, das auf ihrem Weg zu der Wohltätigkeitsveranstaltung für den tschechischen Widerstand lag. An der Tür des gemieteten Saales traf sie zwei Freundinnen, Djika und Karen Sue. Djika war die einzige andere Doktorandin in ihrem Fachbereich. Karen Sue hatte in Memphis die gelangweilte Südstaatenschöne abgegeben, bevor sie eine unwürdige Ehe einging, die ihr Vater annullieren ließ; eine Erbschaft hielt sie in New York, wo sie das Leben lebendiger fand. Sie hatte eine große Wohnung auf dem Riverside Drive, wo sie oft Partys mit den Politikern aus ihrer Bekanntschaft veranstaltete.
Es war ein zusammengewürfelter Abend. Die Kommunisten durften zu ihren Veranstaltungen aufrufen, dann kamen Folksänger, Theaterleute, eine Menge tschechische Volkschöre und -sänger, viele zündende Reden über die tapferen Partisanen. Abra betrachtete den behaarten Jack Covington oben auf dem Podium, der sie einmal besprungen und sich in aller Eile befriedigt hatte und danach heruntergerollt war, dann am nächsten Morgen bedient werden wollte und sie nach einer Flasche Orangensaft, einem Paket Wheaties und Kaffeesahne losschickte. Diese eine Nacht hatte sie mit ihm verbracht, nachdem Hitlers Angriff auf die Sowjetunion die Volksfront wiederhergestellt hatte und sie und ihre interventionistischen Freunde wieder mit den Kommunisten redeten. Seitdem war sie bestrebt, eine Wiederholung zu vermeiden, auch wenn er bei ihrem Anblick jedes Mal das weite, zahnige Grinsen des Kühlergrills eines fabrikneuen Lastwagens aufsetzte und geradewegs auf sie zuging. Sie fand es enttäuschend, dass sich ein so männlich aussehender ehemaliger Hafenarbeiter im Bett als so dürftig erwies. Schmunzelnd konstatierte sie, dass sie seine Reden nun weniger mitreißend fand als zuvor. Nur gut, dass die allermeisten Leute wenig über die sexuellen Gepflogenheiten ihrer Politiker wussten.
»Ach, Jack schon wieder. Der Junge ist doch ein hohlköpfiger Langweiler«, nölte Karen Sue in ihrem zerdehnten Südstaatendialekt. Abra spekulierte, ob diese Ernüchterung auf ähnlicher Erfahrung beruhte, doch sie hatte nicht die Absicht, ihr Geschlechtsleben mit Karen Sue zu besprechen. Abra hielt sehr darauf, sich gentlemanlike zu geben.
»Na, hast du schon angefangen, für den großen Mann zu arbeiten?«, fragte Djika und beugte sich vor Karen Sue.
»Morgen ist der Erste des Monats, und da wird Professor Kahan mit mir zu arbeiten anfangen.«
»Ist doch absurd«, sagte Djika säuerlich, vielleicht auf die Anstellung eifersüchtig. »Du fängst am ersten Dezember an, und dann brichst du ab wegen der Ferien. Warum nicht bis zum ersten Januar warten?«
»Vielleicht macht ihr Professor die Ferien nicht mit«, sagte Karen Sue. »Schindet seine Assistenten zweiundfünfzig Wochen im Jahr zu Tode.«
»Ich möchte lieber so bald wie möglich die Arbeit kennenlernen«, sagte Abra. »Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen.« Sie war Oscar Kahan auf einer Tagung über den Faschismus vorgestellt worden, wo er einen – wie sie fand – redegewandten Vortrag gehalten hatte über die Spannungen zwischen der kleinbürgerlichen Basis des deutschen Faschismus und der wachsenden Freundschaft der Nazipartei mit der deutschen Industrieelite. Ihr eigener Doktorvater, Professor Blumenthal, war deutscher Flüchtling und kam aus der Frankfurter Schule. Kahan war einer der wenigen in Amerika geborenen Redner auf der Tagung, der Anspruchsvolleres zu bieten hatte. Und so hatte sie sich sehr gefreut, als Blumenthal sie Kahan empfahl.
»Ist er verheiratet, mein süßes Kind?«, fragte Karen Sue. Das war immer ihre erste Frage.
»Ich lasse mich nie mit jemandem aus meinem Fachgebiet ein. Ich habe eine exogame Persönlichkeitsstruktur.« Sie war ihren Satz doch noch losgeworden.
»Worüber redet ihr dann?«, fragte Djika verächtlich. Sie hatte seit zwei Jahren eine unglückliche, aber erfüllende Affäre mit einem verheirateten Professor, Stanley Beaupere. Wo Abra mit Einzelheiten geizte, drängte Djika beiden die genauen Worte von Stanley Beaupere auf und erheischte intensive intellektuelle Betrachtung und Analyse. Während der Verschleiß seiner Ehe fortschritt, wurde sie an den fadenscheinigsten Stellen Stich um Stich für Djikas zweiköpfiges Publikum aufgetrennt.
Djika war Flüchtling aus Danzig, obwohl es schwerfiel, sie so zu sehen. Djika lebte ihrer Überzeugung nach zwar nahezu im Elend, war aber besser situiert als Abra, wenn auch nicht ganz so wohlsituiert wie Karen Sue. Djika vereinte inbrünstigen Katholizismus mit inbrünstigem Sozialismus, Ersterer wurde von ihrer Familie geteilt, Letzterer nicht.
Djika war gescheit, und Abra schätzte sie um der harten, europäisch geschulten Intelligenz willen, die zugleich zugespitzter und breiter fundiert schien, als Abra es von ihren Kollegen gewohnt war; außerdem fand sie es recht praktisch, mit der einzigen anderen Frau in ihrem Fachbereich auf freundschaftlichem Fuße zu stehen. Wenigstens brauchte sie nicht immer allein auf die Damentoilette zu verschwinden. Karen Sue hatte sie auf politischen Partys kennengelernt und erst nach einer Weile als die Gastgeberin erkannt. Karen Sue schien nicht nur sehr viel von Kleidern, Modeschöpfern, Schnitten und Stoffen zu verstehen, sie war auch die einzige Abra bekannte Frau, die jeden Morgen The Wall Street Journal las, in Aktien und Obligationen spekulierte und zu verstehen schien, was sie da tat. Der Kontrast zwischen Karen Sues oberflächlichem Gehabe der Südstaatenschönen und ihrem Geschäftssinn reizte Abra, die Sachverstand als solchen bewunderte. Sie hatte sogar John gerne zugehört, wenn er über Hummerfischerei sprach, bis ihr schließlich die interessanteren Fragen wichtiger wurden.
Sie dachte mehrere Male daran, Karen Sue und Djika von ihrem Heiratsantrag zu erzählen, hielt aber jedes Mal den Mund. Warum? Sie mochte das Thema von Hanks Antisemitismus nicht zur Sprache bringen. Sie musste unbedingt mit Djika auskommen, und sie hatte einen gewissen Verdacht, was deren Einstellungen betraf. Sie fand es auch nicht besonders geschmackvoll, sich über Hank lustig zu machen, der ihr schließlich, egal, wie sie seinen Heiratsantrag empfand, eine Ehre hatte erweisen wollen. Nach reiflicher Überlegung kam sie zu dem Schluss, dass es sich schickte, ihren Sonntag für sich zu behalten.
Abras erster Eindruck von Oscar Kahan war, dass er kleiner war, als sie von der Tagung erinnerte, und dass er durch seine Energie mehr Raum einzunehmen schien, als er wirklich tat. Als er nun aufstand, um ihr die Hand zu schütteln, war sein Händedruck fest und warm, die Haut rosig gesund, der Handrücken behaart.
»Wir führen eine Reihe von Umfragen unter Flüchtlingen durch, die in den Gewerkschaften oder sonst in Europa politisch aktiv waren. Ihr Deutsch ist ausreichend?«
»Ausreichend ist das richtige Wort.«
»Wir werden es ausprobieren. Ich brauche jemanden, um die Frauen zu befragen. Einige der Fragen, die ich gerne beantwortet hätte, sind recht persönlicher Natur, und ich vermute, wir kommen weiter, wenn eine Frau sie stellt.«
»Darf ich fragen, warum Sie nicht einen Flüchtling dazu anstellen? Ich meine, es freut mich sehr, dass Sie mir eine Chance geben wollen …«
Viel stärker als ihr eigener Professor Blumenthal mit der hochaufgeschossenen Regenschirmgestalt machte er den Eindruck, einen Körper zu haben. Oscar Kahan war breitschultrig, mittelgroß mit leichtem Bauch. Sein Haar war dicht, kräftig und lockig, recht lang getragen. Er lächelte ihr zu, verschmitzt, wie sie fand. »Eine gute Frage. Aber jeder Flüchtling, der kundig fragen könnte, hat gleichzeitig einen eigenen Standpunkt. Es handelt sich um eine knifflige politische Situation, und ich möchte niemanden die Fragen stellen lassen, der meint, die Antworten zu kennen. Ich brauche eine naive Fragestellerin – relativ naiv, meine ich. Unberührt ist vielleicht das bessere Wort – unberührt von eigenen Aktivitäten und Ansichten im Gewirr der deutschen Parteien vor und nach Beginn des Dritten Reiches.«
Er trug eine rote Krawatte, die so schief saß, als hätte ihn eben jemand damit erwürgen wollen. Sein Jackett war aus hochwertigem irischem Tweed, sah aber aus, als schleppte er eine halbe Bibliothek und seine Pausenbrote in den Taschen. Sie beschloss, Djika nach Klatsch und Tratsch über ihren neuen Dienstherrn auszufragen. Sie spürte in sich ungehemmte Neugier, wenn sie ihm in die glitzernden dunklen Augen sah, dunkler noch als sein Haar. »Wann soll ich anfangen?«
»Jetzt. Heute. Ich möchte, dass Sie sich diese Anleitung zum Vorgehen bei der Befragung durchlesen und dann mit Ihren Fragen zu mir zurückkommen.« Er wies auf sein Vorzimmer. »Lesen Sie da draußen und klopfen Sie an, wenn Sie fertig sind.«
Zwei Studenten saßen dort, eifrige junge Männer, die sie mit dem tragischen Blick jener bedachten, die auf das Objekt ihres Verlangens hatten warten müssen. Durch die Tür seines Zimmers hörte sie den lebhaften Tonfall seiner Stimme, tief, klar, ein wenig gehetzt, als er mit dem Ersten sprach. Zu dem verbliebenen Studenten gesellte sich ein weiterer. Von Zeit zu Zeit wurde sie eifersüchtig beäugt, denn sie schien hierher zu gehören. Die Tür ging auf, und der erste Student wurde hinauskomplimentiert, mit feuereifrigem Ernst noch über die Schulter redend.
Während sie die Anleitung las, die er ihr gegeben hatte, wohlgeordnet und noch als Richtlinie spannend, kamen und gingen die Studenten, männliche und weibliche, groß und klein, gut und ärmlich gekleidet, aber alle leidenschaftlich auf die Zeit ihres Helden erpicht. Auf jede und jeden richtete er für einen Moment den Strahl seiner Aufmerksamkeit, gab ihnen das Gefühl, klug und einmalig zu sein. Dies war seine Sprechstunde. Er widmete sich ihnen und stieß sie dann hinaus in die kalte, eintönige Welt. Sie stolperten davon, immer noch in das Gespräch vertieft, das in ihren Köpfen weiterging und in dem sie seine Aufmerksamkeit nicht für fünf Minuten fesselten, nicht für zehn, nein, auf Dauer. Abra verstand das. Sie war selbst fasziniert. Es versprach, viel aufregender zu werden, als sie gedacht hatte.