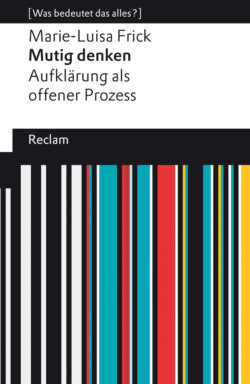Читать книгу Mutig denken. Aufklärung als offener Prozess - Marie-Luisa Frick - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. Selbst denken
ОглавлениеEs ist eindeutig keine Fanpost, die der jüdisch-stämmige Gelehrte Baruch de Spinoza an einem Tag im Jahr 1675, zwei Jahre vor seinem Tod, in Den Haag erhält. Sein ehemaliger Schüler Albert Burgh, inzwischen in Italien zum Katholizismus konvertiert, geht hart mit Spinoza ins Gericht: Dieser sei ein »niedriger Erdenwurm« und verbreite »abscheuliche Ketzerei«. Er solle sich bekehren und seinen »wahnsinnigen Hochmuth« ablegen:6
Halten Sie sich denn für grösser als Alle, die je im Staat und in der Kirche Gottes sich erhoben haben? Grösser als die Patriarchen, Propheten, Apostel, Märtyrer, Lehrer, Bekenner, Jungfrauen und die unzähligen Heiligen, ja gotteslästerlicher Weise grösser, als selbst unser Herr Jesu Christus?
Immerhin, es waren nur Worte. Schon in jungen Jahren entkam der Sohn sephardischer Immigranten einem Attentat – man versuchte, ihn beim Spaziergehen zu erdolchen. Doch auch Worte können ein Leben fast zerstören. Das zeigt der Bannspruch (Cherem), den die portugiesisch-jüdische Gemeinde in Amsterdam 1656 über Spinoza verhängte und der es untersagte, Umgang mit ihm zu haben oder ihn gar zu unterstützen. Doch blieb er standhaft. Seinem wütenden Schüler antwortete er schlicht: »Werfen Sie diesen verderblichen Aberglauben weg und erkennen Sie die Vernunft an, die Gott Ihnen gegeben hat […]«.
Was aber hatte Spinoza getan, um solch Verärgerung, ja: Hass auf sich zu ziehen? Was war es, das andere, die mit ihm auch nur ideell in Verbindung gebracht wurden, vor der Verachtung und Rache ihrer Mitmenschen zittern ließ? Der Oberrabbiner der heutigen portugiesisch-israelitischen Gemeinde in Amsterdam, Pinchas Toledano, begründet die Weigerung, wenigstens nachträglich den Bannfluch über Spinoza aufzuheben, damit, dass er »die Fundamente unserer Religion« zerrissen habe.7