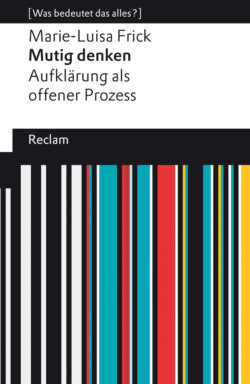Читать книгу Mutig denken. Aufklärung als offener Prozess - Marie-Luisa Frick - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Selbstdenken – aber richtig
ОглавлениеGrund genug, einen Schritt zurückzugehen und zu fragen, was Selbstdenken überhaupt ist oder sein kann. Dabei bemerken wir rasch, dass die theoretische Gegenüberstellung von autonomem (d. h. sich selbst die Regeln gebendem) Denken und heteronomem (d. h. von anderen die Regeln übernehmendem) Denken in der Praxis nicht immer aufgeht. Da ist zunächst die Frage, wer entscheiden darf, was Selbstdenken ist und was nicht. Vorwürfe, andere seien indoktriniert, vorurteilsbeladen und dergleichen sind Standardvorhaltungen in fast allen Debatten. Und sie wirken in alle Richtungen, weshalb sie zur Entscheidung von Streitfragen wenig taugen. Und provokant gefragt: Was ist eigentlich so schlimm, sich in manchen Angelegenheiten des (Sach-)Verstandes anderer Personen – oder auch Algorithmen – zu bedienen? Was ist verwerflich an der Bequemlichkeit, sich bei der Suche nach einem bestimmten Ort in einer Großstadt nicht des eigenen Verstandes zu bedienen, sondern des fremden ›Verstandes‹ eines Navigationssystems? Darf man nicht auch beides, selbst- und fremddenken?
Noch schwerer freilich ist der Unterschied zwischen Selbst- und Fremddenken in phänomenologischer Hinsicht aufrechtzuerhalten: Wenn wir als ›unbeschriebenes Blatt‹, als tabula rasa geboren sind, also empirische Informationen immer erst sammeln müssen und sie zu verknüpfen und zu deuten erst mühevoll an der Hand anderer erlernen: Welches Selbstdenken ist dann wirklich ein Selbst-Denken? Als soziale Wesen entwickeln wir uns innerhalb von Kulturen des Denkens, sind umgeben von Beispielen und Vorbildern, gewöhnen uns an das, was wir kennen, und imitieren unwillkürlich, was wir sehen. Kurz: Das ›Selbst‹ im Denken sind immer auch die anderen. Was aber soll dann Selbstdenken bedeuten?
Anstatt den Wert und das Erstrebenswerte im Selbstdenken in seiner Entfernung vom Fremddenken zu suchen – die oft kürzer ausfällt, als wir uns eingestehen –, ist es hilfreicher, ›echtes‹ Selbstdenken gerade auch als selbst-reflexives Denken aufzufassen. Damit ist gemeint, dass es nicht ausreicht, einfach seinen eigenen Verstand zu gebrauchen, selbst Schlüsse zu ziehen und Urteile zu bilden, ohne sich darüber Rechenschaft zu geben, was dieser Verstand leisten kann, wie er etwas vollbringt und nicht zuletzt, worin er begrenzt ist. Selbst-reflexives Denken ist kritisches Denken, das in alle Richtungen hin ausstrahlt und sich damit auch auf die eigene Urteilsfähigkeit bezieht. Die klassische Frage der Philosophie »Was kann ich wissen?« gewinnt in einer zunehmend auch für Sachverständige unübersichtlichen Welt radikal an Bedeutung. Durch die Spezialisierung der wissenschaftlichen Disziplinen und der entsprechenden Verinselung von Expertise ist niemand kompetent in allen Fragen, kann es auch nicht sein. Da wir zwangsläufig darauf angewiesen sind, in vielen Bereichen unseres Lebens Menschen zu vertrauen, die kompetenter sind als wir, werden wir uns immer wieder eingestehen müssen, dass wir nur sehr eingeschränkt Wissen selbst erwerben und es vielmehr meist aus einer Kette von Händen erhalten.
Die entscheidende Frage lautet dann nicht mehr: Kann ich mir in einer Sachfrage selbst ein Urteil bilden – selten oder nur mit enormem Aufwand –, sondern: Wie kann ich mir darüber ein Urteil bilden, wie diejenigen ihre Urteile bilden, auf deren Expertise ich angewiesen bin bzw. denen ich Vertrauen schenken möchte? Fragen, die man sich stellen sollte, sind: Was sind die Methoden, mit deren Hilfe sie ihre vermeintlichen Erkenntnisse gewinnen? Was könnten ihre außerwissenschaftlichen Interessen sein oder in welchen Abhängigkeiten stehen sie? Wie steht es um das ›professionelle Standing‹ der vermeintlichen Fachleute, also wie wird ihre Kompetenz von der Kollegenschaft eingeschätzt? Nichtsdestotrotz sind die Grenzen eines solchen Selbstprüfens allzu offensichtlich: Auch preisgekrönte Journalisten können Schwindler sein, Spitzenforscher sich grob irren oder auch nur fehlerhaft arbeiten. So gilt dann auch: Keine dieser Fragen garantiert, zu einem sicheren Urteil über die Vertrauenswürdigkeit von Expertisen zu gelangen. Doch nur der blinde Glaube hält es für entbehrlich, sie überhaupt erst zu stellen.
Selbst-reflexives Denken kann nicht als Haltung eingeübt werden ohne gesellschaftlich-institutionelle Gelingensbedingungen. Dazu zählt ein möglichst freier, öffentlicher Diskursraum, in dem Ansichten sich begegnen und im besten Fall gegenseitig korrigieren können. Nur wer gelegentlich Widerspruch erfährt, der den eigenen Standpunkt in Frage stellt und verunsichert, kann lernen, auch sich selbst zu hinterfragen. Eine unersetzbare Verantwortung für Bedingungen des richtigen Selbstdenkens kommt auch Bildungseinrichtungen zu. Jede Rede von der (digitalen) Wissensgesellschaft ist eitel, solange zwar wissenschaftliche (Zwischen-)Erkenntnisse gelehrt werden, nicht aber vermittelt wird, was wissenschaftliche Methodik, ja überhaupt wissenschaftliches Denken ist. Dort, wo die Ansicht vorherrscht, Informationen würde man sich erst dann besorgen, wenn man sie auch wirklich braucht, halten wir uns für aufgeklärter als wir sind. Denn jedes Denken hat als seine Grundlage auch ›trockenes‹ Wissen. Informationen werden erst zu Wissen, wenn sie in einen »epistemologischen Rahmen« eingeordnet werden, wenn ich also überhaupt erst weiß, wie ich Informationen einschätzen, gewichten und aussortieren soll.15
Es ist dieser Zusammenhang zwischen (Urteils-)Bildung und Befreiung des Menschen, der heute wichtiger ist als jemals zuvor. »Wahre Freiheit«, betont der Philosoph und Pädagoge John Dewey, »ist geistig; sie beruht auf der trainierten Gedankenkraft, auf der Fähigkeit Dinge ›umzudrehen‹, bewusst hinzusehen, zu beurteilen, ob die Menge und Art von Evidenz ausreichend ist für eine Entscheidung«.16 Ohne gezielte Anstrengungen, Menschen darin zu unterstützen, diese Fähigkeiten auszubilden, produzieren technologisch entwickelte Gesellschaften höchstens pseudo-kluge Sklaven. Das gilt besonders dort, wo selbstlernende Algorithmen (»künstliche Intelligenz«) ungeahnte Hilfsdienste und Lebenserleichterungen versprechen. Es reicht demnach nicht, nur Transparenz über ihre einprogrammierten Rechenschritte zu fordern, zumal mit neuen Methoden maschinellen Lernens »künstliche Intelligenzen« zunehmend zu »dunklen Schachteln« werden, in die wir kaum mehr hineinblicken. Zentral, um die Autonomie des Menschen gegenüber seinen Geschöpfen sicherzustellen, sind vielmehr des Denkens fähige Persönlichkeiten, die kontrollieren und nachprüfen, was ihnen möglich ist, und dort, wo es ihnen nicht mehr möglich ist, stets wachsam bleiben. Wo der Glaube wächst, Maschinen könnten das erreichen, was uns Menschen verwehrt ist, nämlich abschließende Gewissheit, geht Selbstbetrug schnell in Selbstverknechtung über.
So verstanden ist nicht jedes Selbstdenken immer schon aufgeklärt. Daher geht der Imperativ »Denke selbst« ins Leere, es sei denn, er fordert die Haltung selbst-reflexiven Denkens ein. Die krudesten Theorien können als Produkte von Selbstdenken durchgehen (»Ich gegen die Weltverschwörung«), die größten Mythen als kritisches Denken, aber aufgeklärt sind sie damit noch lange nicht. Solange Selbstdenken sich selbst keine Fragen stellt, bleibt es anfällig für die schwerwiegendsten Vorurteile: Urteile über die eigene Urteilskraft. Selbstdenker ist nicht derjenige, der bequem in seinem eigenen Baum der Erkenntnis sitzt, sondern derjenige, der an diesem Baum auch hin und wieder kräftig rüttelt. Selbstdenken, so könnte man es auch ausdrücken, muss philosophisch werden, um sich von seinem Gegenteil, dem Dogmatismus, zu unterscheiden. Das traditionelle Motto aller Dogmatiker*innen (»Es gilt deshalb, weil es gilt – alternativlos«) sollte Selbstdenker*innen nicht nur Ansporn sein, ideologische Halsstarrigkeit in jeder Erscheinungsform herauszufordern. Es sollte sie auch davor warnen, sich diese Denkweise anzueignen, wo es vielleicht für sie selbst bequem ist. Denn nichts gilt, weil es gilt. Alles könnte anders sein.