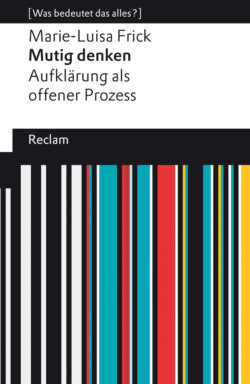Читать книгу Mutig denken. Aufklärung als offener Prozess - Marie-Luisa Frick - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Humus der Krise
ОглавлениеWarum, so fragt man zu selten, wurde in dieser Zeit so vieles neu gedacht, so vieles umgestoßen, ja: so besessen reformiert? Es lag nicht allein an der Herausbildung des Bewusstseins für einen offenen Zeithorizont, das entstehen konnte, sobald die Weltgeschichte aus dem »Mittelalter« zwischen Geburt Jesu und seiner Wiederkehr befreit wurde. Mit diesem Bewusstsein wurde Fortschritt denkbar, doch wurde er so noch nicht zu einem Imperativ.
Spätestens seit dem Beginn der Reformation, aber auch der Rezeption antiker skeptischer Philosophie und der Auseinandersetzung mit anderen Kulturen, gärt im frühneuzeitlichen Europa eine um sich greifende Krise der Legitimation. Diese erstreckte sich nach und nach auf nahezu alle Bereiche bestehender Denk- und Handlungsordnungen. In den damaligen Wissenschaften tritt sie als Krise von denkerischer, epistemischer Autorität in Erscheinung, allen voran der Autorität der an Aristoteles orientierten Systemphilosophie der mittelalterlichen, karikaturhaft als absolut weltfremd verstandenen Scholastik: Für sie war Aristoteles die unhinterfragbare Autorität, war er »der« Philosoph, wie man ihn hochachtungsvoll nannte. Was brauchte man da noch mehr?
Ein Paradigmenwechsel hin zu einer induktiven, von Einzelfällen ausgehenden, erfahrungsbasierten und erfahrungsgesättigten Logik der Naturwissenschaften kündigte sich spätestens Ende des 15. Jahrhunderts an, beispielhaft etwa in den Erfolgen von Ingenieuren wie Leonardo da Vinci. Die Wiederentdeckung antiken Denkens hatte die Erschütterung bisher als unumstößlich angesehener Lehrsätze und ableitender bzw. deduktiv(-religiös)er Legitimationsweisen von Wissen zur Folge. Zu nennen sind die auf sinnliche Erfahrbarkeit einer materialistisch gedachten Welt pochenden Schriften Lukrez’ und Epikurs. Auch die Integration wissenschaftlicher Vorleistungen arabischer und persischer Gelehrter, etwa von Ibn Ruschd und Ibn Tufail, war von Bedeutung.
Mit der Reformation, die ihren Erfolg unter anderem auch dem neu entwickelten Buchdruck verdankt, wird auch die Begründung von Herrschaft krisenhaft zum Thema. Regenten »von Gottes Gnaden« werden unweigerlich zu Usurpatoren in den Augen jener Untertanen, die andere Auffassungen vom wahren Gottesdienst und der richtigen Auslegung der Schrift haben – und dies umso mehr, wenn sie von den zur »Verteidigung des rechten Glaubens« bestimmten Fürsten wegen ihrer Überzeugungen verfolgt werden. Mit dem Verlust der konfessionellen Homogenität in konfessionell gefassten Staatsgebilden wird der Andersgläubige nahezu zwangsläufig zum illoyalen Bürger. Seine Verfolgung macht die Prophezeiung selbsterfüllend: Er wird zum Staatsfeind, wenn er Ungehorsam gegen seinen Oberherrn mit Verweis auf die höherrangige Autorität des Papstes (wie etwa die Katholiken in England) oder die Widerstandstheorie Calvins (wie etwa »Hugenotten« in Frankreich) rechtfertigt.
Die Herausbildung konfessionell zersplitterter Fürstentümer verlieh theoretischen Rechtfertigungen von Herrschaft eine völlig neue Brisanz. Warum sollte überhaupt jemand über andere herrschen? Politische Utopien, die der Frage nachgehen, wie alles ganz anders sein könnte, und politische Traktate, die wie Geschütze vor oder gegen konkrete Regierungen positioniert werden, sind Ausdruck dieses Ringens, das schließlich folgenschwer in politischen Umstürzen zu Tage tritt. Die öffentliche Hinrichtung einer Majestät als »Feind des Volkes« (England 1649) oder als »Hochverräter« (Frankreich 1793) war ähnlich wie der Unabhängigkeitskrieg nordamerikanischer Kolonien nur deshalb möglich geworden, weil ein Denken in Alternativen lange geradezu als unverletzbar und heilig angesehene Schranken grundsätzlich hinterfragt und allein durch diese Infragestellung schon schwer beschädigt hat. Ein Untertan, der sich gegen die Obrigkeit erhebt, stellt die »natürliche Ordnung« auf den Kopf – das heißt eine Ordnung, der in vormodernen Gesellschaften die größte, ja ängstlichste Sorge galt. Die Krise der Herrschaftslegitimation erfasst in der frühen Neuzeit die Chain of Being des Sozialen und es wird mehr als ein Schmied versuchen, ihre Glieder neu anzuordnen – unter den Zurufen anderer, die es vorziehen, sie ganz zerbrochen zu sehen.
Nicht nur in ihrer politischen Dimension – in welcher Art politischer Gemeinschaft sollen Christen unterschiedlicher Konfession leben? – wurde Religion in der frühen Neuzeit von Legitimationsschwierigkeiten erfasst. Zwar waren derartige Herausforderungen nicht ganz neu, hatte doch bereits die Frage, was denn die wahre Religion sei, und die Auseinandersetzung mit häretischen Bewegungen sowie Juden und Muslimen mittelalterliche theologische Diskurse geprägt. Solange aber die Verlässlichkeit der Offenbarung als solche innerhalb der eigenen Kultur nicht in Zweifel gezogen wurde, war die Herausforderung noch nicht existentiell: Sie war eine Konfrontation zwischen einem klar identifizierbaren Anderen und einem selbstgewissen Ich. Mindestens zwei Entwicklungen führten nun aber im 17. Jahrhundert dazu, dass die christliche Wahrheit als Offenbarungswahrheit – trotz vehementer Repressionen – unter Druck geriet.
Zum einen geschah dies durch Zweifel an der Singularität und Verlässlichkeit der Offenbarung, wie sie auch durch wachsende außereuropäische Kulturkontakte genährt wurden. Das anwachsende Wissen um alternative Gesellschafts- und Kulturformen im Zuge der Globalisierung der europäischen Zivilisation warf neue Fragen auf: Wenn wir nicht die einzigen Völker sind, wer sind dann diese anderen (eine Frage, die sich heute im Zusammenhang mit der Suche nach außerirdischer Intelligenz wieder neu stellen könnte)? Stammen diese Geschöpfe von Adam ab, wie wir, oder sind sie eine andere Art Mensch? Wie sind sie entstanden? Wie können wir sicher sein, dass unsere Sitten die besseren sind, wo andere Gesellschaften doch dasselbe von ihren behaupten? Die das größte Verunsicherungspotential aufweisende Frage aber lautete: Wieso haben nur wir Gottes Offenbarung erhalten? Oder ist die Bibel vielleicht gar nicht die einzige oder einzig maßgebliche Mitteilung Gottes? Versuche, historisch-kritische Perspektiven auf die Bibel zu richten, führten bei einflussreichen Gelehrten zur Überzeugung, dass die Widersprüche, Zeitabstände und unklare Autorenschaft biblischer Texte es nicht erlauben, in der Bibel eine universal gültige, in allem verlässliche Botschaft einer Gottheit zu erblicken. Damit löste sich die Verankerung der christlichen und jüdischen Heilsgeschichte.
Die ideellen und materiellen Schöpfungen des Aufklärungszeitalters sind in weiten Teilen verstehbar als Versuche, auf diesem durch Krisenerschütterungen zerklüfteten Terrain Fundamente zu legen. Das Ringen mit der Herausforderung des antiken skeptischen Pyrrhonismus veranlasste René Descartes zu seinem Cogito ergo sum – dem radikalen Versuch, inmitten eines Ozeans an Ungewissheiten das zu entdecken, das niemals fraglich sein würde. Seine Philosophie wurde damit zu einer Wegbereiterin des modernen Individualismus: Nur das eigene Bewusstsein kann Markstein echter Gewissheit sein. Auch in religiöser Hinsicht ist der auf die unhintergehbare Autorität des Gewissens gegründete Individualismus ein Krisenprodukt, das sich den schier endlosen konfessionellen Konflikten der frühen Neuzeit verdankt. Nur der Einzelne, so ein zentrales Argument John Lockes Toleranzbriefes, ist befugt, die für ihn so folgenschwere Entscheidung zu treffen, in welchen Glauben er sein Heil setzt. In den Reaktionen auf die Destabilisierung politischer Legitimitätstheorien, allen voran mittels der Lehre vom Gesellschaftsvertrag, wird dieser Individualismus neuartige Ansprüche zu begründen helfen: die »natürlichen Rechte« des Menschen. Die Vorstellung, dass es jenseits des gesetzten Rechts und unabhängig von kontingenten politischen Verhältnissen ein natürliches Recht gibt, eine echte, natürliche Ordnung, ist dabei sowohl Kritik am Bestehenden als auch Rückversicherung, dass ungeachtet aller Wechselfälle immer noch irgendwo Orientierung sich anbietet. – Man muss diesen Orientierungspunkt nur erhellen.
In »der Natur« bzw. im Naturrecht lässt sich ferner eine universale Moral verankern, die auch jene bindet, die ihre Gebote und Pflichten nicht aus der christlichen Offenbarung beziehen, was für die Formulierung erster trans-religiöser Regeln etwa des Krieges und der internationalen Beziehungen entscheidende Anregung liefert. Der Weg zu einer nicht-religiös fundierten Ethik ist damit beschritten.