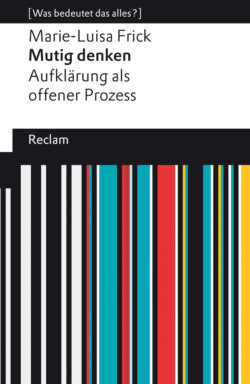Читать книгу Mutig denken. Aufklärung als offener Prozess - Marie-Luisa Frick - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Deutung des Undeutlichen
ОглавлениеBetrachten wir ein paar gängige Charakterisierungen dieses Zeitalters der Aufklärung: Wer Aufklärung etwa als Zeitalter der Vernunft fasst, sieht sich schnell mit der Frage konfrontiert, was von jenen Strömungen dieser Zeit zu halten ist, die Gefühle und Triebe bzw. Leidenschaften über oder zumindest auf dieselbe Höhe der Vernunft stellen. Gerade in der Ethik, aber auch in der politischen Philosophie der frühen Neuzeit begegnen uns Vorstellungen, die das Bild einer kühlen, rationalen Aufklärung aber gerade unterlaufen. So sprach der englische Philosoph und Aufklärer David Hume der Vernunft ab, uns zu moralischen Handlungen motivieren zu können, und betonte stattdessen die entscheidende Rolle von Leidenschaften (passions). Auch Thomas Hobbes’ einflussreiche Staatstheorie rechnet nicht allein mit dem Menschen als Vernunftwesen, sondern stellt die Todesangst an den Beginn einer mechanistischen Anthropologie. Kurz: Vernunft und Gefühl, beide sind sie Stimmungen der Aufklärung.
Dass die Aufklärung von antireligiösen Einstellungen getragen war, ist eine weitere unscharfe Einschätzung. Ohne auf regionale Kontexte einzugehen und die konfessionelle Pluralisierung der frühen Neuzeit auszuleuchten, entgeht allzu leicht, dass zwar unterschiedliche Formen von Religion aus jeweils unterschiedlichen Richtungen kritisiert wurden, Vernunft und religiöser Glaube aber lediglich von einer verschwindend kleinen Minderheit als miteinander grundsätzlich unvereinbar angesehen wurden. Zwar hat die Aufklärungsphilosophie mit ihrer insgesamt durchdringenden Tendenz, die irdische Existenz des Menschen aufzuwerten, zu einer »Expansion der Säkularität« geführt,2 wie dies die Wissenschaftshistorikerin Margaret Jacob nennt. Doch versuchte ›die‹ Aufklärung gar nicht, Vernunft an die Stelle von Religion zu setzen. Vielmehr zeichnet sie das Ringen um die Frage aus, was vernünftigen Glauben ausmacht.
Die bedeutende Rolle religiöser Ansätze und Narrative für die Praxis der Aufklärung zeigt auch ein Blick auf wichtige soziale und politische Bewegungen der frühen Neuzeit: Die englischen »Levellers« etwa haben die Vision einer universalen (auch sozialen) Gleichheit der Menschen mit radikalchristlichen Ideen verbunden. Und die Bemühungen zur Abschaffung des transatlantischen Sklavenhandels wurden maßgeblich von der Religious Society of Friends (den »Quäkern«) und den Methodisten getragen. Religiöse Überzeugungen sind also ebenso Teil der Aufklärung wie deutlich ausgesprochene oder verschleierte Atheismen und beißender Spott über religiöse Lebensformen.
Oft wird die Aufklärung auch als die Blüte des Universalismus beschrieben: Allgemeingültige Prinzipien und Regeln wurden aufgestellt, alle Menschen in den Blick genommen, oder kritischer formuliert: Westliche Ideen wurden der gesamten Menschheit übergestülpt. Auch hier lässt uns ein differenzierter Blick etwas ratlos zurück. Wie konnte ein Werk, das die Gültigkeit von Gesetzen auf klimatische Bedingungen hin relativiert und die Wahl der Regierungsform von der Bevölkerungsgröße abhängig macht, im universalistischen Aufklärungszeitalter jemals so einflussreich werden, wie Charles de Montesquieus De l’esprit des loix (Vom Geist der Gesetze, 1748)? Wie erklären wir, dass sich unter dem Einfluss leitender Staatstheorien im Zuge der Aufklärung abschottende Identitäten des Nationalen herauszubilden begannen? Ganz zu schweigen von Durchbrechungen des angeblich so charakteristischen Universalismus der Aufklärung in Form von Rassenhierarchien und Geschlechterdifferenzen, die oft scheinbar unversöhnt neben Bekenntnissen zu Gleichheit aufscheinen: Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung beginnt mit dem Satz: »All men are created equal.« Einschluss und Ausschluss, das Allgemeine und das Besondere: Die Aufklärung atmet beides.
In diesem Zusammenhang wird manchmal behauptet, die Aufklärung sei ein wesenhaft kolonialistisches Projekt und setze das rationale, europäische Denken dem »unzivilisierten« Wesen anderer Völker entgegen. In dieser pauschalen Form ist diese These jedoch ebenso wenig haltbar. Wer sie vertritt, muss ausblenden, wie Literaten und Denker der Aufklärung über die Bande des Kulturvergleichs ihre eigene Gesellschaft kritisieren – gerade auch in ihren kolonialen Verstrickungen und ›nationalen Sünden‹. Man denke nur an den Erzaufklärer Denis Diderot und seine Kritik an der leibfeindlichen, künstlichen, verdorbenen Lebensform des christlichen Europäers in seinem Supplément au voyage de Bougainville (Nachtrag zu »Bougainvilles Reise«, 1772), in welcher der Europäer zum »Vergifter der Völker« gestempelt wird.3 Auch übersieht so ein Vorwurf die neugierige Aufgeschlossenheit vieler gegenüber außereuropäischen Kulturen und Religionen, wie sie sich in zahlreichen Klassikern des aufklärerischen Denkens andeuten. Darunter fallen etwa die dem Konfuzianismus Anerkennung zollende Rede über die praktische Philosophie der Chinesen (1721) des Philosophen und Logikers Christian Wolff oder auch die Chinastudien von François Quesnay. Sich durch die Augen der anderen zu sehen, sich in der Auseinandersetzung mit dem Fremden selbst besser zu verstehen, macht die Faszination von Verkaufsschlagern wie den Lettres Persanes (Persische Briefe, 1721) von Montesquieu oder auch Georg Forsters A Voyage round the World (Reise um die Welt, 1778) aus. Und doch haben jene Recht, die – ohne in die Falle einer pauschalen moralischen Verurteilung ›der Aufklärung‹ zu tappen – darauf hinweisen, wie widersprüchlich gerade ihre menschenfreundlichsten Köpfe manchmal waren. Humanistische Rassisten: Der Aufklärung sind sie keineswegs fremd.
Diese Schlaglichter sollten genügen, um zu unterstreichen, dass es sich bei der Aufklärung um kein homogenes Projekt und kein widerspruchsfreies Programm, sondern um ein komplexes Ineinandergreifen vielfältigster Vorstellungen und Praktiken handelt. Die Aufklärung kann also nicht als ›Große Erzählung‹ nacherzählt werden, ohne dabei auch diese Vielstimmigkeit und Uneindeutigkeiten ans Licht zu ziehen. Am nächsten kommt man der Aufklärung, wenn man sie als Mosaik vieler kleiner Geschichten vorstellt, um deren eigentlichen Gehalt und Moral man immer wieder aufs Neue ringen darf und auch soll. Es sind dies, wenn man so will, Geschichten davon, was konkrete Menschen getan und gedacht haben, was sie erschaffen haben an Bildern der Welt und niedergerissen, mit und gegen was sie gekämpft, was sie erstrebt und erreicht haben und woran sie gescheitert sind.
Gibt es etwas, das diese Geschichten verbindet und uns trotz dieser Uneindeutigkeit noch erlaubt, von der Aufklärung zu sprechen? Ein möglicher Anknüpfungspunkt liegt in der krisenhaften existentiellen Verfassung des Menschen im Aufklärungszeitalter und die aus ihr sich speisenden und auf sie rückwirkenden Ideen und Praktiken.