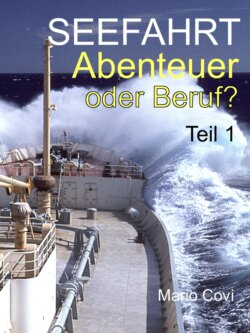Читать книгу Seefahrt - Abenteuer oder Beruf? - Teil 1 - Mario Covi - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. REGENZEIT IM NIGER-DELTA
ОглавлениеIn der Trampfahrt weiß man nie, wohin die nächste Reise geht. Als ich im Juli 1978 im mexikanischen Vera Cruz ein Wiedersehen mit lieben Freunden feierte, kam die neue Order via Norddeichradio in die Funkbude geknallt: Getreide und Mehl in New Orleans laden. Löschen in Nigeria! Tröstlich war, dass der Löschhafen nicht Lagos, sondern Sapele hieß!
Die Fahrt nach Sapele ist ein spannendes Unterfangen, da dieser Hafen tief im Labyrinth des Niger-Deltas liegt. Im Grenzgebiet zwischen der Bucht von Benin und der Bucht von Biafra müssen die Schiffe eine Flussmündung suchen, deren Barre – eine vor der Mündung liegende Untiefe - passierbar ist. Für Trampschiffe ist jede Küstenannäherung eine neue Erfahrung. So blätterten auch unsere Nautiker nervös im "Handbuch der Westküste Afrikas" und fanden folgende Passagen:
„Die Barre vor der Benin-Mündung ist veränderlich. Häufig läuft schwere Brandung über die ganze Barre. Vom Passieren wird abgeraten... Gegenwärtig ist die Barre der Escravos-Mündung am ungefährlichsten... Warnung! Vor den Barren der Mündungen des Escravos, Nun, Bonny und Opobo muss man mit dem Auftreten von Grundseen von erheblicher Stärke rechnen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass man auch unter den besten Bedingungen nur mit einem Tiefgang, der noch einen Fuß Wasser unter dem Kiel behält, die Barre kreuzen darf..."
Kein Wunder, dass auf der Brücke eine angespannte Atmosphäre herrschte. Unser Tiefgang hatte einen kniffeligen Grenzwert, und wir näherten uns unaufhaltsam der Barre. Eine erschreckend hohe Brandung brach sich dort drohend. Außerdem sollte die dringend erforderliche Übernahme eines Lotsen erst in dieser wogenden Mündung stattfinden.
Ein Einbaum, von einem Außenborder angetrieben, scherte längsseits, und ein verwegen aussehender Afrikaner stellte sich als Lotse vor. Diese Lotsen sind meist einfache Leute aus dem Busch, die das weitverzweigte Fluss-System bestens kennen. Zwar können sie keine Manöveranweisungen geben, aber sie steuern die Schiffe geschickt durch das schwierige Revier. So dirigierte unser Lotse den Getreidefrachter auf verschlungenen Wasserpfaden und Urwaldflüssen durch Mangrovensümpfe, verfilzte Dschungel und Regenwald.
Kleine Urwalddörfchen zogen vorüber. Oft nur eine Ansammlung von zwei, drei armseligen Hütten, deren Bewohner vor der Bugwelle des Schiffes flohen, einer lehmbraunen Woge, die sich rauschend durch das wackelige Gefüge des Dschungelhäuschens ergoss und den kümmerlichen Hausrat ins Freie spülte. Sobald man sich größeren Ansiedlungen näherte, umringten Schwärme von Kanus das Schiff. Frauen, Kinder, Mädchen und junge Burschen riefen: „Oibo! Oibo! Dash me Oibo! – Weißer, weißer Mann aus Europa, schenk mir was!“
Dann flogen Klamotten, Konservendosen, Krempel und Kleinkram in die Kanus. Rüde Freigebigkeit packte uns. Wohlstandsmüll ergoss sich ins dunkle Flusswasser, die Satten kippten den Darbenden die Krumen des Überflusses vor die Füße. Und wir alle hatten einen verdammten Spaß dabei!
Ich entsinne mich einer Reise durch diese Gewässer, da war die Begeisterung eines Matrosen so überschwänglich, dass er sämtliche persönliche Kleidungsstücke in die vor Freude johlende Flottille der Kanus und Pirogen warf. Als er nichts mehr zu verschenken hatte, schleuderte er seinen Wintermantel in die tropisch-heiße Dschungelluft und letztendlich mit den Worten „den brauch‘ ich jetzt auch nicht mehr!" – seinen guten Reisekoffer... Der Seemann musste anschließend bei seinen Kameraden um ein paar Klamotten bitten.
Wir waren also mit unserer Getreideladung auf dem Weg nach Sapele, als der Lotse auf halbem Wege, mitten in dieser Landschaft aus Dschungel und Wasser, den Anker fallen ließ. Er eröffnete uns, dass wir hier zu warten hätten. Die Pier am Getreidesilo sei besetzt. Auf die Frage unseres Alten, wann wir denn an die Pier sollten, gab es die meistgehörte Phrase in nigerianischen Schifffahrtskreisen zu hören: „Any time from now!“
„Any time from now“, dieses „Irgendwann-ab-Jetzt“ wurde ein zermürbendes Harren und Hoffen, ein Trödeln und Gammeln. Die Regenzeit fiel mit Vehemenz über das Nigerdelta herein. Sie sperrte uns in die Enge des Schiffes, zögerte unseren Löschtermin immer weiter hinaus. Zum Glück hatte ich Beschäftigung mit meinen Hobbys, schnitt Filme und klimperte auf meiner Gitarre. Natürlich hatte ich auch mit der Funkerei und anfallendem Verwaltungskram zu tun.
Jeden Morgen brachten mir die Matrosen riesige Herkuleskäfer, groß wir Spatzen. Sie waren vom Licht des Schiffes angelockt worden, schafften aber den Weg über den breiten Benin-River nicht zurück in den Urwald. Ich hatte begonnen, die zum Tode verurteilten Kreaturen wenigstens als Sammlerstücke zu präparieren. Auf den Geräten der Funkstation trockneten sie, schwarzbraune Riesenkrabbler mit geweihähnlichen Zangen. Ihre Heimat ist eigentlich Südamerika, aber in diesem kleinen Teil Afrikas kommen sie ebenfalls vor.
Wir lagen vor Koko, einem Dörfchen, das Jahre später in die Schlagzeilen geraten sollte, als kriminelle Profiteure dort klammheimlich hochgiftigen Sondermüll entsorgten! Beim Landgang wurden wir neugierig beobachtet. Die Kneipe des Kaffs bot lauwarmes Bier und irrsinnig laute Reggaemusik, die damals in allen Pinten Westafrikas groß in Mode war. Da unser Proviant zur Neige ging, zog der Alte bei solchen Landgängen über den Markt und durch die kleinen Läden der Ansiedlung, um jedes erreichbare Hühnerei und fades Weißbrot aufzukaufen. Die anderen Waren des Marktes eigneten sich nicht unbedingt als Schiffsproviant: lebende Krokodile, handlich mit Tragegriff verschnürt; Fluss-Schnecken, faustgroß und zu schleimigen Haufen gestapelt; fette weiße Engerlinge mit schwarzen Knopfaugen.
Mit den Dorfbewohnern kamen wir bestens aus. Sie waren liebenswürdig und friedlich. Ein paar lebenslustige Mädchen schlichen sich des Nachts mit ihren Kanus zum Schiff, wo sie von unseren Jungs bereits erwartet und heimlich über eine Strickleiter an Bord geholt wurden.
Ein etwas lüsternes Macho-Vergnügen war, die Frauen und Mädchen beim Bad im Fluss zu beobachten. Kaum ein Menschenschlag schäumt sich so ausgiebig mit Seife ein und badet so genussvoll wie die Afrikaner. Da waren einige bildhübsche Mädchen darunter, und wir ausgehungertes Mannsvolk gierten nicht schlecht durch die Ferngläser auf der Brücke. Die Haut einer jungen Frau glich dunklem Milchkaffee, ein Geschöpf von goldbraunem Liebreiz. Wenn sie sich mit ihren Gefährtinnen im Wasser tummelte, rief mich der Chief immer mit den Worten: "Funker, komm schnell, die Weiße badet!"
Eines Nachts, gegen vier Uhr, wurden wir überfallen. Einer der wachenden spanischen Matrosen riss am Typhon, der Schiffssirene, brüllte den Niedergang hinab, und im Handumdrehen war jeder an Bord hellwach. Der Alte schrie mit aufgeregter, weinerlich-kippender Stimme: „Diese Schweine! Diese gottverdammten Schweine!“ - Ich muss zugeben, mir wurde verdammt mulmig, ich spürte Angst.
Es ging glimpflich aus. Kaum hatte ich mich angekleidet und irgendeine Schlagwaffe ergriffen, da waren unsere spanischen Matrosen und Decksleute bereits knüppelschwingend und wilde Kriegsschreie ausstoßend hinter den Piraten her, die sich kopfüber in die Fluten des nächtlichen Benin-Rivers retteten. Uns fiel ein Stein vom Herzen, war doch nicht ganz klar, welche Art von Beute die Banditen erhofft hatten. Das Getreide lag als loses Schüttgut in den Luken, was unserem Pott einen gewissen Sicherheitsstatus verlieh. Blieb als Beute nur die Schiffsausrüstung und unsere persönliche Habe.
Einige Nächte später, so gegen drei Uhr, wir hatten eine kleine Bordparty gefeiert und ich saß mit ein paar Unentwegten bei einem letzten Whisky-Soda auf dem Palaverdeck, da hörten wir Schüsse. Unsere Nachtwache-Matrosen ließen die Bordscheinwerfer über die finstere Urwaldszenerie streifen, erfassten die Hütten von Koko, ein heruntergekommenes Herrschaftshaus aus kolonialen Tagen, die kleine Pier, an der hin und wieder ein Frachtschiff festmachte und Koko zur "Hafenstadt" machte. Dort herrschte Unruhe, man sah Männer laufen, ein oder zwei Kanus aufgeregt fortpaddeln.
Das alles begriffen wir in den wenigen Sekunden, in denen es sich abspielte, gar nicht so richtig, als es abermals knallte. Irgendeiner unserer trunkenen Zechbrüder lallte etwas von Feuerwerk und Nationalfeiertag. Ich rannte zur Brücke hoch, um einen besseren Überblick zu bekommen. Dort traf ich auf zwei Spanier der Nachtwache, die sich gerade hochrappelten und ihre Gliedmaßen rieben.
"Hijos de puta – Hurensöhne!", grollte der eine, ein drahtiger kleiner Bursche.
"Diese Kanaker auf uns schießen!"
Der andere bestätigte den Zwischenfall: "Ich mit Lampe leuchten auf Canoa. Bumm! Scheiß Kanaker schießen, ich hören zing! Ich mich schmeißen auf Boden!"
Am folgenden Tag erfuhren wir, dass Banditen aus Sapele im friedlichen Koko ihr Unwesen trieben. Sie hätten einen Überfall auf die Lagerschuppen an der Pier vorgehabt, seien aber von Polizisten vertrieben worden.
Es kursierte eine Story über einen russischen Frachter, der vor einigen Jahren in Sapele von einer schwerbewaffneten Räuberbande geentert wurde. Es war noch lange vor Glasnost und Perestroika, also leistete sich das System vollbesetzte Schiffe. So gelang es den Männern der Nachtwache, die Piraten in einem Teil der Aufbauten einzukesseln und fertig zu machen. Der Kapitän ließ die Leinen kappen, fuhr ohne Lotsen durchs Nigerdelta seewärts und meldete über Funk jeweils die Position, wo er in provozierenden Abständen einen der insgesamt acht oder neun Banditen über Bord werfen ließ. Tot. Erschossen oder erschlagen, ich weiß es nicht...
Die Regenzeit floss träge dahin wie der düstere Benin, der in den frühen Morgenstunden als dunstverschmierte Fläche um unser Schiff lag. Alles war klamm und feucht, der Urwald ein stetes Tropfen und Triefen. Über den höchsten Baumriesen segelten Nebelfetzen, waberten Wolken, legten sich wie nasse Lappen über knorriges Astwerk. In der tropfnassen Tiefe dieses Waldes hatte vor ein paar Tagen ein Einheimischer auf der Pirsch nach Ducker-Antilopen eine Begegnung mit einem Gorilla, der ihn so entsetzlich zurichtete, dass er wohl nie wieder wird jagen können.
Es war reizvoll, der ungestümen tropischen Natur so nahe zu sein, mit all ihrem furchterregenden Schrecknis. Aber oft erkennt man Reize erst, wenn sie räumlich oder zeitlich passiert sind, falls der versteckte Zauber überhaupt spürbar wurde... Viele von uns waren mürrisch, maulten, die bedrückende Warterei in einem noch bedrückenderen Klima legte sich aufs Gemüt.
Sicher, da war ein sonniger Sonntag, wir puckerten mit dem Rettungsboot auf verschlungenen Wasserläufen hinein in eine wilde Landschaft, in ein paar Stunden verwegenen Lebens! Sonnenverbrannt und biertrunken kamen wir uns wie Abenteurer, wie gutmütig-draufgängerische Sonntags-Söldner vor. Wir alberten mit der Leuchtpistole herum, die wir für alle Fälle mitgenommen hatten, kamen uns beim Ballern echt tollkühn vor. Wir staunten aber auch, wie armselig das Leben im Busch sein kann. Wir sahen Hütten, die inmitten moskitoverseuchten Sumpfgrasröhrichts im Wasser standen. Und wenn sie auf festem Grund erbaut waren, fand sich Wasser nur fußabdrucktief darunter. Zwischen drohenden Drachenbaumdschungeln und dem wirren Wurzelwerk der Mangroven wurde der Mensch nur geduldet. Wir lachten mit den Bewohnern des schwankenden Sumpflandes, verschenkten mitgenommene Koteletts, versuchten Palmwein und "African Gin" und stellten fest, dass Afrikaner gastfreundliche, lebensfrohe Menschen sind, - und keineswegs nur Banditen oder korrupte Beamte!
Doch dann herrschte wieder angespannte Stimmung. Der Koch hatte keine Lust mehr, einer aus der Maschine stänkerte dauernd, legt sich mit dem Chief an, mimte schließlich krank. Neben uns ankerte ein kleinerer Frachter, ein nach Panama ausgeflaggter Holländer. Kapitän, Chief und Erster Steuermann waren Niederländer, das restliche Dutzend der Besatzung kam von den Kap-Verde-Inseln. Als der Erste anfing durchzudrehen, wurde er auf dem schnellsten Wege in die Heimat geflogen. „Was soll ich mit einem ‚Chief-Mate‘, der den Tropenkoller hat?“ - so der Kapitän während eines Klönschnacks am UKW-Sprechfunkgerät.
Einige Tage später klang seine Stimme ernst und gehetzt: Unser Rettungsboot sei doch motorisiert und rasch zu Wasser zu lassen? Der Elektriker sei über die Kante gegangen, vor aller Augen, einfach so – und er sei doch Nichtschwimmer!
Die Suche blieb erfolglos. Nach drei Tagen rief uns ein Fischer aus seinem Einbaum zu, er habe flussabwärts die Leiche entdeckt. So konnten die grausam stinkenden Überreste des Insulaners geborgen werden, den irgendwelche, wohl für immer unbekannt bleibende Beweggründe ins Wasser getrieben hatten. In einer Persenning hing dann der Tote noch tagelang am weit außenbords geschwenkten Ladebaum des Frachters, bis der träge Behördenapparat endlich die Überführung des aufgedunsenen Körpers in ein Leichenhaus veranlasste. Zwecks Obduktion! Da es sich um einen Afrikaner handelte bestand der Verdacht, dass weiße Herrenmentalität den schwarzen geknechteten Bruder in den Tod getrieben hatte. Afrikanische Behördenarroganz trieb in verletzender Selbstgefälligkeit wieder mal schikanösen Schabernack – und lag dennoch gar nicht so falsch. Denn auf einigen Schiffen herrschten durchaus kolonialistische Herren-Knecht-Verhältnisse. Ich entsinne mich eines zufällig ebenfalls holländischen Kapitäns an der Küste Gabuns. Selbstgefällig hatte er damit geprahlt, für seine schwarze Crew nur noch billiges Hundefutter zu verarbeiten: „Die fressen das mit wahrer Begeisterung! Denen glänzt richtig das Fell!“
Auf unserem Nachbarschiff hatten wir aber das gute Verhältnis zwischen Schwarzen und Weißen kennen gelernt. Der Tote selbst bereitete den bürokratischen Triezereien ein Ende. Er war so stark in Verwesung übergegangen, dass die Beamten – nach dem üblichen Whiskyflaschen- und Zigarettenstangen-Bakschisch – strahlend zur Überzeugung gelangten, es sei doch angebrachter, den Toten endlich zu bestatten...
Als die Beerdigung stattfand war unser Kapitän der einzige weiße Teilnehmer. Ich war zutiefst erstaunt über dieses Mitgefühl am Schicksal eines unbekannten Seemanns. Ich war beschämt, denn unser Alter war nicht gerade beliebt an Bord. Wir empfanden ihn als knorzeligen Beamtentyp, auf leise Art zynisch und voll gestrigen Gedankenguts. Wir verdächtigten ihn der heimlichen Süffelei und verachteten ihn, weil er moralisch aufkreischend den Stecker aus der Wand riss, wenn wir mit "all hands" in der Messe hockten und in verzweifelter Geilheit die Pornofilme des Zweiten Ingenieurs anschauten.
Auch ein Wartetörn von einem Monat ist irgendwann vorbei. Wir hievten Anker und auf der Weiterfahrt nach Sapele saßen wir prompt zweimal fest. Der Lotse hatte den ihm vertrauten Kurs gesteuert. Zuvor waren wir von einem griechischen Kapitän vor den sich verändernden Sandbänken gewarnt worden. Unser Kapitän hatte mich zu einer umständlichen Dienstfahrt mit Boot und Buschtaxi nach Sapele mitgenommen. Dort hatte uns der Grieche leidenschaftlich ermahnt: „Don’t go this way!“ Dabei zeigte er uns einen Kurs auf der Flusskarte, der bislang als einzig sicherer Weg über die Untiefen galt. „Hier müssen Sie längs!“, war er fortgefahren und hatte brutal eine Kurslinie über die Sandbank gezeichnet. „Die Sandbank hat sich verlagert, glauben Sie mir! Nur die Lotsen wissen das noch nicht!“
Nun war unser Kapitän in seiner zaudernden Art doch den alten Kurs gefahren, und als der Pott plötzlich festsaß, war das Geschrei groß. Doch trotz dieser Ärgernisse erreichten wir Sapele unbeschadet.
Als wir nach Löschende seewärts durch den Dschungel tuckerten, sahen wir bei Youngtown, wo der Nana-Creek abzweigt, einen großen japanischen Frachter auf Scheiße sitzen. Aber so richtig hoch und trocken!