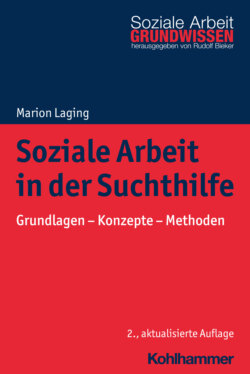Читать книгу Soziale Arbeit in der Suchthilfe - Marion Laging - Страница 50
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.6 Alkohol 3.6.1 Hintergrund
ОглавлениеAlkohol hat eine jahrtausendealte Geschichte als Nahrungs-, Genuss- und Rauschmittel, die ihren Ursprung in prähistorischen Zeiten hat. Menschen der verschiedensten Kulturkreise haben alkoholische Getränke hergestellt, meist aus Fruchtsäften, Getreideprodukten oder – seltener – aus Honig oder Milchzubereitungen. Um die Wende ins erste nachchristliche Jahrtausend wurde mit der Erfindung der Destillation die Produktion hochprozentiger Alkoholika möglich (Soyka et al. 2008: 2).
Alkohol zeigt hinsichtlich seiner sozialen und gesellschaftlichen Bewertungen und seiner kulturellen Bedeutungen eine äußerst wechselhafte Geschichte. So warnten schon in der Antike u. a. Platon, Cicero, Cato, Seneca, in den biblischen Schriften der Prophet Jeremia und der Apostel Paulus vor den Gefahren des übermäßigen Genusses berauschender Getränke. Menschen, die dem »Trunk verfallen waren«, traf ein moralisches Urteil. Mit verschiedenen Maßnahmen versuchte man, den Alkoholkonsum einzudämmen, jedoch ohne nachhaltigen Erfolg. Viel mehr Erfolg hatten die großen, von Asien ausgehenden Religionen, vor allem der Islam, der Buddhismus und der Hinduismus mit ihrem Verbot des Genusses berauschender Getränke. Diese religiösen Verbote haben entscheidende Verhaltensänderungen unter der Anhängerschaft zur Folge gehabt (Soyka et al. 2008: 3f).
In Europa waren im Mittelalter Bier und Wein hingegen die selbstverständlichen und alltäglichen Getränke zum Löschen des Durstes und zum Stillen des Hungers. Wasser, das in den Städten meist von minderer Qualität war, wurde nur von sehr armen Menschen getrunken. Daneben schätzte man an den alkoholischen Getränken ihre psychoaktive Wirkung. Der ausgeprägte, kollektive Rausch unter Männern während der mittelalterlichen Trinkgelage ist sprichwörtlich. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Alkoholrausch zumindest bei Männern schlicht als ein weiterer, möglicher Bewusstseinszustand – wie z. B. auch Träume – angesehen wurde.
Entscheidende Veränderungen in den Auffassungen über das Trinken, den Rausch und das Trinkverhalten werden mit den Entwicklungen im 15. und 16. Jahrhundert in Verbindung gebracht. Hier setzen sich die von Norbert Elias (2000) beschriebenen »Prozesse der Zivilisation « durch und damit einhergehend neue Wahrnehmungsweisen, Verhaltensstandards und Maßstäbe von Nüchternheit und Trunkenheit, die bis heute einflussreich sind (Groenemeyer und Laging 2012: 221–228).
Im Übergang von Mittelalter zur Neuzeit kommt es zu tiefgreifenden Wandlungsprozessen: Prägend sind hier die Urbanisierung mit ihrer fortschreitenden Arbeitsteilung, der kontinuierliche technische Fortschritt, die Durchsetzung und Verbreitung abstrakter Rechts- und Geldbeziehungen und vor allem auch die einsetzende Monopolisierung von Gewalt durch die sich etablierenden städtischen und staatlichen Institutionen. Im Zuge dieser Entwicklungen wachsen die gegenseitigen Abhängigkeiten; es bilden sich »Interdependenzketten«, in die immer mehr Menschen eingebunden sind. Dies erzwingt wiederum eine zunehmende Selbstkontrolle bzw. Selbstdisziplin und bedeutet u. a., dass zwischen spontanem emotionalem Impuls und tatsächlicher Handlung immer stärker ein Zurückhalten dieses Impulses und ein Überdenken der (Rück-)Wirkungen des eigenen Handelns gefordert wird (Elias 2000).
Der Rationalisierungsdruck auf die Individuen bewirkt zum einen die Entwicklung einer »Selbstzwangsapparatur«, das heißt, dass externe Kontrollen nach innen verlagert werden. Damit wird auch Trunkenheit als ein Mangel an Selbstdisziplin und als Verlust der Selbstkontrolle erfahrbar. Andererseits wachsen mit der Verinnerlichung von Zwängen auch spezifische Ängste und innere Spannungen an, die zumindest punktuell ein Ventil suchen: Wird im Mittelalter getrunken, weil die Affekte ungehemmt sind, so wird in der Neuzeit getrunken, um sie zu enthemmen. War das mittelalterliche Gelage eine gemeinschaftliche magische Praxis und soziale Pflicht für Männer, so wird mit der Durchsetzung disziplinarischer Zwänge und Tugenden und individualisierter Handlungsorientierungen der Rausch einerseits asozial und zu einer Pflichtverletzung, andererseits erhält er die Funktion der individuellen Entspannung (Groenemeyer und Laging 2012: 221–228).
Zugleich kam es – auch durch die zunehmenden Verfügbarkeiten hochprozentiger Alkoholika durch die Verbreitung preiswerter Destillationsverfahren – zu sehr breiten alkoholassoziierten Verelendungen in proletarischen städtischen Schichten in teilweise epidemischen Ausmaßen.
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen konnte Benjamin Rush (1745–1813) erstmalig eine Krankheitskonzeption übermäßigen Alkoholkonsums entwickeln, die als Vorläufer moderner Alkoholismuskonzeptionen gilt (Groenemeyer und Laging 2012: 228). Diese Konzeptionen können zudem als Prototyp für Suchtkonzeptionen allgemein (unabhängig von der Substanz) gelten und werden in Kapitel 1 »Sucht – eine Erkrankung wie jede andere auch?« differenzierter diskutiert.