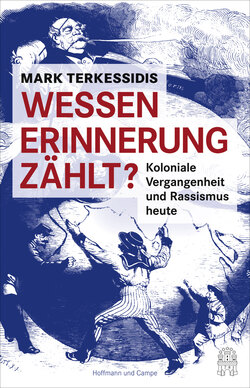Читать книгу Wessen Erinnerung zählt? - Mark Terkessidis - Страница 10
Deutsche Ansprüche auf Amerika
ОглавлениеIn Deutschland hatte die Neuerfindung Lateinamerikas als quasi unberührte Natur im 19. Jahrhundert in Bildungskreisen eine erhebliche Entdeckerenergie freigesetzt. Die Germanistin Susanne M. Zantop hat in einem Buch von 1999 von »Kolonialphantasien« gesprochen, von einem teilweise gar nicht bewussten »Kolonialkult«, der sich im Drang nach der »Verfügungsgewalt über fremde Ländereien, Bodenschätze und nicht zuletzt Menschenkörper und Menschenarbeit« ausdrückte. Im Rahmen dieser Phantasien wurde Christoph Kolumbus zum Stoff von Gedichten und Dramen, bei Friedrich Schiller, August Klingemann, Heinrich Bulthaupt oder Friedrich Rückert (Letzterer im Übrigen einer der Begründer der deutschen Orientalistik). Kolumbus wurde darin durchweg als Einzelgänger, unverstandenes Genie und eben Entdecker gefeiert. Dabei wird der Stoff mit der Zeit immer »deutscher«. Plötzlich wird Kolumbus ein deutscher Begleiter beigegeben, der sich als der eigentliche Tatmensch entpuppt. Oder Kolumbus erscheint als eine Art Vorläufer der personalisierten deutschen Nation, die sich mit quasi jugendlichem Drang an ihre eigenen Entdeckungen macht. In der Vorrede zu seinem Kolumbus-Stück beschreibt der Wiesbadener Dramatiker Karl Kösting 1863 »sein« deutsches Volk als »Volk ohne Gegenwart«, das »flehend wandelnd durch den Völkerreigen, verkannt, geschmäht, auf die Erlaubniß harrt, die Welt, die es im Geiste trägt, zu gebären«. Deutschland soll sich im »Dulder« Kolumbus erkennen und mutig seinem Weg folgen: »Dein Indien, deine deutsche Freiheit suchend, durchsegle kühn den Zeitenocean, der Menschenfreiheit ewig grüne Jugend winkt, ein Amerika, am Ende deiner Bahn.«
Interessant ist die Ambivalenz des bürgerlichen Konzepts von Freiheit, die sich hier zeigt. Freiheit ist hier nicht mehr die Freiheit von feudalen Abhängigkeiten oder absolutistischen Übergriffen, es ist nicht die Freiheit der Wahl, der Versammlung oder der Meinung, sondern Freiheit – auf die Ebene der Nation transferiert – bedeutet die Freiheit, sich Zugänge zur Welt erschließen zu können (»Indien«) und »am Ende« etwas zu erobern und in Besitz zu nehmen (»Amerika«), so wie es Kolumbus vorgemacht hat. Die »Entdeckung« setzt stets voraus, dass das Land leer ist, quasi unbewohnte Natur – die dort lebenden Kollektive zählen nicht, weil sie nicht die Reife besitzen, um über ihren Wohnort tatsächlich zu bestimmen. Diese Personen werden einbezogen und zugleich ausgeschlossen. In dem angeblich leeren Land, das aber doch bewohnt ist, gelten ganz andere Regeln, ganz andere Vorstellungen von Freiheit und Moral, hier kann alles Mögliche geschehen: Mission, Assimilation, Penetration, Erziehung, aber auch einfach Ausrottung. Das leere Land kann überall da sein, wo der Blick der »Entdecker« hinfällt.
Die »Kolonialphantasien« im Hinblick auf Südamerika wurden mit der Gründung des Deutschen Reiches 1871 virulent. Dabei war die Kolonialfrage von Beginn an verknüpft mit verschiedenen Gesichtspunkten: der Rolle und vor allem der Geltung des neuen Reiches in der Welt, der Beschaffung von Rohstoffen und der Schaffung von Absatzmärkten für die deutschen Industrieprodukte sowie der Frage des ausreichenden »Lebensraums« für die deutsche Bevölkerung. 1879 verfasste Friedrich Fabri, damals leitender Inspektor der evangelischen Rheinischen Missionsgesellschaft in Barmen, eine vieldiskutierte Broschüre mit dem Titel »Bedarf Deutschland der Kolonien?«. Fabri griff die genannten Punkte auf und bescheinigte dem Reich einen »Bedarf« – Kolonien seien eben Ausdruck des Unternehmergeistes und Fleißes eines aufstrebenden Volkes. Ihr Besitz war für Fabri so normal, dass er seine instrumentelle Argumentation im Sinne der genannten Punkte nicht einmal mit einer humanistischen Legitimation bemäntelte. Eine »Kulturmission« wurde erst am Ende des Buches erwähnt, aber nur in einem zirkulären Schluss: Wer mächtig sei, der sei »Träger einer Kulturmission«, und diese Mission helfe, dass Macht nicht zu Barbarei werde.
Die Frage war nur, wo die Kolonien sein sollten. »Ist nicht bereits alles besetzt und vergeben?«, fragt Fabri. Hier kam Südamerika ins Spiel, vor allem der südliche Teil Brasiliens, aber auch Uruguay, Argentinien und Chile wurden erwähnt.
Fabri differenzierte zwei Arten von Kolonien. Die »Ackerbau-Kolonien« sollten eine millionenfache Auswanderung ermöglichen. Im Rahmen der Industrialisierung hatte sich die Bevölkerung der deutschen Städte fast verdoppelt, und die Armut war enorm – vielen bürgerlichen Deutschen schien von dieser Entwicklung eine immense Gefahr auszugehen. In diesem Sinne empfahl Fabri eine solche Auswanderung auch als Mittel im Kampf gegen das Erstarken der Sozialdemokratie. Solche Kolonien, meinte Fabri, bedürften nicht der gewaltsamen Aneignung, sondern nur der Gründung eigener Distrikte, die in Sprache und Konfession deutsch sein und mit dem Reich in Verbindung stehen sollten beziehungsweise von Berlin aus beeinflusst werden konnten. Die zweite Version von Kolonien waren nach Fabri die »Handels-Kolonien«, die gar keine Landnahme beinhalteten, sondern nur die Gründung von Stütz- und Knotenpunkten zur Erschließung von Investitionsmöglichkeiten und Absatzmärkten.
Nun war der Imperialismus des Kaiserreichs alles andere als ein homogener Block. Der erste Reichskanzler Otto von Bismarck vertrat nach der Reichsgründung eine Position der »Saturiertheit« (das Reich hat vorerst genug Territorium) und predigte eher Zurückhaltung. Auch innerhalb der Kolonialbefürworter existierten unterschiedliche Fraktionen, und es gab auch ausgesprochene Gegner einer imperialen »Weltpolitik« wie etwa die Sozialdemokraten und alle Gruppierungen links der SPD. Dennoch versuchte das Deutsche Reich, unterstützt durch die aufgerüstete neue Kriegsflotte, sowohl durch »Kolonisten« als auch durch Kaufleute an Einfluss zu gewinnen. Das zog auch Abenteurer und Geschäftemacher aller Art an. Emil Witte, deutscher Botschaftsrat in den Vereinigten Staaten, berichtete in seinen Erinnerungen über eine interessante Episode. Baron Herbert de Reuter, erfolgloser Sohn des Gründers der Presseagentur Reuters, ließ der Botschaft Ende des 19. Jahrhunderts einen Brief überbringen, in dem er behauptete, eine Konzession für 1600000 Morgen Land in Kolumbien zu besitzen. Er habe bereits mit dem Gesandten des Landes über die Ansiedlung von deutschen Kolonisten gesprochen. Bald bot er dem Reich ganz Kolumbien als »Protektorat« an. Nun war de Reuter eine zu windige Person – das Auswärtige Amt zeigte sich nicht interessiert. Aber die Episode zeigt, wie verfügbar die Welt für die europäischen Regierungen und Kaufleute in jener Zeit erschien.