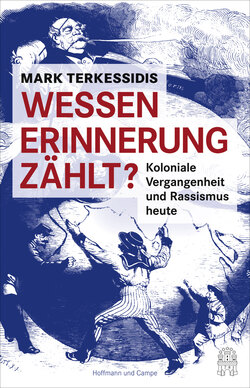Читать книгу Wessen Erinnerung zählt? - Mark Terkessidis - Страница 6
»Entdeckung«: Gewalt und Monolog
ОглавлениеMittlerweile wird der Ausdruck »Entdeckungen« auch in Deutschland fast überall in Anführungszeichen verwendet, weil die Perspektive unverhohlen eurozentrisch ist. Zudem dürfte »Entdeckung« kaum das richtige Wort sein für jenen seltsamen Vorgang, der sich im Jahr 1492 abspielte, als die drei Schiffe Santa Maria, Nina und Pinta auf die kleine Insel Guanahani trafen, die heute zu den Bahamas gehört. Es handelte sich um eine Expedition, die der Italiener Christoph Kolumbus im Auftrag der spanischen Krone leitete. Die damals einflussreichsten europäischen Königreiche Portugal und Spanien sahen sich im Handel mit Indien und China durch das immer mächtiger werdende Osmanische Reich blockiert, das für die Durchquerung hohe Zölle verlangte. Und so waren jene Schiffe auf der Suche nach einer Seeroute nach Ostasien, um den Osmanen auszuweichen. Am Ufer von Guanahani sahen die Seefahrer dort ansässige Menschen. Was die Menschen vor Ort beim Anblick der Europäer dachten, wissen wir nicht, aber Kolumbus hat seine Gedanken in ein »Bordbuch« eingetragen, von dem Teile überliefert sind. »Dort«, schreibt er prosaisch, »erblickten wir sogleich nackte Eingeborene.« Die Reise bis dahin muss für damalige Verhältnisse geradezu phantastische Dimensionen gehabt haben: vom spanischen Huelva nach Teneriffa und dann über den kompletten Atlantik, zweieinhalb Monate lang, wochenlang nichts als Wasser und Ungewissheit. Niemand wusste, ob die Annahmen des Kolumbus wirklich zutrafen, nicht einmal er selbst – es war buchstäblich eine Reise ins Nichts. Kolumbus schildert ausführlich die Probleme mit der Überfahrt, die Phasen der Windstille, die Unzufriedenheit der Besatzung, die vor lauter Angst jedes Ereignis auf der Reise als schlechtes Omen sah. Umso verwunderlicher die prosaische Reaktion: Die Meldung, es sei Land in Sicht, führt noch zu einer gewissen Aufregung, das Sichten von Menschen kaum. Warum lässt es den Seefahrer kalt?
Kolumbus zeigte gar kein Interesse an einem Dialog mit den Personen, sein Ziel war die schiere Besitzergreifung. Im Vertrag von Santa Fe hatte er sich von der Krone das Recht zusichern lassen, ein Zehntel einbehalten zu dürfen »von allen Perlen, Edelsteinen, Gold, Silber, Spezereien sowie allen anderen Kauf- und Handelswaren, die in seinem Bereich gefunden, gebrochen, gehandelt oder gewonnen werden«. Die »Entdecker« und die Eroberer waren keine Aristokraten, die mit Ehren und Titeln belohnt wurden, sie begehrten materielle Güter, Land, Anteile, Geld. Gerade angekommen, fährt Kolumbus mit einem bewaffneten Boot an Land und entfaltet dort die königliche Flagge. Dann ruft er seine Begleiter zusammen, damit sie die Besitzergreifung bezeugen können, die mit einer urkundlichen Unterschrift besiegelt wird. Derweil haben sich Menschen, die auf der Insel wohnen, um das Spektakel versammelt. Sie sehen die Fahne der katholischen Könige, sie hören die unverständliche Verlesung der Urkunde, die eine seltsame Form von Einbeziehung verkündet. Das Ziel der Besitzergreifung ist angeblich die »Rettung« jener Menschen durch ihre Bekehrung zu »unserem heiligen Glauben«. Diese Rettung will Kolumbus angeblich durch Liebe und nicht durch das Schwert bewerkstelligen. So verschenkt er »rote Kappen und Halsketten aus Glas und noch andere Kleinigkeiten von geringem Wert«. Die Freude der Anwesenden über die friedliche Geste zeigt ihm ihre kindliche Unbedarftheit und die eigene Überlegenheit.
Der Akt der Besitznahme wurde ab 1513 mit einem festgelegten Text, dem Requerimento, durchgeführt, das von einem königlichen Beamten verlesen werden musste. Eigentlich sollte es übersetzt werden, aber es ist davon auszugehen, dass das in den seltensten Fällen geschah. In den ersten Zeilen wurden die Einheimischen mit freundlichen Worten dazu aufgefordert, zum christlichen Glauben überzuwechseln. Im Falle der Zustimmung konnten sie freie Untertanen der kastilischen Krone werden. Wenn sie sich aber nicht äußerten, was aufgrund der Sprachbarriere wahrscheinlich erschien, gab es für die Konquistadoren keine Grenzen mehr: Nicht nur das Eindringen mit Gewalt und die Unterwerfung waren dann legitim, sondern die Versklavung und die Plünderung und das Antun von jedem Schaden und Bösen. Der Text besagte, die Menschen hätten diese Behandlung selbst über sich gebracht, sodass »die Tötungen und Schäden, die sich daraus ergeben werden, zu euren Schulden gehen und nicht zu denen seiner Hoheit«.
Diese Urszene der Begegnung mit den überseeischen Anderen verdeutlicht, wie Rassismus funktioniert. Ein Dialog soll gar nicht stattfinden. Während noch Geschenke verteilt werden und die »Entdecker« Süßholz raspeln, verwandeln sich die Ansässigen im besten Fall in Untertanen der Krone, in unreife, falschgläubige Untertanen, die eigentlich noch zu Untertanen gemacht werden müssen. Im schlimmsten Fall sind sie einfach Aussätzige, denen gegenüber jede Grausamkeit der neuen Herren per se gerechtfertigt erscheint. Mit Rassismus ist daher etwas anderes gemeint als das Verhältnis zwischen Gruppen, die an die Grenzen ihres Sprach- oder Verständnisraums stoßen. Das wäre in etwa so wie das Verhältnis der antiken Griechen zu jenen, die sie als Barbaren bezeichneten. Der Begriff Barbar, den man heute natürlich vollkommen anders verwendet, bedeutete damals nichts anderes als eine Person, deren Sprache man nicht verstand. Der Begriff hatte etwas Abwertendes, aber nur in dem Sinne, dass die Anderen unverständliche Laute ausstießen. Mit dem modernen Rassismus, sagt der Sozialwissenschaftler Immanuel Wallerstein, sei ein vollkommen neues Beziehungsgeflecht in die Welt gekommen. Das Besondere am Rassismus zeige sich in einem paradoxen Verhältnis: Rassismus schließe Menschen aus, indem es sie einbeziehe.
Die Menschen der neuen Territorien in Übersee sind nicht einmal mehr »Barbaren«, die in fremder Zunge brabbeln, sie sind gar keine »Fremden«, die Neugier oder auch Angst hervorrufen. Es gibt keine Begegnung, die Spanier scheinen bereits alles über diese anderen Menschen zu wissen, die für sie gar keinen Subjektstatus haben, sondern nur Besitz sind. Als Nicht-Christen werden sie zu zukünftigen Objekten von Erziehungsmaßnahmen – ihre Sprache und ihr Sprechen sind den Eroberern völlig gleichgültig. Nun wollten die Einheimischen kein Besitz werden und begannen, sich zu wehren. 1525 berichtete ein anderer Dominikanermönch, Tomas Ortiz, über die Indigenen Folgendes: »Sie sind mehr als irgendein anderes Volk unzüchtig. Gerechtigkeit gibt es bei ihnen nicht. Sie gehen ganz nackt, haben keine Achtung vor wahrer Liebe und Jungfräulichkeit und sind dumm und leichtfertig. Wahrheitsliebe kennen sie nicht, außer wenn sie ihnen selbst nützt. Sie sind unbeständig, glauben nicht an die Vorsehung, sind undankbar und umstürzlerisch. (…) Sie sind gewalttätig, und verschlimmern dadurch noch die ihnen angeborenen Fehler.«
Zweifellos handelt es sich bei diesen Aussagen um hanebüchene Klischees, doch diese Klischees haben eine Funktion: Sie erklären etwas, und sie rechtfertigen auch etwas. Die Einheimischen Amerikas auf diese Weise wahrzunehmen, gab den spanischen Konquistadoren und Missionaren die Möglichkeit, die Eroberung zu einer regelrechten Notwendigkeit zu machen. Dabei erklären die Klischees von den »angeborenen Fehlern« einen Unterschied, den eigentlich die Spanier erst hergestellt haben – mit ihren Besitzansprüchen, mit ihren Waffen, mit ihrer Perspektive, die sie absolut setzen. Im Grunde tun die Erobernden ständig so, als hätten sie keine andere Wahl gehabt. Sie finden und sie erfinden Gründe, warum sie die Anderen unterdrücken mussten, und diese Gründe liegen in der »Natur« derer, denen man Gewalt antut: Wir mussten »sie« fesseln, weil sie so wild waren oder weil sie wie Kinder waren oder weil sie nicht arbeiten wollten.
Wenn ich die Bemerkungen von Ortiz auf ihre Essenz reduziere und etwas aktueller formuliere, dann klingt das in etwa so: »Sie« kleiden sich auf eine Weise, die unseren Ordnungsvorstellungen widerspricht, und verstoßen gegen unseren Glauben und unsere Moralcodices, es mangelt ihnen (genetisch) an Intelligenz und Beständigkeit, sie stören die Ordnung und machen ständig Ärger. Das wirkt plötzlich bekannt. Unschwer lassen sich Vorstellungen erkennen, die auch heutzutage verbreitet sind etwa über »Ausländer«, Geflüchtete oder über »die Muslime«. Offenbar gibt es bei aller Variation auch eine ziemliche Konstanz des Wissens über die jeweiligen Anderen. Im Ausschluss durch Einbeziehung muss der Unterschied immer wieder untermauert werden, wobei die angeblich natürlichen Fehler ähnlich bleiben.
Dass die Differenz aber überhaupt begründet werden muss, ist ein Phänomen der Moderne. In der Antike mussten die Eroberungen und die Sklaverei nicht legitimiert werden – sie waren selbstverständlich –, in der Moderne schon. Es gab nicht nur den Widerstand derer, die unterdrückt wurden, sondern von Beginn an auch in Europa Kritik an Sklaverei und Kolonialismus. Weil die Eroberungen mit dem christlichen Glauben begründet wurden, konnte das christliche Menschenbild auch eine Basis von Kritik bilden – an den Gewaltexzessen, an der Sklaverei. Die »Entdeckungen« stellten von Anfang an ein Kuddelmuddel von nackter Gewalt, Anklagen, Rückzügen, Wissensprozessen, Verteidigungsreden und Kämpfen dar. Der Westen war immer schon ein widersprüchlicher Ort. Seine Errungenschaften sind ein Januskopf: Auf der einen Seite entwickeln sich Fortschritt, Wohlstand, Freiheit und Demokratie, während auf der anderen Unterdrückung, Ausbeutung und Ausgrenzung zu Buche stehen. Rassismus lässt sich als »Apparat« verstehen, in dem die Praxis der Unterdrückung mit einer Wissensbildung einhergeht, welche die Unterdrückung erklärt und legitimiert. Es handelt sich um ein dauerhaftes Ungleichheitsverhältnis, ähnlich wie Klassenunterschiede oder Sexismus.